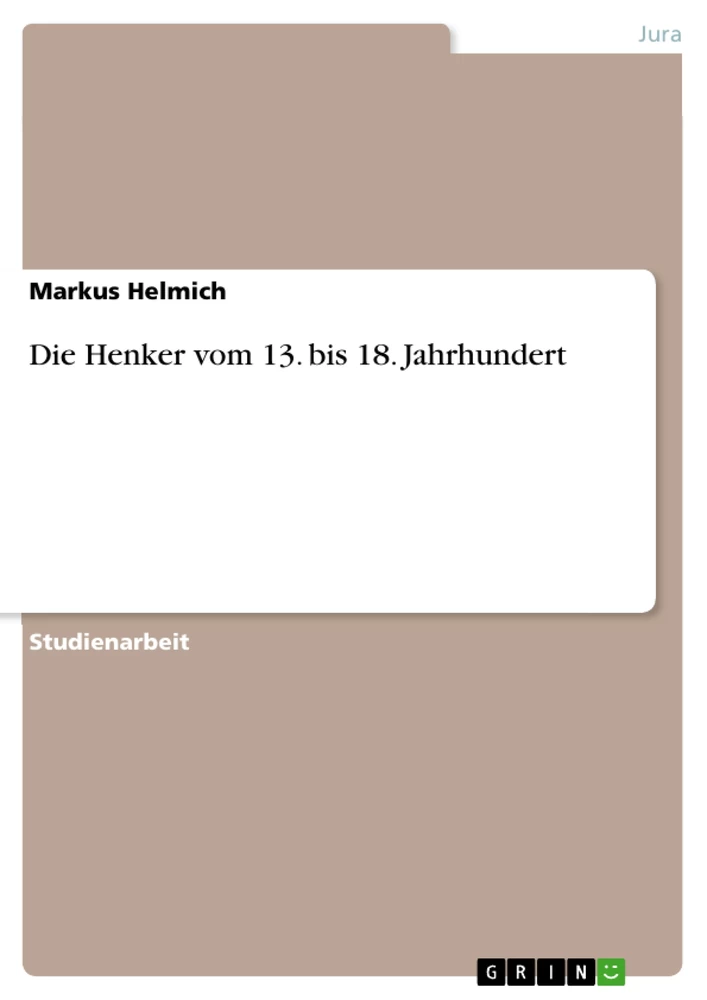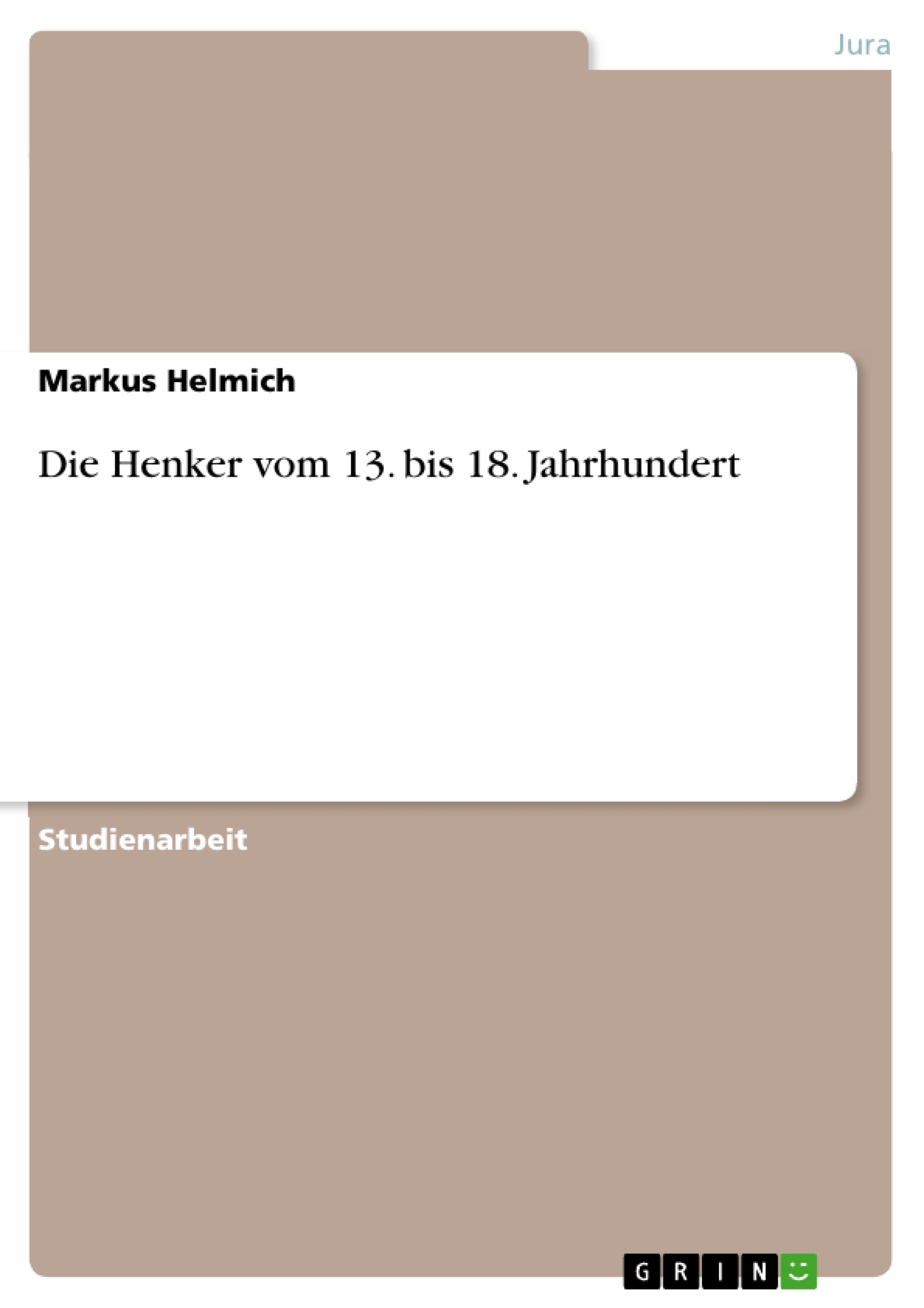Der Beruf des Henkers durchlief anfangs eine unruhige Zeit
Es gab keinen berufsmäßigen Scharfrichter bis zum 13. Jahrhundert. Ein Anlass für das anfängliche Desinteresse am Henkerberuf war nicht nur der blutige Beruf, sondern auch dass die Todesstrafen bis zu den Landfrieden die Ausnahme darstellten. Am Ende des Spätmittelalters hatte nahezu jede größere Stadt einen eigenen Henker.
Tabuisierung und Ambivalenz führten zur Zwiespältigkeit
Der Henkerberuf galt als 'unrein' und 'unehrlich' und war ein „unbeliebter“ Beruf. Den Stammhaltern von Henkern stand bis Anfang des 18. Jahrhunderts kein anderer Berufsweg offen. Doch dieser Teil des „Fluches“ nahmen die Reichsgesetze der Jahre 1731 und 1772 von der Henkersfamilie, indem sie jene Kinder und Enkel für ehrlich erklärten.
Zu den direkten Aufgaben des Scharfrichters gehörten die Todes- und Leibesstrafen. Art und Form der Hinrichtung orientierte sich an der Gefährlichkeit und der Schwere des Vergehens. Die Folge war, dass es mehrere Arten von Hinrichtungen gegeben haben muss: Enthauptungen, Lebendigbegraben, Pfählen, Rädern, Verbrennen und Vierteilen. Dazu kamen Körper- und Ehrenstrafen sowie die Durchführung der peinlichen Befragung oder Folter. Daneben musste er auch oft unangenehme Nebenaufgaben übernehmen: z. B. Kloakenreinigung, die Bestattung von Selbstmördern, die Aufsicht über die Prostituierten sowie beanstandete Bücher zu verbrennen.
Ein eigenartiger Gegensatz
bestand in der häufig vorkommenden Verbindung von Scharfrichter und Heilkundigem: Er nahm das Leben, quälte die Gesetzesbrecher, doch dem anderen half er als fachmännischer und anerkannter Arzt und Chirurge.
Die Hinrichtung war vereinzelt ein Schauspiel.
Die Hinrichtung sollte ein würdevoller, erhebender Akt mit erzieherischer Wirkung auf die Öffentlichkeit sein. Das blutige Schauspiel war tatsächlich geeignet, Aggressionen abzubauen und große, erregte Massen zu beruhigen und Macht zu demonstrieren.
Psychologische Schäden waren nicht selten
Diese Tätigkeit verursachte bei vielen Henkern schwere seelische Störungen. Alkoholsucht, Depressionen und Selbstmord waren die häufigsten Ausprägungen. Aufgrund ihrer medizinischen Fähigkeiten ließen sich zahlreiche Nachkommen der Henker seit dem 18. Jahrhundert vermehrt in ärztlichen Berufsfeldern nieder.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Geschichte des Scharfrichters
- Tabuisierung und Ambivalenz
- Henkerdynastien
- Die Aufgaben des Henkers
- Die Hauptaufgaben
- Heilkräfte
- Körper- und Ehrenstrafen
- Durchführung der peinlichen Befragung od. Folter
- Fehlrichten des Henkers
- Nebenaufgaben
- „Stadmedicus“
- Aberglaube, Henkersmahlzeiten und Mütze
- Zunftentwicklungen
- Die Hinrichtung
- Frauen
- Psychologische Schäden
- Tod
- Das Ende des Henkerberufs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Henkerberufs vom 13. bis 18. Jahrhundert. Ziel ist es, die gesellschaftliche Stellung des Henkers, seine Aufgaben und die damit verbundenen Tabuisierungen und Ambivalenzen zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Henkerberufs vom Mittelalter bis zur Neuzeit
- Die Aufgaben und Pflichten des Henkers, inklusive der Durchführung von Todesstrafen und anderer Strafen
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung des Henkers
- Die Rolle des Aberglaubens und der Traditionen im Zusammenhang mit dem Henkerberuf
- Das Ende des Henkerberufs und die Gründe dafür
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Der Text beginnt mit einer Einführung in den Beruf des Scharfrichters, der im Mittelalter auch als Henker, Freimann, Schinder oder Züchtiger bezeichnet wurde. Er beschreibt die Tätigkeit des Scharfrichters als eine offizielle Tötungshandlung, verbunden mit starken Emotionen und Aberglauben, und zeigt, wie sich die Vollstreckung von Todesurteilen von der Übergabe des Verurteilten an den Kläger hin zur Einrichtung eines eigenen Amtes entwickelte. Die Einführung legt den Grundstein für die weitere Erforschung der Geschichte und des gesellschaftlichen Stellenwertes des Henkers.
Geschichte des Scharfrichters: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Berufs des Scharfrichters. Es wird deutlich, dass es bis zum 13. Jahrhundert keinen professionellen Scharfrichter gab. Die ersten besoldeten und ausgebildeten Scharfrichter wurden erst danach eingestellt. Die Erwähnung des Scharfrichters (carnifex) im Augsburger Stadtrecht von 1276 wird hervorgehoben, ebenso wie die zunehmende Verbreitung des Amtes im deutschsprachigen Raum und die Rolle von Rechtsordnungen wie der Bambergischen Halsgerichtsordnung und der Carolina von 1532 bei der Gestaltung des Berufs. Das Kapitel verdeutlicht die anfängliche Abneigung gegen diesen Beruf und die Umstände, die zur Institutionalisierung des Henkeramtes führten, einschließlich der Rolle des römischen Rechts.
Tabuisierung und Ambivalenz: Der Henkerberuf war stark tabuisiert und mit Ambivalenz behaftet. Henker galten als „unrein“ und „unehrlich“, vergleichbar mit Gauklern oder Juden. Ihre Berührung galt als ehrenrührig. Bestimmte Strafen wurden ausschließlich vom Scharfrichter vollzogen, was diese mit einer unehrenhaften Wirkung verband. Der Text hinterfragt die Gründe für diese Ablehnung trotz der breiten gesellschaftlichen Teilnahme an Hinrichtungen, und der Abschnitt zeigt den ambivalenten Status des Henkers auf: gesellschaftlich geächtet, aber gleichzeitig vom Kaiser geschützt.
Schlüsselwörter
Scharfrichter, Henker, Hinrichtung, Todesstrafe, Mittelalter, Neuzeit, Tabuisierung, Ambivalenz, Gesellschaft, Aberglaube, Rechtsprechung, Carolina, Beruf, Geschichte, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen: Geschichte des Henkerberufs (13.-18. Jahrhundert)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Henkerberufs vom 13. bis 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Stellung des Henkers, seine Aufgaben und die damit verbundenen Tabuisierungen und Ambivalenzen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Henkerberufs vom Mittelalter bis zur Neuzeit, die Aufgaben und Pflichten des Henkers (einschließlich der Durchführung von Todesstrafen und anderer Strafen), die gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung des Henkers, die Rolle des Aberglaubens und der Traditionen im Zusammenhang mit dem Henkerberuf und schließlich das Ende des Henkerberufs und die Gründe dafür.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einführung, Kapitel zur Geschichte des Scharfrichters, zur Tabuisierung und Ambivalenz des Berufs, zu den Aufgaben des Henkers (Hauptaufgaben, Heilkräfte, Körper- und Ehrenstrafen, peinliche Befragung/Folter), zu Fehlrichten, Nebenaufgaben, dem „Stadmedicus“, Aberglauben, Zunftentwicklungen, Hinrichtungen, Frauen als Henkerinnen, psychologischen Schäden, dem Tod des Henkers und dem Ende des Berufs. Zusätzlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wann entstand der Beruf des professionellen Scharfrichters?
Bis zum 13. Jahrhundert gab es keinen professionellen Scharfrichter. Erst danach wurden die ersten besoldeten und ausgebildeten Scharfrichter eingestellt. Das Augsburger Stadtrecht von 1276 erwähnt den Scharfrichter (carnifex).
Wie wurde der Henker gesellschaftlich wahrgenommen?
Der Henkerberuf war stark tabuisiert und mit Ambivalenz behaftet. Henker galten als „unrein“ und „unehrlich“, vergleichbar mit Gauklern oder Juden. Ihre Berührung galt als ehrenrührig. Trotz der gesellschaftlichen Teilnahme an Hinrichtungen, war der Henker gesellschaftlich geächtet, aber gleichzeitig vom Kaiser geschützt.
Welche Aufgaben hatte der Henker neben der Hinrichtung?
Neben der Durchführung von Todesstrafen hatte der Henker weitere Aufgaben, darunter die Durchführung von Körper- und Ehrenstrafen, die peinliche Befragung oder Folter und manchmal sogar heilkundliche Tätigkeiten („Stadmedicus“).
Welche Rolle spielte der Aberglaube?
Der Aberglaube spielte eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit dem Henkerberuf. Der Text erwähnt beispielsweise den Aberglauben rund um Henkersmahlzeiten und die Henkersmütze.
Wie endete der Henkerberuf?
Die Arbeit behandelt das Ende des Henkerberufs und die Gründe dafür, geht aber nicht im Detail darauf ein. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der in der Zusammenfassung der Kapitel nur angerissen wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Scharfrichter, Henker, Hinrichtung, Todesstrafe, Mittelalter, Neuzeit, Tabuisierung, Ambivalenz, Gesellschaft, Aberglaube, Rechtsprechung, Carolina, Beruf, Geschichte, Deutschland.
- Quote paper
- Markus Helmich (Author), 2009, Die Henker vom 13. bis 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178276