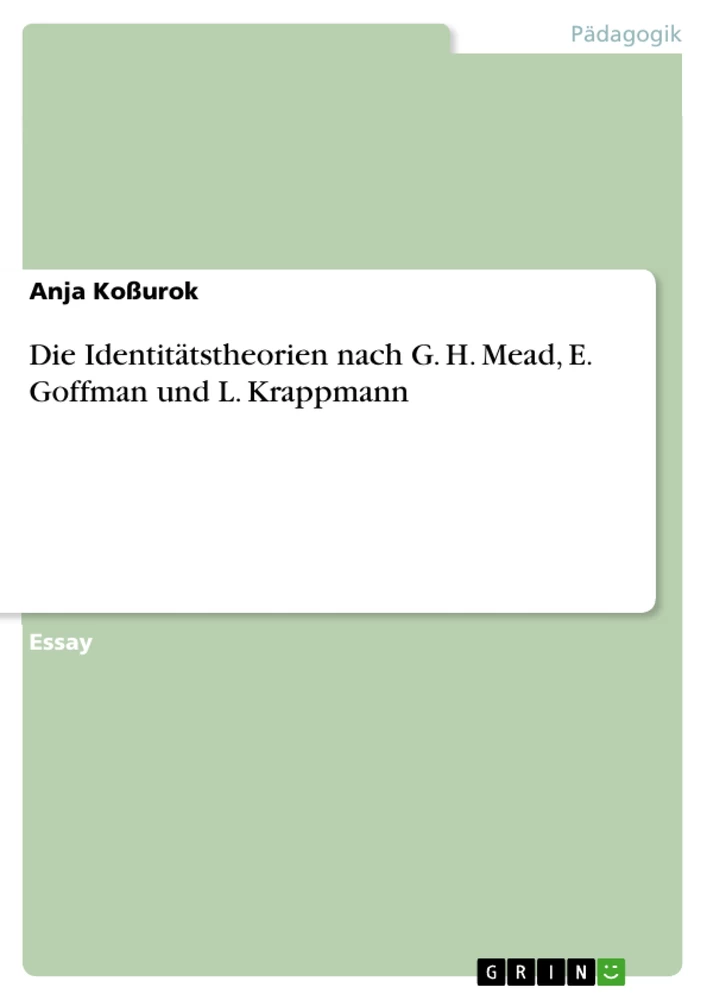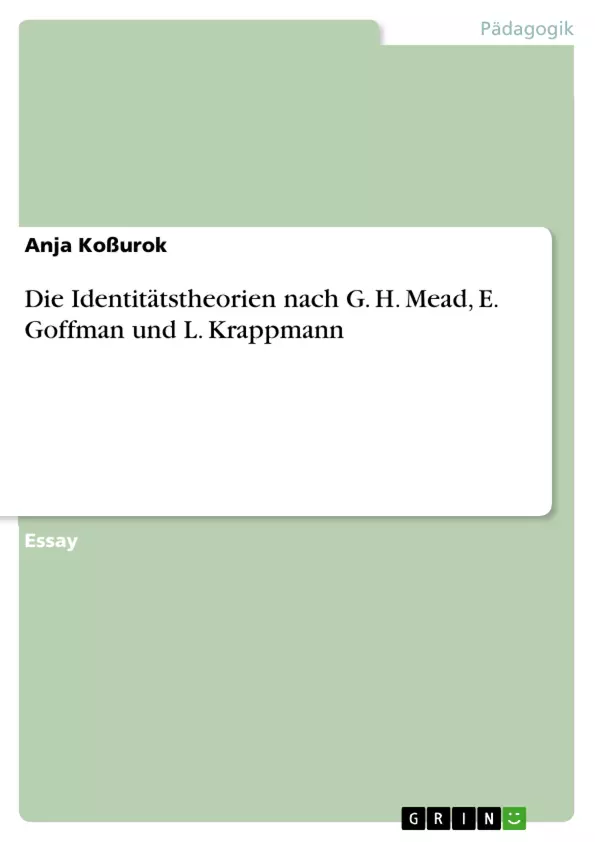Dieser Essey behandelt die drei großen Identitätstheoretiker und verdeutlich den Zusammenhang zwischen ihren Theorien.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Identitätstheorie nach George Herbert MEAD
1.2 Identitätstheorie nach Erving GOFFMAN
1.3 Identitätstheorie nach Lothar KRAPPMANN
2 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Möchte man sich der Frage von Identität annehmen, kann dies nicht ohne Bezugnahme auf George Herbert Mead ("Geist, Identität, Gesellschaft", 1968) geschehen. Er bietet zwar keine direkte Definition von Identität, jedoch versucht er ihre Entstehung und ihr Wesen zu beschreiben. Ebenso wie Mead geht auch Krappmann (1973) davon aus, dass Sprache als das Hauptinstrument bei der Vermittlung von Identitäten fungiert. Da Krappmann wie Mead eien dynamischen Identitätsbegriff vertritt, begreift er unbeschädigt Identität nicht als eine Charaktereigenschaft, sondern als das Ergebnis von Handlungen, welche in jeder Interaktionssituation neu erreicht werden muss. In gewissem Sinne komplementär zu Krappmann, hat sich Erving Goffman (1967) mit der Entstehung von Identität, insbesondere beschädigter Identitäten und den damit verbundenen Verhaltensstrategien beschäftigt. Beschädigt Identität resultiert aus einer Folge von Normabweichungen, die zu gesellschaftlicher Stigmatisierung führt. Da alle drei Identitätstheorien auf Grundlage des symbolischen Interaktionismus erwachsen sind, stellt Sprache, Kommunikation und Gesellschaft die Grundlage jeder dieser Theorien dar. Ich möchte im Folgenden versuchen, die unterschiedlichen Herangehensweisen dieser drei Theoretiker zu dokumentieren und auf Zusammenhänge unter ihnen einzugehen.
1.1 Identitätstheorie nach George Herbert MEAD
Mead´s Grundannahme stützt sich auf Betrachtungen zu Zeichen und Gesten. Vor allem Gesten sind gesellschaftlich vereinbart, sie haben eine Bedeutung. Wenn Gesten über eine konkrete Situation hinausgehen und einen allgemeinen Sinn haben, so nennt Mead sie Symbole. Gesten und Symbole müssen stets neu interpretiert werden und sind nicht unmittelbar klar. Wenn trotz Interpretation die Bedeutung eines Symbols in einer Gesellschaft gleich ist, spricht Mead von signifikanten Symbolen, wobei das wichtigste signifikante Symbol das der Sprache ist. Die Fähigkeit sich in andere hineinversetzen zu können, bezeichnet Mead als Rollenübernahme (role taking). An dieser Stelle setzt er die Notwendigkeit, die Erwartungen des anderen zu interpretieren und seinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden, gleich. Das heißt Mead unterstellt ein allgemeines Interesse am Funktionieren der Gesellschaft, was sich von Parsons her ableitet. Mead´s Identitätsbegriff bezieht sich nicht nur auf Interaktion, sondern primär auf die Übernahme von Haltungen. Er unterstellt, dass jedes Gesellschaftsmitglied das sein möchte, was von ihm erwartet wird, das sich ein Jeder während seines Handelns mit den Augen der anderen sieht. Diese Identität bezeichnet Mead als self. Zur Ausbildung des self bedarf es jedoch Sozialisationsprozesse, die Mead im play und game sieht. Als play bezeichnet er das kindliche Rollenspiel, welches die ihn umgebenden Personen nachahmt und so nach und nach die Haltungen, dieser signifikanten Anderen, internalisiert. Im späteren game lernt das Kind die organisierte Gemeinschaft, also die generalisierten Anderen, kennen. Es lernt, die Haltungen der Anderen und seine Eigene ihnen gegenüber zu einem Ganzen zu organisieren. Ohne Empathie ist die Bildung dieses „verallgemeinerten Anderen“, nach Mead, nicht möglich. Play und game bilden Sichtweisen auf die Welt, die Gesellschaft und das System der Rollen. Der Mensch erlernt die Erwartungen der Gesellschaft und geht auf diese, in Form von Interaktion, ein. Er übernimmt die Rollenerwartungen an ihn und bildet seine Identität. Gegenüber dem self, dem Wunsch die Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, steht das impulsive, unbewusste I. In ihm kommen sinnliche und körperliche Bedürfnisse spontan zum Ausdruck und es ist nie vollständig sozialisierbar. Das I birgt die Gefahr, die soziale Selbstdisziplinierung, die über die Internalisierung des generalisierten Anderen erfolgte, aufzuheben. Gleichzeitig ist es aber auch Zeichen von Spontanität und Persönlichkeit eines Gesellschaftsmitglieds. Die dritte Facette menschlicher Identität bildet das Me, das reflektierte Ich, welches das eigene Handeln in Relation zu den Erwartungen des generalisierten Anderen, reflektiert. Aus der Differenz zwischen dem unreflektierten, spontanen Handeln des I und der Reflexion der Handlung durch das Me, entwickelt sich reflexives Bewusstsein. Ergebnis des reflexiven Bewusstseins ist die Synthese der reflektierten Ichs im self, was nach Mead Identität darstellt. Sozialisation dient bei Mead demnach dazu, dass das Individuum lernt, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden, wobei der andere im Verlauf der Zeit zunehmend zur Gesellschaft insgesamt verallgemeinert wird.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anja Koßurok (Autor:in), 2010, Die Identitätstheorien nach G. H. Mead, E. Goffman und L. Krappmann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178183