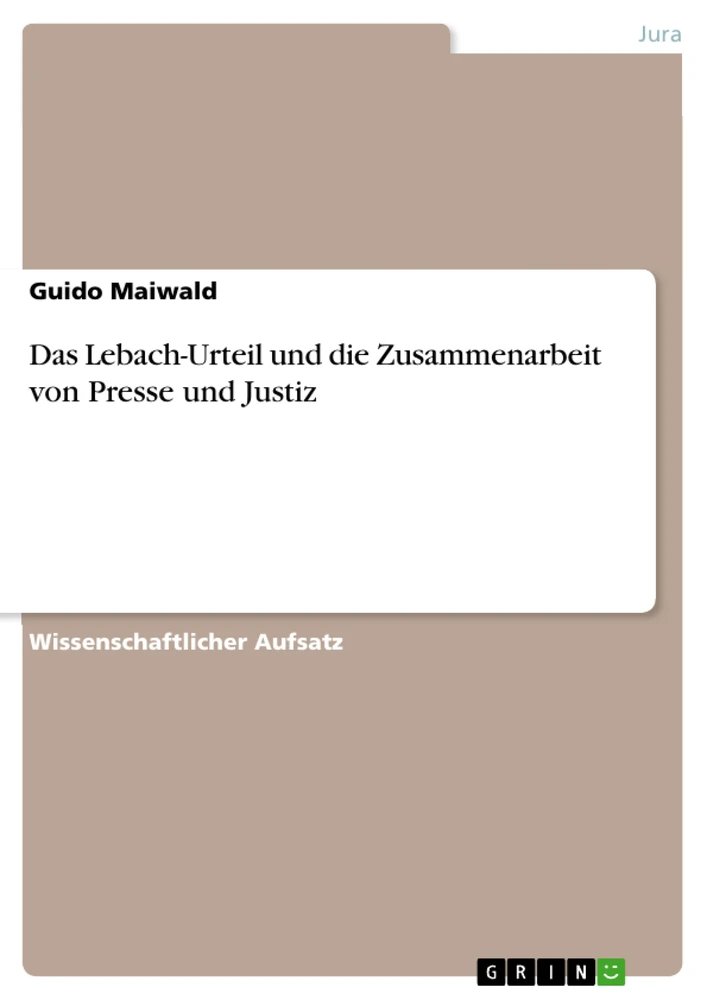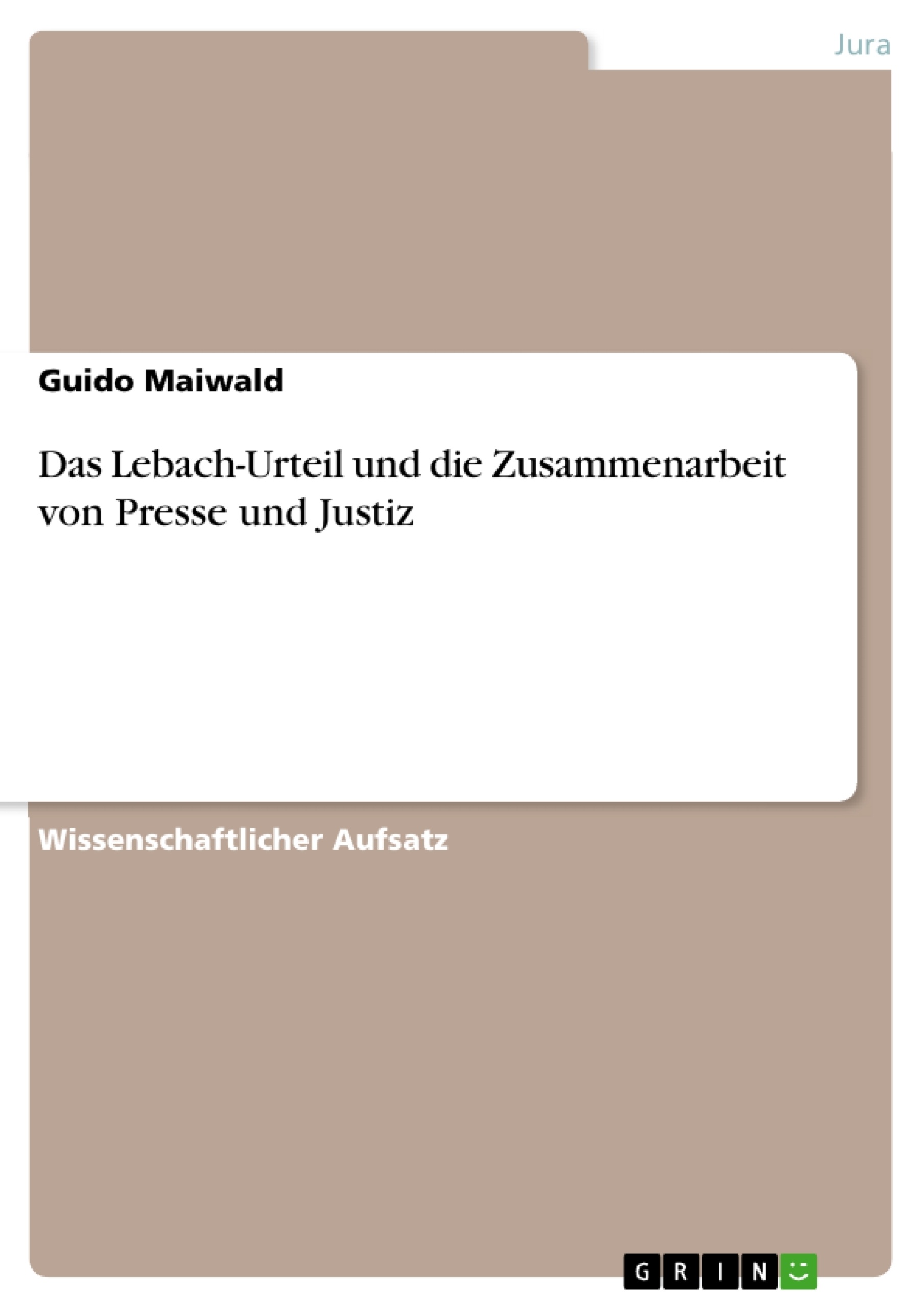Im Jahre 1972 produzierte das ZDF ein Dokumentarspiel mit dem Namen „Der Soldatenmord von Lebach“. In diesem bedeutenden Kriminalfall aus dem Jahre 1969 hatten zwei Männer bei einem Überfall auf ein Waffen- und Munitionsdepot der Bundeswehr drei Soldaten im Schlaf ermordet und einen vierten schwer verletzt. Der Fall erregte die Öffentlichkeit in hohem Maße, da die Diskussionen um das Bestehen einer Armee in Deutschland noch nicht verstummt waren. Aufgrund des hohen Publikumsinteresses beauftragte der ZDF Programmdirektor Joseph Viehöver Jürgen Neven-du Mont mit der Produktion eines Dokumentarspiels. Im Frühjahr 1972 wurde der Film fertiggestellt und sollte im Juni des selben Jahres ausgestrahlt werden. Der Täter hatte eine Unterlassungsklage beim Landgericht Mainz eingereicht. Er begründete die Klage mit einer Erschwerung seiner Resozialisierung, da er bald entlassen werden sollte. Im Juni lehnte das Landgericht Mainz die Klage mit der Begründung ab. Der Kläger ging jedoch in Revision vor das Oberlandesgericht, welches die Klage ebenfalls ablehnte. Die Ausstrahlung wurde dennoch verschoben, da auch seitens der Politik und Medien Kritik am Format der Sendung geübt wurde. Der Kläger begründete seine anschließende Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Argument, dass falls es zu einer Ausstrahlung komme, dies eine erhebliche Verletzung seiner Privatsphäre bedeuten würde. Am 5. Juni 1973 untersagte das Bundesverfassungsgericht dem Sender die Ausstrahlung. In seinem Urteil stellte es fest, dass die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG garantierte Rundfunkfreiheit eingeschränkt werden kann, wenn diese in Konflikt mit anderen Rechtsgütern gerät. Unter Androhung einer Geldbuße untersagte das Gericht dem ZDF den Kläger namentlich zu erwähnen oder darzustellen. In der Folgezeit entbrannte ein Rechtsstreit, der wiederum bis vor das Verfassungsgericht getragen wurde. Für den Abend des 4. Dezembers 1996 hatte der Fernsehsender Sat1 den Pilotfilm „Der Fall Lebach“ angekündigt. Am 2. Dezember hatte einer der damaligen Haupttäter beim Landgericht Mainz eine einstweilige Verfügung erwirkt. Von August 1997 an betrieb Sat1 das Widerspruchsverfahren vor dem LG. Mainz. Neben den Urteilen im Falle Lebach gibt die Arbeit einen Überblick über die aktuellen Richtlinien für die Zusammenarbeit von Justiz und Medien und über Gründung und Arbeit des Deutschen Presserates.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Das erste Urteil von 1973
- 1.2 Das Sendeverbot von 1996
- 2. Richtlinien für die Zusammenarbeit von Justiz und Medien
- 2.1 Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren
- 2.2 Richtlinien der Bundesländer
- 3 Der Deutsche Presserat
- 3.1 Geschichte des Presserates
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das „Lebach-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973, welches sich mit dem Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und dem Persönlichkeitsrecht eines Straftäters befasst. Im Fokus steht die Frage, inwieweit die öffentliche Berichterstattung über ein Gerichtsverfahren die Resozialisierung eines Täters beeinträchtigen kann.
- Die Rolle der Medien im Strafjustizsystem
- Die Abwägung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht
- Der Einfluss von Medienberichten auf die Resozialisierung von Straftätern
- Die Bedeutung des „Lebach-Urteils“ für die Medienlandschaft
- Die Rolle des Deutschen Presserates in der Selbstregulierung der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Das erste Urteil von 1973
Das erste Kapitel befasst sich mit dem „Lebach-Urteil“ von 1973, in dem das Bundesverfassungsgericht die Ausstrahlung eines ZDF-Dokumentarspiels über den „Soldatenmord von Lebach“ untersagte. Das Gericht argumentierte, dass die Nennung des Namens des Täters und die detaillierte Darstellung der Tat seine Resozialisierung gefährden könnten. In diesem Zusammenhang wird die Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Täters und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit beleuchtet.
1.2 Das Sendeverbot von 1996
Dieses Kapitel behandelt ein weiteres Sendeverbot, das 1996 gegen eine Dokumentation über einen anderen Kriminalfall verhängt wurde. Die Argumentation des Gerichts beruhte auch hier auf dem Schutz des Persönlichkeitsrechts des Täters und dem möglichen Schaden für seine Resozialisierung. Hier werden die Auswirkungen des „Lebach-Urteils“ auf spätere Entscheidungen im Medienrecht untersucht.
2. Richtlinien für die Zusammenarbeit von Justiz und Medien
Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Richtlinien, die für die Zusammenarbeit von Justiz und Medien aufgestellt wurden. Es werden die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren sowie die Richtlinien der Bundesländer analysiert. Das Ziel ist es, den rechtlichen Rahmen für die Berichterstattung über Gerichtsverfahren zu verdeutlichen.
3 Der Deutsche Presserat
Das letzte Kapitel behandelt den Deutschen Presserat und seine Rolle bei der Selbstregulierung der Medien. Es wird die Geschichte des Presserates sowie seine Bedeutung für die Wahrung der Pressefreiheit und die Einhaltung ethischer Standards beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Pressefreiheit, des Persönlichkeitsrechts, der Resozialisierung von Straftätern, der Medienethik und der Selbstregulierung der Medien. Weitere wichtige Begriffe sind das „Lebach-Urteil“, der Deutsche Presserat, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, die Abwägung von Grundrechten, die Medienwirkung und die Zusammenarbeit von Justiz und Medien.
- Quote paper
- MA Guido Maiwald (Author), 2004, Das Lebach-Urteil und die Zusammenarbeit von Presse und Justiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178173