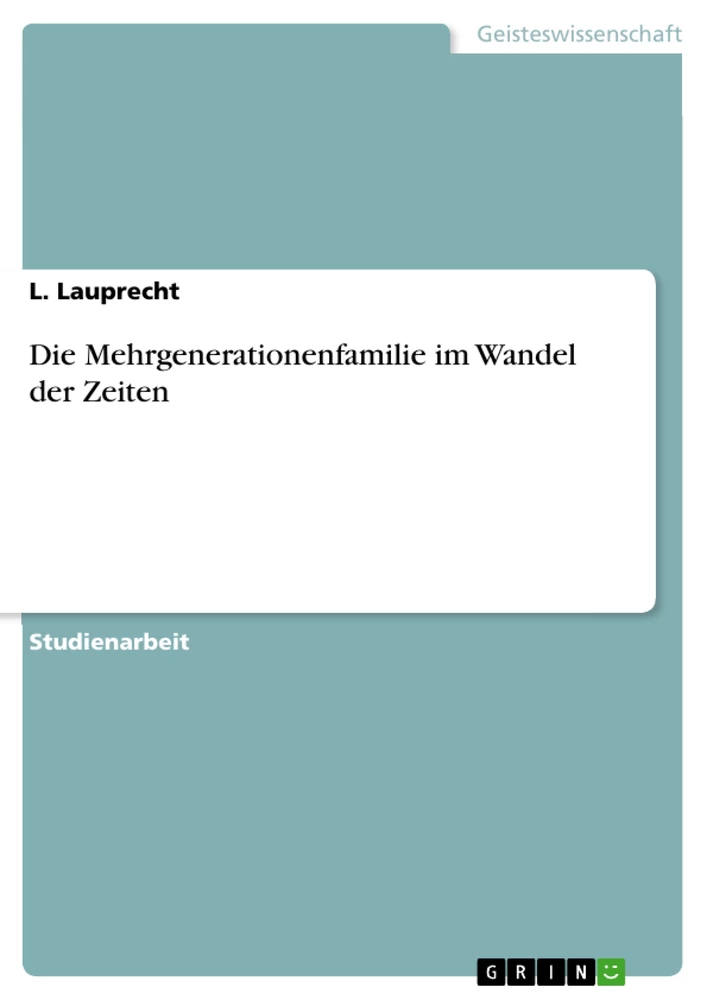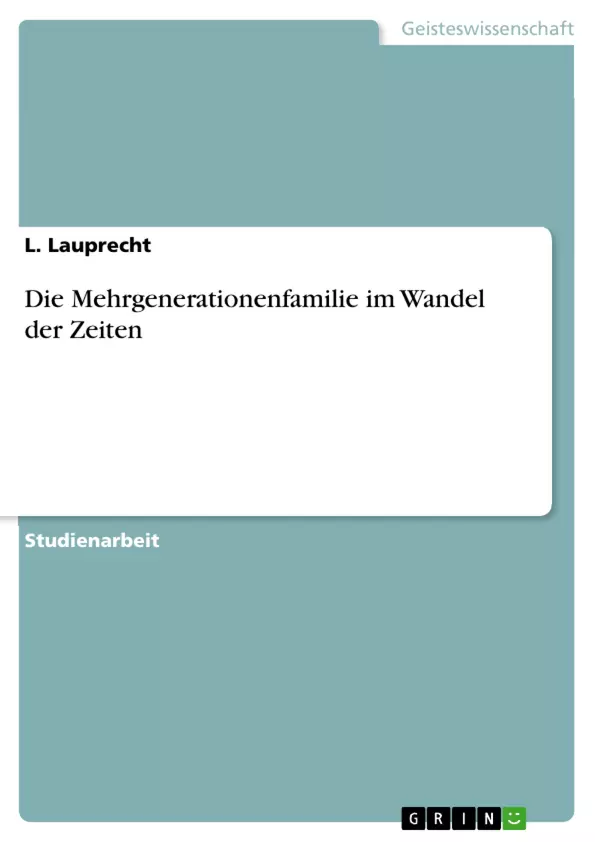Die Mehrgenerationenfamilie in ihrer Definition als „Lebensform, in der mindestens drei Generationen durch Abstammung oder Adoption in der Generationenfolge miteinander verbunden sind“ (Lauterbach & Lange 2004, S. 79) hat sich aufgrund des demografischen Wandels erst im Laufe des letzten Jahrhunderts konstituiert (vgl. Backes & Clemens 2003, S.25ff, vgl. Lauterbach & Lange 2004, S.78f, vgl. Lauterbach 2004, S.105ff).)
Obwohl man in der Literatur und in sentimentalen Vorstellungen über alte Zeiten oft auf das Modell dreier unter einem Dach lebender Generationen trifft, entsprach dies in Wirklichkeit so ganz und gar nicht der realen historischen Lebenswelt (vgl. Rosenbaum, S. 60f, 136f, 209f, 365f, vgl. Gestrich 2004, S.65ff)
Im Folgenden soll untersucht werden, wie diese Lebenswelt alter Menschen, speziell das familiäre Verhältnis der Generationen zueinander, früher tatsächlich aussah, zu welchen Veränderungen in den Familienstrukturen es im Zeitalter der Industrialisierung kommt, wie der demografische Wandel das Generationengefüge verändert und welche Konsequenzen dies auf die intergenerationalen Beziehungen in Familien heute hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert
- 2.1 Die bäuerliche Familie
- 2.2 Die Handwerkerfamilie
- 2.3 Familien in der Hausindustrie
- 2.4 Die bürgerliche Familie
- 2.5 Die proletarische Familie
- 3 Generationenbeziehungen heute
- 3.1 Vereinheitlichte Familienformen
- 3.2 Demografischer Wandel
- 3.3 Strukturwandel in den Familien
- 3.4 Lokale Strukturen der Generationenbeziehungen
- 3.5 Rollenumverteilung in der späten Familienphase
- 3.6 Intergenerationaler Austausch
- 4 Die besondere Situation der Frauen
- 4.1 Das Damoklesschwert der längeren Lebenserwartung
- 4.2 Die Tochter alternder Eltern
- 5 Theoretische Ansätze
- 5.1 Das Solidaritätsmodell
- 5.2 Ambivalenz
- 5.3 Fazit
- 6 Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Mehrgenerationenfamilie im Wandel der Zeit. Sie beleuchtet die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert, analysiert die Veränderungen in den Familienstrukturen durch die Industrialisierung und den demografischen Wandel, und untersucht die Auswirkungen auf intergenerationale Beziehungen in heutigen Familien. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Realität im Gegensatz zu romantisierten Vorstellungen.
- Die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert (bäuerliche, handwerkliche, bürgerliche und proletarische Familien)
- Der Einfluss der Industrialisierung auf Familienstrukturen
- Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf Generationenbeziehungen
- Rollenverteilung in der späten Familienphase
- Intergenerationaler Austausch in modernen Familien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung definiert die Mehrgenerationenfamilie und stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung dieser Familienform im Laufe der Zeit. Sie thematisiert den Unterschied zwischen romantisierten Vorstellungen und der historischen Realität, und kündigt die Untersuchung der Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert, den Einfluss der Industrialisierung und des demografischen Wandels sowie die Konsequenzen für heutige intergenerationale Beziehungen an.
2 Die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Lebenssituationen von Familien im 19. Jahrhundert, eingeteilt nach sozialen Schichten. Es betont das niedrige durchschnittliche Sterbealter und die damit verbundene Seltenheit von Großeltern-Enkel-Beziehungen. Es wird die traditionelle Familienform des „ganzen Hauses“ beschrieben, in der Produktion und Reproduktion untrennbar miteinander verbunden waren. Die Industrialisierung wird als Schlüsselfaktor für die Trennung von Arbeitsplatz und Haushalt und die Entstehung neuer Familienformen (bürgerlich und proletarisch) dargestellt, die als Vorläufer heutiger Familienstrukturen gesehen werden können.
2.1 Die bäuerliche Familie: Der Mythos der großen bäuerlichen Mehrgenerationenfamilie wird kritisch hinterfragt. Die Anzahl der Familienmitglieder war abhängig von der Größe und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Hofes. Das Erbrecht und die Heiratsbedingungen spielten eine entscheidende Rolle bei der Familiengröße und dem Zusammenleben von Generationen. Das Anerbenrecht und die Realteilung als Erbregelungen werden erläutert, und es wird gezeigt, wie diese die Wahrscheinlichkeit des Zusammenlebens von drei Generationen beeinflussten. Die Aspekte der materiellen und psychischen Belastungen durch das Zusammenleben werden ebenso beleuchtet wie die Strategien, die Familien entwickelten, um diese zu vermeiden. Auch der Mythos des Kinderreichtums in bäuerlichen Familien wird entkräftet.
2.2 Die Handwerkerfamilie: Ähnlich wie bei den Bauernfamilien lebten Handwerkerfamilien in produktiv-reproduktiven Einheiten. Das Zusammenleben von zwei Generationen war die Regel, da die meisten Handwerksbetriebe nicht zwei Familien ernähren konnten. Der „Wanderzwang“ der Gesellen wird als ein Faktor erwähnt, der die Verselbständigung der Handwerkersöhne begünstigte. Dreigenerationenhaushalte waren hauptsächlich in wohlhabenderen Handwerkerfamilien mit aufwendigerer technischer Ausstattung zu finden.
3 Generationenbeziehungen heute: (Kapitelzusammenfassung fehlt aufgrund der Anweisung, das letzte Kapitel und Schlussfolgerungen auszulassen)
4 Die besondere Situation der Frauen: (Kapitelzusammenfassung fehlt aufgrund der Anweisung, das letzte Kapitel und Schlussfolgerungen auszulassen)
5 Theoretische Ansätze: (Kapitelzusammenfassung fehlt aufgrund der Anweisung, das letzte Kapitel und Schlussfolgerungen auszulassen)
Schlüsselwörter
Mehrgenerationenfamilie, Familienstrukturen, Industrialisierung, Demografischer Wandel, Generationenbeziehungen, 19. Jahrhundert, Bäuerliche Familie, Handwerkerfamilie, Bürgerliche Familie, Proletarische Familie, Rollenverteilung, Intergenerationaler Austausch, Solidaritätsmodell, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Mehrgenerationenfamilie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Mehrgenerationenfamilie im Wandel der Zeit. Sie beleuchtet die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert, analysiert Veränderungen in den Familienstrukturen durch Industrialisierung und demografischen Wandel und untersucht die Auswirkungen auf intergenerationale Beziehungen in heutigen Familien. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Realität im Gegensatz zu romantisierten Vorstellungen.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet sowohl die Lebenssituation von Familien im 19. Jahrhundert als auch die Generationenbeziehungen in der Gegenwart. Der Vergleich dieser Zeiträume soll die Entwicklung der Mehrgenerationenfamilie verdeutlichen.
Welche Familienformen werden im 19. Jahrhundert betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen bäuerlichen, handwerklichen, bürgerlichen und proletarischen Familien im 19. Jahrhundert und analysiert deren jeweilige Lebenssituationen und Strukturen.
Wie werden die Familien im 19. Jahrhundert charakterisiert?
Die Beschreibung der Familien im 19. Jahrhundert betont den Unterschied zwischen romantisierten Vorstellungen und der historischen Realität. Es wird gezeigt, dass beispielsweise der Mythos der großen, harmonischen bäuerlichen Mehrgenerationenfamilie nicht der Realität entsprach. Die Familiengröße war von Faktoren wie Hofgröße, Erbrecht und Heiratsbedingungen abhängig. Auch die Arbeitsbedingungen und die materielle sowie psychische Belastung werden beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Industrialisierung?
Die Industrialisierung wird als Schlüsselfaktor für die Trennung von Arbeitsplatz und Haushalt und die Entstehung neuer Familienformen (bürgerlich und proletarisch) dargestellt. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Wandel der Familienstrukturen.
Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel?
Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Generationenbeziehungen werden ebenfalls analysiert. Dieser Aspekt ist zentral für das Verständnis der Veränderungen in modernen Familienstrukturen.
Welche Aspekte der Generationenbeziehungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rollenverteilung in der späten Familienphase und den intergenerationalen Austausch in modernen Familien. Dabei werden auch theoretische Ansätze wie das Solidaritätsmodell und die Ambivalenz in den Beziehungen betrachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Solidaritätsmodell und den Aspekt der Ambivalenz in den Beziehungen, um die Generationenbeziehungen theoretisch zu untermauern.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die bereitgestellte HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Kapitel 1 und 2, sowie der Unterkapitel 2.1 und 2.2. Die Kapitel 3, 4 und 5 enthalten, aufgrund der Anweisungen, keine Kapitelzusammenfassungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mehrgenerationenfamilie, Familienstrukturen, Industrialisierung, Demografischer Wandel, Generationenbeziehungen, 19. Jahrhundert, Bäuerliche Familie, Handwerkerfamilie, Bürgerliche Familie, Proletarische Familie, Rollenverteilung, Intergenerationaler Austausch, Solidaritätsmodell, Ambivalenz.
- Arbeit zitieren
- BA Soziale Arbeit L. Lauprecht (Autor:in), 2007, Die Mehrgenerationenfamilie im Wandel der Zeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178108