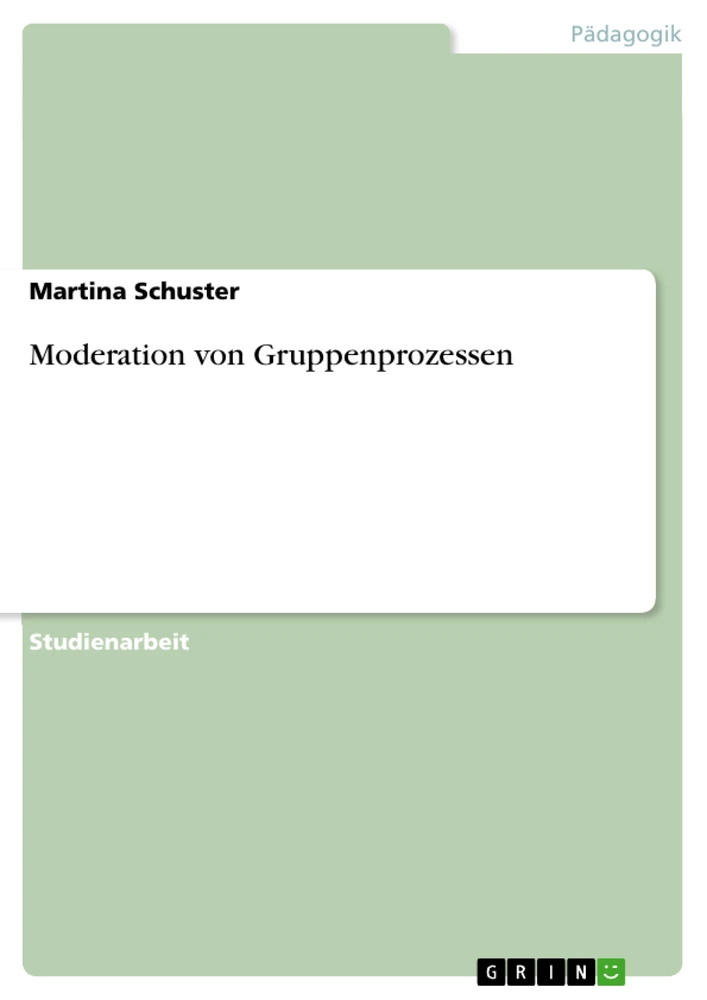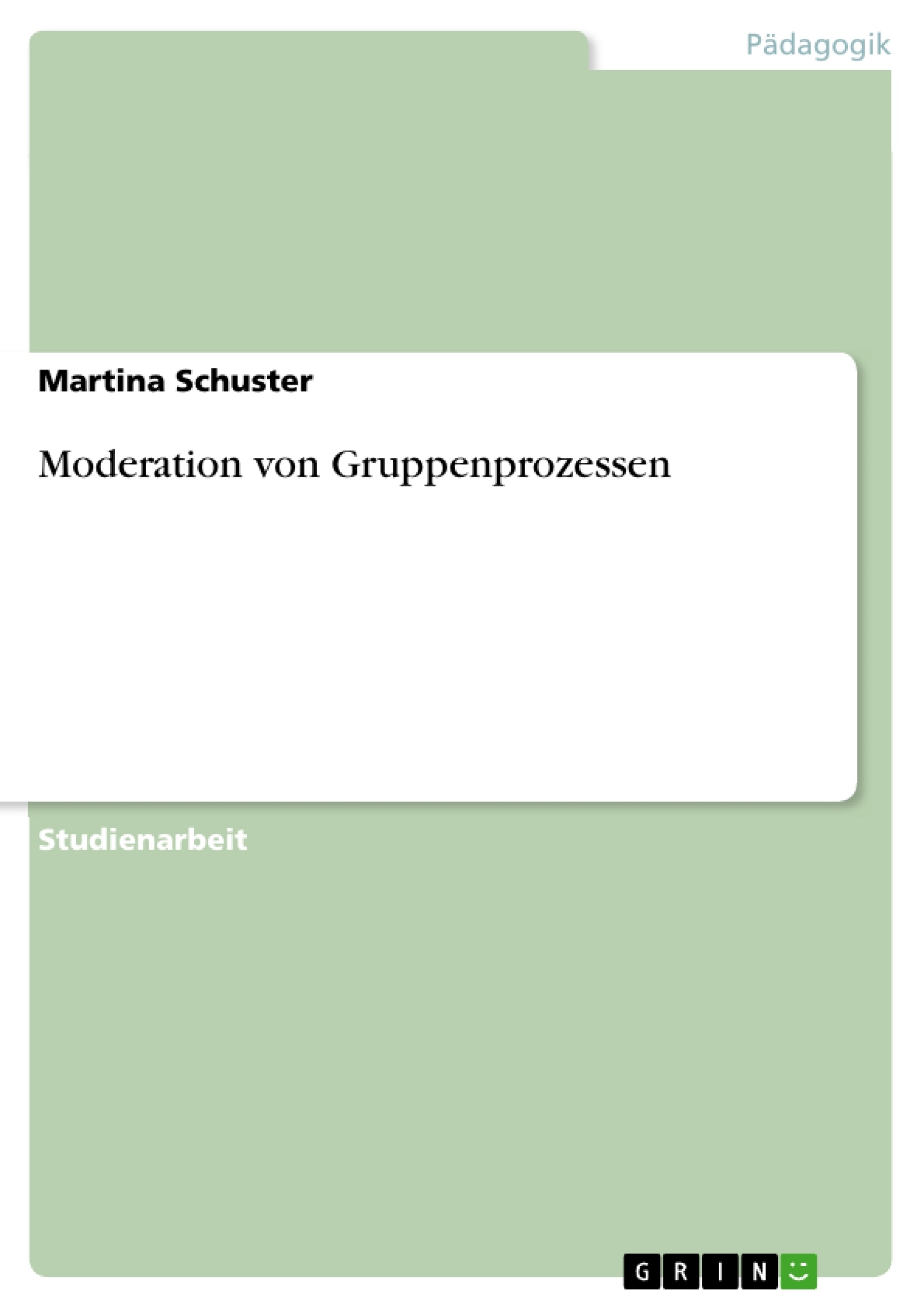Moderation hat längst im Bereich der Führung von Mitarbeitern Einzug genommen . Assoziierte man früher mit dem Begriff „Moderation“ den Einsatz von Moderationskärtchen und Metaplan-Tafeln, zeigt die aktuelle Literatur heute, dass Moderieren weit über eine „Kärtchen-Abfrage“ hinaus geht. Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, sowie „Modernisierungs- und Demokratisierungsentwicklungen unserer Arbeitswelt “ stehen Führungskräfte von heute und morgen vor der Herausforderung, ihre Teams in der Rolle eines Moderators voranzubringen. Menschen allgemein und folglich auch Mitarbeiter möchten bei Entscheidungen nicht nur beteiligt werden, sie fordern auch Mitbestimmung . Mehr als das. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen schon lange, dass Teams mehr leisten können als die Summe ihrer Individuen, vorausgesetzt, konstruktive Rahmenbedingungen sind gegeben. Aus dieser Be-schreibung lässt sich ableiten, dass die klassischen Führungsaufgaben (siehe Kapitel 3.1) durch neue Kompetenzen ergänzt werden müssen. Gemeint ist hier die soge-nannte „Prozesskompetenz“, die unter Zeiteinsparung und unter Beteiligung aller Teammitglieder das bestmögliche Ergebnis und Konsens herbei führen soll. Unter Prozesskompetenz versteht man „die Kunst, zwischenmenschliche Interaktion möglichst reibungslos zu steuern und auf ein gewünschtes Ergebnis auszurichten“. Betrachtet man die Leistungsfähigkeit von Teams und deren Bedeutung für den Fort-schritt von Organisationen, kann man durchaus den hier genannten Autoren zustimmen und die Prozesskompetenz als notwendige Basiskompetenz für Führungskräfte verstehen.
Die vorliegende Arbeit möchte ein Verständnis für die Rolle eines Moderators in Anknüpfung an die Rolle einer Führungskraft vermitteln. Dabei werden die jeweiligen Charakteristika der Rollen aufgezeigt und Rückschlüsse für die Haltung von Führungskräften gezogen. Im Anschluss folgen Ansätze, mit dieser Rollenkonstella-tion konstruktiv umzugehen. Da im Alltag einer Führungskraft durchaus Situationen auftreten, in denen der Moderation Grenzen gesetzt sind, werden Kriterien dargestellt, die die Beteiligung einer externen Moderation befürworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Moderation
- 3. Abgrenzung im Rollenverständnis von Führungskraft und Moderator
- 3.1 Die Rolle der Führungskraft
- 3.2 Die Rolle des Moderators
- 4. Konsequenzen für die Führungskraft als Moderator
- 5. Umgang mit der Rollenkonstellation
- 6. Kriterien für den Einsatz externer Moderatoren
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des Moderators im Kontext der Führung von Mitarbeitern. Sie will ein Verständnis für die jeweiligen Rollencharakteristika vermitteln und aufzeigen, wie Führungskräfte die Rolle des Moderators sinnvoll in ihre Führungsarbeit integrieren können. Darüber hinaus werden Ansätze zur konstruktiven Bewältigung der Rollenkonstellation vorgestellt und Kriterien für den Einsatz externer Moderatoren aufgezeigt.
- Die Rolle der Führungskraft im Wandel
- Die Rolle des Moderators als Prozesskompetenz
- Abgrenzung und Schnittmengen zwischen Führung und Moderation
- Konsequenzen für die Führungskraft als Moderator
- Einsatz externer Moderatoren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: In der Einleitung wird die Relevanz von Moderation im Kontext der Führung von Mitarbeitern herausgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit von Prozesskompetenz und den Wandel in den Aufgaben und Erwartungen an Führungskräfte.
- Kapitel 2: Zur Moderation: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Moderation und erläutert ihre Funktion als Technik zur Unterstützung von Gruppenentscheidungen und - problemlösungen. Es werden verschiedene Anwendungsfelder und die Bedeutung der Moderation für die Effizienz und Qualität von Gruppenarbeiten hervorgehoben.
- Kapitel 3: Abgrenzungen im Rollenverständnis von Führungskraft und Moderator: In diesem Kapitel werden die traditionellen und aktuellen Rollenverständnis von Führungskraft und Moderator gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass die Führungsrolle zunehmend auch Moderationskompetenz erfordert.
- Kapitel 3.1: Die Rolle der Führungskraft: Dieses Unterkapitel beleuchtet die traditionellen und modernen Aspekte der Führungsrolle. Es werden verschiedene Funktionen und Aufgaben der Führungskraft, wie beispielsweise die Zielsetzung, Strategieentwicklung, Mitarbeiterentwicklung und Unterstützung, dargestellt.
- Kapitel 3.2: Die Rolle des Moderators: Hier wird die Rolle des Moderators als Prozessgestalter und -moderator vorgestellt. Es werden die zentralen Aufgaben des Moderators, wie beispielsweise die Steuerung von Interaktionen, die Förderung von Beteiligung und die Erleichterung von Konsensfindung, erklärt.
- Kapitel 4: Konsequenzen für die Führungskraft als Moderator: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen, die sich aus der Integration von Moderationskompetenz in die Führungsrolle ergeben. Es werden die spezifischen Fähigkeiten und Haltungen aufgezeigt, die eine Führungskraft benötigt, um als effektiver Moderator zu agieren.
- Kapitel 5: Umgang mit der Rollenkonstellation: Dieses Kapitel liefert praktische Ansätze für den konstruktiven Umgang mit der Rollenkonstellation von Führungskraft und Moderator. Es werden Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen und Spannungsfeldern zwischen den beiden Rollen präsentiert.
- Kapitel 6: Kriterien für den Einsatz externer Moderatoren: In diesem Kapitel werden Kriterien für den Einsatz externer Moderatoren vorgestellt. Es werden Situationen und Faktoren beschrieben, in denen der Einsatz eines externen Moderators sinnvoll und notwendig ist.
Schlüsselwörter
Moderation, Führungskompetenz, Prozesskompetenz, Rollenverständnis, Führungsrolle, Mitarbeitermotivation, Teamleistung, Gruppenentscheidung, Gruppenarbeit, Konsensfindung, Externe Moderation, Moderationsmethoden, Führungsstil, Verantwortungsbereiche, Arbeitswelt, Effizienz, Qualität, Identifikation, partizipative Führung
- Quote paper
- Martina Schuster (Author), 2011, Moderation von Gruppenprozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178067