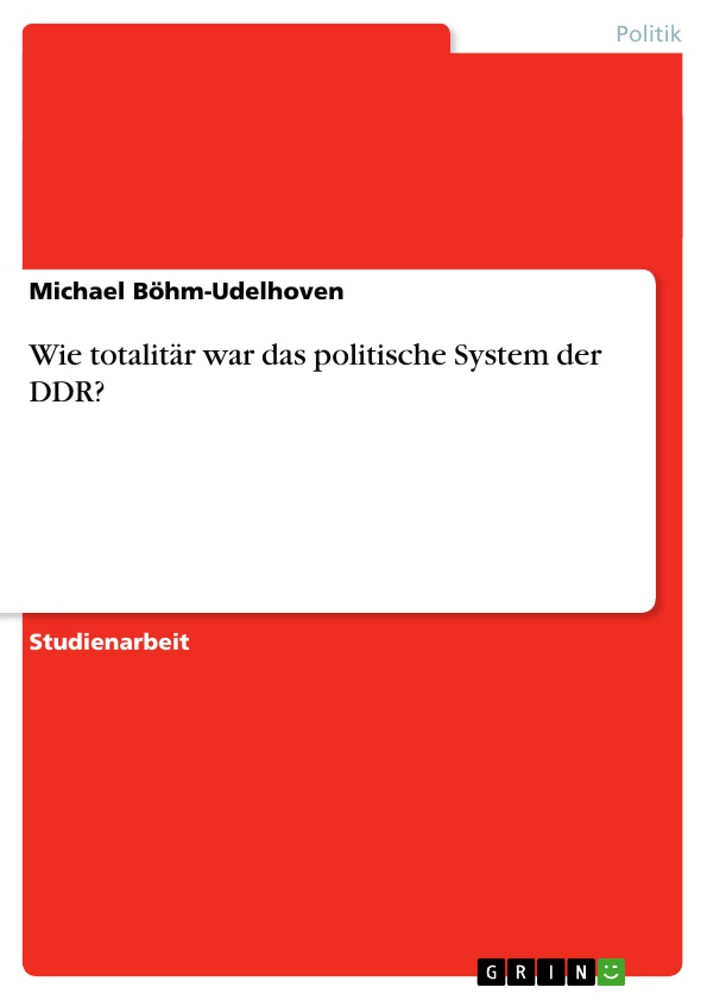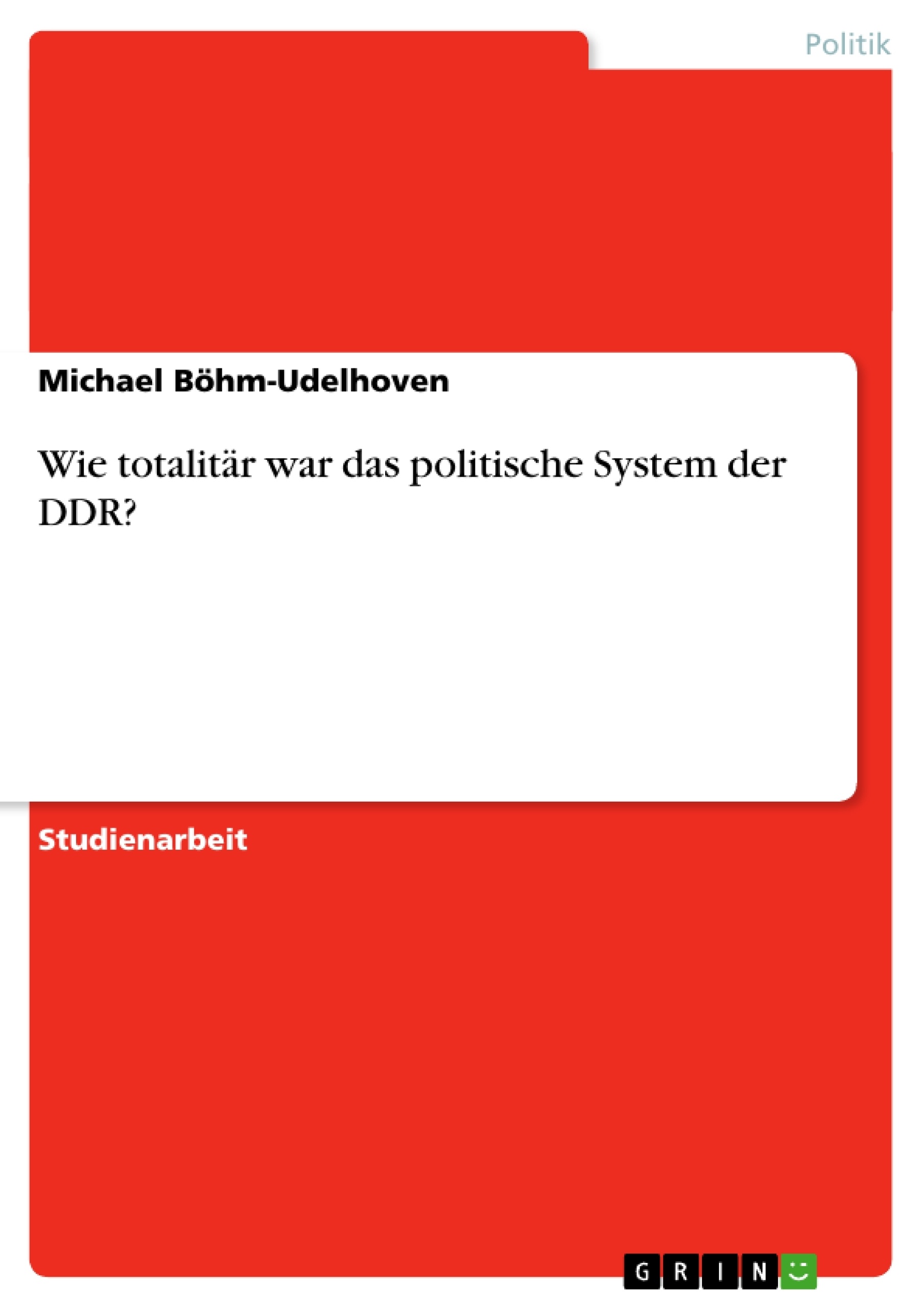Die Hausarbeit versucht an der Historie der DDR bei nur sehr exemplarischer Untersuchung die eingeschränkte Verwendbarkeit/Brauchbarkeit der Totalitarismus-Lehre aufzuzeigen.
Wie sich in dieser Arbeit anhand zwei gesellschaftspolitischer Bereiche bei einer begrenzten zeitgeschichtlichen Betrachtung (so auf die Spätrepublik in den 70er und 80er Jahre) gezeigt hat, war das DDR System nicht in allen Bereichen durch Parteiherrschaft und kommunistischer Ideologie total, bzw. umfassend beherrscht und durchdrungen.
Als Resultat kann trotz aller Kritik die Totalitarismus-Lehre und ihre Modelle nicht gänzlich abgeschwächt oder gar abgelehnt werden. Sie kann sicherlich dazu beitragen, für totalitäre Gefährdungen und Versuchungen auch in liberal-demokratischen Systemen zu sensibilisieren. Als Beispiel seien die beobachtbaren Tendenzen zur Massengesellschaft (Massenkommunikation, etc.), die eine ganzheitliche und umfassende Erfassung und Kontrolle der Menschen ermöglichen. Diese möglichen Konsequenzen und Gefahren des Technologisierungsprozesses in den heutigen westlichen Staaten bedürfen daher der Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft.
Inhalt:
Vorwort
Einleitung
1. Totalitarismus als eine Form politischer Systeme/ Begriffsbestimmung
1.1 Totalitarismus-Modelle/ Historischer Abriss der Totalitarismus-Lehre
1.2 Definition/ Begriffsbestimmung nach Friedrich
1.3 Diskussion der Definition
2. Beschreibung des politischen Systems der DDR/ Prüfung der Anwendbarkeit des Totalitarismus-Modells unter dem Gesichtspunkt des „Merkmals“ des Durchdringens
2.1 Skizzierung des politischen Systems der DDR
2.2 Diskussion/ Anwendbarkeit des Totalitarismus-Begriffes
2.2.1 Die Staatspartei SED
2.2.2 Der gesellschaftliche Bereich der Institution der (evangelischen) Kirche
2.3 Diskussion/ Ergebnis
3. Resümee/ Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort:
Die vorliegende Hausarbeit wurde im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaften an der Fernuniversität Hagen erstellt. Die Arbeit wurde vom damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Dozenten im Teilgebiet Politische Systeme im Vergleich des Institutes für Politikwissenschaft, Herrn Dr. Martin List, betreut und begutachtet.
Die Analyse diente zur Erlangung eines Leistungsscheines für das Grundstudium und geht zurück auf eine Präsenzveranstaltung „Vergleichende Analyse von Diktatur und Völkermord“ vom 18. - 20.06.1999 in Hamburg bzw. bezieht sich auf den Studienkurs Nr. 04659 - Vergleichende Regierungslehre. Die Literaturrecherche berücksichtigt den Publikationsstand bis zum Jahr 1998. Die Arbeit wurde im Oktober/ November 1999 gefertigt. Sie genügte in ihrer Qualität den Ansprüchen einer Studienleistung.
Nachfolgend wird die Hausarbeit in ihrer inhaltlichen Ursprungsfassung wiedergegeben und Interessierten zum wissenschaftlichen Gebrauch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Mainz, August 2011
Michael Böhm-Udelhoven, M.A.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe und mit Genehmigung des Verfassers.
Kontakt:
Michael Böhm-Udelhoven
Mail to: Michael.Boehm-Udelhoven@t-online.de
Zehn Jahre ist es mittlerweile her, daß mit dem Mauerfall 1989 die jahrzehntelange Lagerkonstellation zwischen dem liberal-demokratischen „Weststaaten“ und den sozialistischen „Oststaaten“ „aufweichte“ und die Jahrzehnte des Kalten Krieges ihr Ende nahmen.
Diese Konfrontation der Ost-West-Machtblöcke wurde historisch nirgends deutlicher und erlebnisnaher als in der Teilung Deutschlands. Der Existenz eines parlamentarischen, freiheitlich, föderalistischen Verfassungsstaates, die Bundesrepublik Deutschland im Westen und einer zentralistischen Diktatur, sich selbst offiziell als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern1 bezeichnend, die Deutsche Demokratische Republik im Osten. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands, zurzeit in Zeitschriften und Zeitungen intensiv thematisiert, ging die Epoche des Kalten Krieges ihrem Ende zu.
Die Teilung Deutschlands, bzw. exakter die machtpolitische Konfrontation zwischen den pluralistisch geprägten Westen und den sozialistischen Osten hatten entscheidenden Einfluß auf die politische Entwicklung und Diskussion der Totalitarismus-Lehre, auf deren Befürworter und Gegner.
So wurde die ideologische Eingespanntheit für den Kalten Krieg (insbesondere in der mit den 60er Jahre beginnenden Entspannungspolitik) stets als Kritik und Angriffspunkt von Gegnern der Lehre geäußert2. Nicht selten rekrutierten sich die Befürworter und maßgeblichen Vertreter der Totalitarismus-Lehre aus emigrierten Systemopfern des Faschismus und Kommunismus.
Die politische Lehre des Totalitarismus war somit nie emotionslos. Die Ursprünge so mancher Argumentation könnte sicherlich bei Vertretern wie Gegnern in einer persönlichen Betroffenheit und der eigenen Lebensgeschichte vorgefunden werden.
Nicht verwunderlich erscheint es daher, daß maßgeblich (teils emigrierte) deutsche Wissenschaftler, wie Arendt, Friedrich u.a. diese Lehre entwickelten und nachhaltend prägten, die Lehre aber mit der beginnenden Entspannungspolitik in den 60er Jahre auch wiederum maßgeblich von deutschen Wissenschaftler, wie Ludz, Jesse, Meyer, Glaeßner u.a. im Rahmen der DDR- und Kommunismus-Forschung modifiziert und relativiert worden ist. Insbesondere den Deutschen scheint es die Totalitarismus-Theorie angetan zu haben, dient sie letztlich doch der Vergangenheitsbewältigung der Epoche des Dritten Reiches unter Hitler - die wohl mit am menschenverachtendste Ausprägung eines totalitären Systems - wie aber auch der 40 Jahre DDR-Geschichte, eine „sanftere“ Ausprägung einer Diktatur, die sicherlich Epochenweise oder strukturell als totalitär eingestuft werden kann - als Stichwort sei nur auf den Apparat der Staatssicherheit verwiesen.
In der Abgrenzung sieht man das Eigene besser. So verbindet die Totalitarismus-Forschung in all ihren Facetten doch in der Analyse und Beurteilung totalitärer Systeme letztlich auch das Plädoyer, sich für den liberalen, demokratischen Verfassungsstaat einzutreten3. Auch wenn letzterer Mängel aufweist; aber, wie Churchill es sinngemäß äußerte, die Demokratie eine schlechte Herrschaftsform sei, er aber keine bessere kenne.
Mit dem historischen Überwinden des Zeitalter des Kalten Krieges, kehrte auch eine Entideologisierung der Politik/ bzw. des politischen Denkens ein, was ermöglichen könnte, zukünftig politische Phänomene - wie eben die des Totalitarismus - wahrhaft neutral wissenschaftlich zu betrachten und diskutieren zu können.
Einleitung:
„Die Auseinandersetzung vom Begriff und Wirklichkeit des Totalitarismus gehört zu den großen umstrittenen Themen des zwanzigsten Jahrhunderts“1
In der Politikwissenschaft unterscheidet man politische Systeme der neuzeitlichen Staatlichkeit zwischen (liberal) demokratischen Systemen mit den charakteristischen Merkmalen der Selbstbindung der Herrschaftsgewalt, der Rechtstaatlichkeit sowie der Legitimation der Macht durch den Willen des Volkes (u.a.). Zum anderen in nichtdemokratischen Systemen/Diktaturen mit den Merkmalen der Willkür der Macht (fehlende Selbstbindung), der Monopolisierung von (unbeschränkter) Macht auf Einzelne, bzw. auf bestimmte Gruppen, der mangelnden Legitimation durch das Volk (u.a.).
Neuzeitliche Formen von Diktaturen werden vorwiegend als autoritäre oder totalitäre Systeme bezeichnet. Insbesondere totalitäre Systeme können hierbei als Phänomen der Neuzeit betrachtet werden, wurden sie erst durch die technischen und gesellschaftlichen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts ermöglicht.
Das anfängliche Zitat aufgreifend, wird sich diese Arbeit mit dem Totalitarismusbegriff am Beispiel des politischen Systems der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auseinandersetzen. Diskutiert soll hierbei werden, ob und inwieweit das politische System der DDR als totalitär bezeichnet werden kann.
Es soll exemplarisch daran, daß in der DDR ein Wandel im System stattfand, welcher sich auch innerhalb der staatstragenden Partei SED entfaltete und dieser ihren monolithischen Charakter bei dem Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß und in weiterer Folge bei der Herrschaftsausübung im Laufe der Zeit nahm, sowie daß am Beispiel der Stellung der evangelische Kirche weiterhin gewisse gesellschaftliche Freiräume, bzw. Nischen entstanden, die relativ frei und geschützt vor staatlichen Einfluß waren und sich in diesen „ideologiefreie“ Bereiche bildeten, aufgezeigt werden, daß die Totalität des DDR-System sich im Laufe der Jahre wie auch strukturell in Teilen auflockerte, bzw. auflöste. Die DDR also nicht mehr, bzw. nur noch mehr oder minder als totalitär bezeichnet werden kann.
Die Arbeit soll daneben anhand des politischen System der DDR aufzeigen, dass mit dem Totalitarismus-Modell (bzw. -begriff) nur schwer alle Aspekte eines spezifischen Staatssystems beschrieben und eingestuft werden können.
Michael Böhm-Udelhoven: Wie totalitär war das politische System der DDR? Hauptteil
1. Totalitarismus als eine Form politischer Systeme / Begriffsbestimmung
1.1. Totalitarismus-Modelle/Historischer Abriss der Totalitarismus-Lehre
Der Begriff Totalitarismus wird in der (Vergleichenden) Politikwissenschaft als Bezeichnung für jene politische Systeme verwandt, die durch eine umfassende, unbeschränkte und monopolisierte (eben totale) Herrschaftsstruktur charakterisiert sind, wobei die Herrschaftsausübung alle Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens umfaßt.
Totalitäre System werden als moderne staatliche Erscheinungsform gesehen, die sich vom liberal-demokratischen Verfassungsstaat, weiter von autoritären Diktaturen und früheren Formen der Autokratie (wie bspw. der Tyrannei) abheben. Sie werden als neue und einzigartige Systeme beschrieben. Als totalitär gelten jene politischen Systeme, die den Bürger durch eine Ideologie zu formen, durch Kontrolle und Zwang zu erfassen suchen und gleichzeitig mobilisieren wollen.2
Die Totalitarismus-Lehre war von Anfang an kontroversen Diskussionen ausgesetzt. Es zeigt sich bei ihrer geschichtlichen Entwicklung eine starke zeithistorische Einflußnahme. So bestand bei der Totalitarismus-Forschung eine wesentliche Intention in der Verteidigung der parlamentarischen (westlichen) Demokratie. „Diese politische [..] Zielsetzung gegen den antidemokratischen Kommunismus und Faschismus/Nationalsozialismus hat auch die Totalitarismus-Forschung nie ganz verloren“.3 Ein nicht unerheblicher Kritikpunkt der Gegner der Lehre war daher stets seine Verwendung als „politischen Kampfbegriff“ neben der des Erklärungswissenschaftlichen.4
Im Laufe der Jahre wurden eine Vielzahl von Theorieansätze und Modelle vom Totalitarismus entwickelt, von denen im Folgenden exemplarisch nur die grundlegenden angeführt werden können.
Historisch betrachtet wurde der Begriff totalitär durch den Liberalen Giovanni Amendola 1923 erstmals geprägt, der mit diesen Begriff den italienischen Faschismus anzuprangern beabsichtigte. Mussolini beschrieb 1925 das Wesen und Ziel des neuen „stato totalitorio“ als „Alles für den Staat, nichts außerhalb des Staates, nichts gegen den Staat“.5
Dieser „totale Staat“ wurde von seinen Gegnern als Negation des liberalen, demokratischen Verfassungsstaates gesehen, eben als antidemokratisch, pseudodemokratisch und postdemokratisch zugleich. Antidemokratisch, weil er die demokratischen Elemente, wie den Pluralismus ablehnt; pseudodemokratisch, weil er schon Elemente der Demokratie in pervertierter Form, so die Einbeziehung der Massen, benutzt und letztlich postdemokratisch, da er sich nach außen auf die Legitimationsbasis des demokratischen Staates, der Volkssouveränität, beruft.6
Als totalitär wurden die in dieser Zeitepoche sich im Entwicklungsprozeß befindlichen neuartigen Systeme des Faschismus in Italien und später in Deutschland sowie des Bolschewismus in Rußland bezeichnet. Anfangs noch getrennt betrachtet, wurden in den 20er und 30er Jahren die Ähnlichkeiten beider Systemformen aufgewiesen und diese in Folge gleichgesetzt. Der Totalitarismusbegriff ist „bei der Analyse faschistischer/nationalistischer und kommunistischer Systeme entwickelt worden [...] und im wesentlichen auf diese Herrschaftsformen beschränkt geblieben.“7
Bis in die 50er Jahre hinein wurde quasi die Grundlage - die klassische Totalitarismus-Lehre - entwickelt. Im Vordergrund stand die systematische Erforschung faschistischer und sozialistischer Systeme. Ein erstes grundlegendes Modell von dem Sozialwissenschaftler C.J.H. Hayes prägte das erste wissenschaftliche Symposium über den Stand der Totalitarismus-Forschung im November 19398. Hayes führte Totalitarismus im Wesentlichen auf die Monopolisierung aller Gewalt, der Eigendynamik der Gewalt sowie der Nutzung von Massenbeinflußung (letztere wurde ja erst in diesem Jahrhundert durch neue Technologien überhaupt ermöglicht) zurück. Für die Weiterentwicklung der Lehre in den 40er Jahre seien stellvertretend die Wissenschaftler Franz und Sigmund Neumann aufgeführt, die sich bestrebten, totalitäre Strukturmerkmale, wie die der Ideologie, in ihren Ursprüngen auf autoritäre Regime zurückzuführen.
Unter dem Eindruck der wohl maßgeblich am nachhaltigsten negative Ausprägung dieser Systeme in der systematischen Begehung von staatlichen Gewaltverbrechen, wie dem Holocaust, entwickelte die Philosophin Hannah Arendt einen geschichts-philosophischen Ansatz, der das Wesentliche der totalitären Herrschaft in der Verbindung von Ideologie und Terror (als Hauptcharakteristika) sieht.
Geprägt durch den „Kalten Krieg“/den beginnenden Ost-West-Konflikt entwickelten Carl. J. Friedrich und Zbingniew K. Brzezinski das wohl grundlegendste Modell9, welches die klassische Totalitarismus-Lehre entscheidend und nachhaltig prägte. Beide betonten den einzigartigen Charakter des totalen Staates („sui generis“); sie setzten den Kommunismus und Faschismus in ihren Grundzügen gleich. In ihrem herrschaftsstrukturellen Ansatz10 versuchten sie ein Idealtyp zu konstruieren, welchen sie mit einem 6-Punkte-Syndrom zu erfassen versuchten. Diese „Definition“ erlangte eine bahnbrechende und grundlegende Bedeutung in der Totalitarismus-Forschung.11 Die weitere Totalitarismus-Forschung stand vor allem unter dem Zeichen dieser idealtypischen Theorie.12
Auf Systemvergleich angelegt, eignete sich die klassischen Totalitarismus-Modelle aber nicht, bzw. nur eingeschränkt, die in den Folgejahrzehnten sich entwickelnden unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen der sozialistischen Länder Osteuropas wie auch den mit der Entspannungspolitik in den 60er Jahre eintretenden gesellschaftlichen und sozioökonomischen Wandel in diesen Ländern zu erklären.
Eine kritische Beschäftigung mit diesen Veränderungen unter Verwendung anderer Ansätze, wie etwa die systemimmanente Analyse der DDR durch P.C. Ludz führten zum Schluß, daß die kommunistische Industriegesellschaft eher zu einer autoritären als zu einer totalitären Verfassung tendiere (konsultativer Autoritarismus), das klassische Totalitarismus-Modell also allenfalls für die stalinistische Epoche Anwendung fände13.
Es wurden weitere Modifizierungen der Totalitarismus-Lehre entwickelt, stellvertretend seien G. Meyer, E. Jesse und Peter Graf v. Kielmansegg genant. Auch bei weiteren Studien des Nationalismus/Faschismus zeigt sich ein eingeschränkter Erklärungswert des klassischen Totalitarismus-Modells auf.14
Eine gewisse Renaissance trat für die Totalitarismus-Forschung in den 80er und 90er Jahre mit einer erneuten Verhärtung der Fronten im Ost-West-Konflikt und der Reformunfähigkeit der sozialistischen Systeme, wie den späteren Zusammenbruch des „Ostens“ ein.
Die Totalitarismus-Lehre mit ihren Modellen wurde stets kontrovers diskutiert.
War sie anfangs unter den engen Bezug zur stalinistischen und nationalsozialistischen Epoche entwickelt worden und lieferte die klassische Totalitarismus-Forschung auch einen bedeutenden Beitrag zur Beschreibung des Hitler-Faschismus und des Stalinismus, so zeigte diese einen eingeschränkten Erklärungswert für die Beschreibung des späteren Wandels in den sozialistischen Ländern in der Nachkriegszeit. Die Lehre ist stets weiterentwickelt worden, Modelle wurden neu entwickelt oder modifiziert. So dürfte nicht zu verkennen sein, dass die (klassische) Totalitarismus-Lehre wie ihre späteren Modifizierungsmodelle die Kommunismus- und Faschismusforschung wesentlich prägten und auch derzeit einen entsprechenden Stellenwert in der Transitions-Forschung einnimmt.
1.2. Definition / Begriffsbestimmung nach Friedrich
Wie bereits schon beim Vorkapitel erwähnt, wurden verschiedenartige TotalitarismusAnsätze, bzw. -Modelle entwickelt, so zahlreich und verschieden, daß man nicht generell von „dem“ Totalitarismus-Modell sprechen könnte.
Zu den bahnbrechenden und wohl am nachhaltig prägendsten Modell dürfte aber sicherlich die Studien von Friedrich und Brzezinski gezählt werden.15
Anhand von Untersuchungen des faschistischen wie bolschewistischen Herrschaftssystems auf Grundlage einer Analyse von Tatsachenmaterial wiesen Friedrich und Brzezinski zum einen Gemeinsamkeiten in der Herrschaftsstruktur beider Systeme auf und versuchten zum anderen, diese Systeme von allen anderen Herrschaftsformen zu unterscheiden. Sie zeigten die Neuartigkeit dieser Systeme auf, so daß diese in ihrer Erscheinungsform als „sui generis“ aufgefaßt wurden.
Aus der vergleichenden Untersuchung entwickelten sie ein allgemeines TotalitarismusModell, ein Idealtypus, der durch folgende sechs Charakteristika erfasst werden kann16. Dieser Definitionsversuch wird in der Literatur gängig als Sechspunkte-Syndrom bezeichnet. Es begründete u.a. die klassische Totalitarismus-Lehre und prägte nachhaltig die Totalitarismus-Forschung.
Nach Friedrich und Brzenzinski zeichnen totalitäre Systeme aus:
1. Eine alle lebenswichtigen Aspekte der menschlichen Existenz umfassende und auf einen idealen Endzustand ausgerichtete Ideologie, an der sich alle in dieser Gesellschaft Lebende zu halten haben.
2. Eine einzige, straff und hierarchisch organisierte, typischerweise von einem „Führer“ geführte und aus einem niedrigen Anteil der Bevölkerung bestehende Massenpartei, die der Staatsbürokratie übergeordnet oder völlig mit dieser verflochten ist.
3. Ein auf physischer und psychischer Grundlage betriebenes, durch eine Partei- oder Geheimpolizei unter Kontrolle der Partei durchgeführtes Terrorsystem, das mehr oder minder willkürlich nicht nur gegen „Feinde“ des Systems sondern auch andere ausgesuchte Bevölkerungsgruppen betrieben wird, unter Ausnutzung moderner psychologischer Erkenntnisse.
4. Ein nahezu technologisch bedingtes, vollständiges Monopol der Kontrolle und Mittel der Massenkommunikation in den Händen von Partei und Staat (Nachrichtenmonopol).
5. Gleichermaßen ein Monopol aller Kampfwaffen (Waffenmonopol).
6. Und schließlich eine zentrale, bürokratische Überwachung und Lenkung der gesamten Wirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft).17
[...]
1 Vgl. VERFASSUNG DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, Artikel 1
2 In der sozialistischen Wissenschaft wurde daher die Lehre stets als Doktrin bezeichnet
3 Vgl. JESSE, 1994
1 MARQUARDT, 1991, S. 4
2 Vgl. JESSE, 1997, S. 254 als Vorschlag einer allgemeinen Definition, die von den meisten Theoretikern der Totalitarismus-Lehre gedeckt werden dürfte.
3 WIPPERMANN, S. 708
4 Insbesondere mit der in den 60er Jahren einleitenden Entspannungspolitik wurden Befürworter der Lehre häufig als Vertreter des „Kalten Krieges“ bezeichnet.
5 Vgl. WIPPERMANN,, S. 708
6 Vgl. JESSE, 1998, S. 4
7 JENKNER, S. 521
8 Das Symposium stand unter den Eindruck der Unterzeichnung des Nichtangriff-Pakts zwischen Hitler und Stalin vom 23.08.1939.
9 Vorgestellt auf dem zweiten Symposium 1953
10 Unter der Mitarbeit von Zbingniew K. Brzezinski entwickelt, welcher daher in der einschlägigen Literatur stets zusammen mit Friedrich genannt wird.
11 Das 6-Punkte-Syndrom wird im folgenden Kapitel 1.2. näher erörtert und diskutiert.
12 Vgl. WIPPERMANN, S. 708 ff.
13 Wird unter Kapitel 2.2.1 detailliert angesprochen.
14 Siehe beispielsweise die Studie von Greiffenhagen zum Nationalsozialistischen Herrschaftssystem, u.a.
15 So werden diese Studien auch oft als Klassiker der Totalitarismus-Lehre bezeichnet, vgl. u.a. JESSE, 1998.
16 Diese einzelnen Merkmale, untereinander in wechselseitiger Beziehung stehend, müssen demnach kumulativ vorliegen, um ein System als totalitär zu kennzeichnen und von anderen Herrschaftsformen abzugrenzen. Interessant ist, daß 4 von den Merkmalen technologisch bedingt sind, was das totalitäre System auch von früheren Diktaturen unterscheidet.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse des politischen Systems der DDR
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das politische System der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Kontext der Totalitarismus-Lehre. Sie untersucht, ob und inwieweit das politische System der DDR als totalitär bezeichnet werden kann. Die Arbeit wurde im Rahmen eines Studiums der Politikwissenschaften an der Fernuniversität Hagen erstellt.
Wer hat die Arbeit verfasst und wann?
Die Arbeit wurde von Michael Böhm-Udelhoven im Oktober/November 1999 verfasst und von Dr. Martin List betreut und begutachtet. Die Literaturrecherche berücksichtigt den Publikationsstand bis zum Jahr 1998.
Wo finde ich die Kontaktdaten des Verfassers?
Die Kontaktdaten des Verfassers, Michael Böhm-Udelhoven, sind in der Vorwort enthalten. Eine E-Mail Adresse Michael.Boehm-Udelhoven@t-online.de ist angegeben.
Was sind die Hauptpunkte der Einleitung?
Die Einleitung umreißt die Kontroverse um den Totalitarismusbegriff und seine Anwendung auf das politische System der DDR. Sie diskutiert die Unterschiede zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Systemen und stellt die These auf, dass die Totalität des DDR-Systems sich im Laufe der Jahre auflockerte. Außerdem wird der kritische Hinweis auf die Schwierigkeit, alle Aspekte eines Staatssystems durch das Totalitarismus-Modell zu beschreiben, thematisiert.
Was sind die Kernpunkte der Totalitarismus-Lehre laut Friedrich und Brzezinski?
Friedrich und Brzezinski identifizierten sechs Charakteristika totalitärer Systeme (Sechspunkte-Syndrom): eine umfassende Ideologie, eine straff organisierte Massenpartei, ein Terrorsystem, ein Nachrichtenmonopol, ein Waffenmonopol und eine zentrale Lenkung der Wirtschaft. Die Arbeit diskutiert die Definition, Begriffsbestimmung nach Friedrich und Brzezinski.
Welche Kritik gibt es am Totalitarismus-Modell?
Die Totalitarismus-Lehre wurde kritisiert für ihre zeithistorische Einflußnahme, ihre Verwendung als politischer Kampfbegriff und ihre begrenzte Anwendbarkeit auf die komplexen Realitäten verschiedener sozialistischer Länder und gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche anderen Wissenschaftler werden im Zusammenhang mit der Totalitarismus-Forschung erwähnt?
Neben Friedrich und Brzezinski werden unter anderem Giovanni Amendola, Mussolini, C.J.H. Hayes, Franz Neumann, Sigmund Neumann, Hannah Arendt, P.C. Ludz, G. Meyer, E. Jesse und Peter Graf v. Kielmansegg im Zusammenhang mit der Totalitarismus-Forschung genannt.
Warum wird die DDR als Beispiel für die Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus-Begriff gewählt?
Die DDR wird als Beispiel gewählt, um zu untersuchen, inwieweit das politische System der DDR als totalitär bezeichnet werden kann und um aufzuzeigen, dass mit dem Totalitarismus-Modell (bzw. -begriff) nur schwer alle Aspekte eines spezifischen Staatssystems beschrieben und eingestuft werden können. Die Arbeit beleuchtet den Wandel im System der DDR, die Rolle der SED und die Stellung der evangelischen Kirche.
- Arbeit zitieren
- Michael Böhm-Udelhoven (Autor:in), 1999, Wie totalitär war das politische System der DDR?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177737