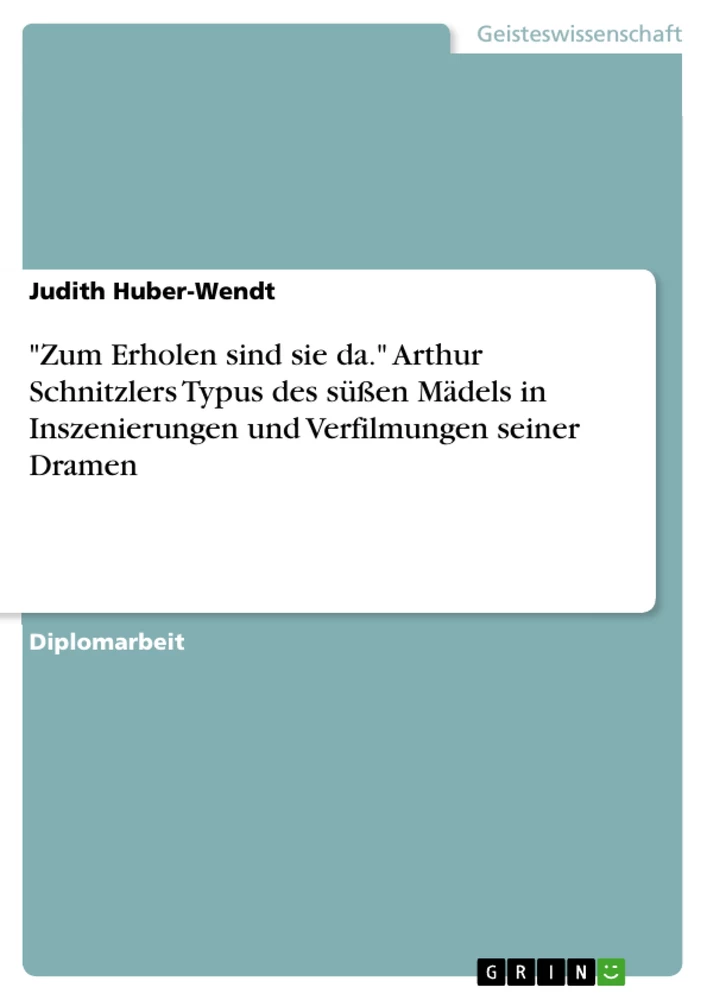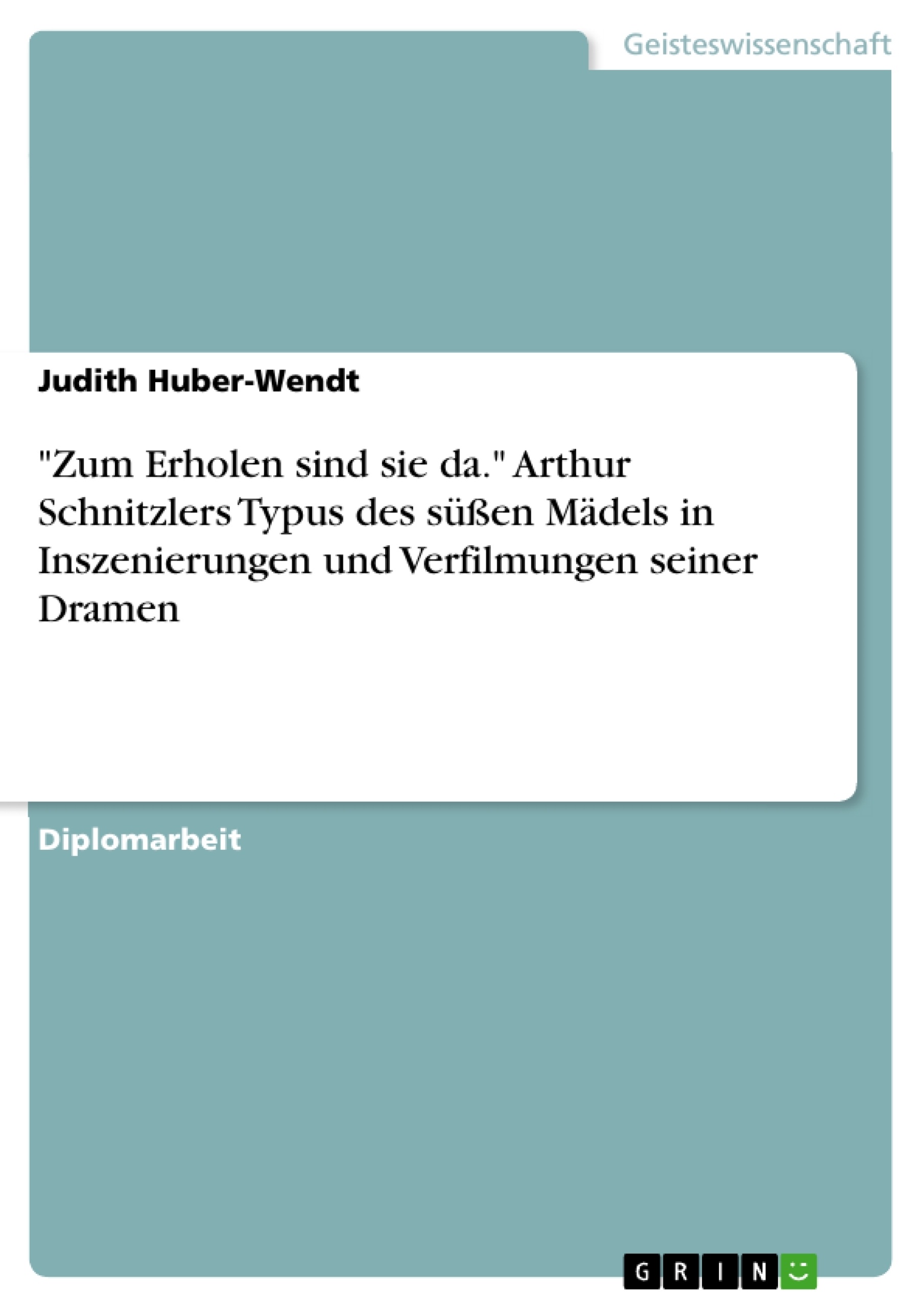„Sonderbar klang mir das ‚süße Mädel’; - zum ersten Mal in dieser kleinen Scene im jetzigen Sinn ausgesprochen und nun ein liter.historisches, fast culturhistorisches Schlagwort.“
Diese Tagebucheintragung Arthur Schnitzlers (1862-1931) vom 21. Dezember 1920 anlässlich einer Aufführung der „Weihnachtseinkäufe“ weist auf die Bedeutung hin, die das süße Mädel seit seiner Entstehungszeit gewonnen hat.
Die Intention dieser Arbeit ist es diesen Frauentypus der Jahrhundertwende näher und vor allem kritisch zu beleuchten. „... als Etikett und Mißverständnis ist dieses „süße Mädel“ des Arthur-Anatol bis zu seinem Tod und darüber hinaus klischeebehaftet nachgeeilt, ...“. Gerade deshalb soll nun der Versuch unternommen werden, die Entwicklung des süßen Mädels von seiner „Erschaffung“ bis heute zu verfolgen und die teilweise immer noch vorhandenen Klischeebilder aufzuzeigen, aber auch nachzuvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- I Der Typus „süßes Mädel“: Ursprung und Charakteristik
- 1. Entstehung: Das Frauenbild in Wien um 1900
- 1.1 Das Frauenbild in der Literatur um 1900
- 1.2 „Ihr seid ja alle so typisch“: Der Typus des süßen Mädels: Fiktion oder Realität?
- 2. Schnitzlers Frauen(bild)
- 2.1 Die süßen Mädel in Schnitzlers Leben
- 3. Charakteristik des süßen Mädels
- 3.1 Sozialer Status & Beruf
- 3.2 Jung – Schön – Unschuldig?: Die Bedeutung von Sexualität und Jungfräulichkeit beim süßen Mädel
- 3.3 Das süße Mädel als Produkt männlicher Wunschvorstellung
- 3.4 „Göttlich, diese Dummheit“: Die scheinbare Naivität des süßen Mädels
- 3.5 Temperament und Gemütsverfassung
- 3.6 Die Schattenseite
- 3.7 Das Wienerische am süßen Wiener Mädel
- 3.8 Das Anti-süße-Mädel: Andere Frauentypen Schnitzlers im Vergleich
- 3.9 Zusammenfassung
- II „So heißen s'mich süßes Mädel, ob i süaẞ bin...“: Die süßen Mädel in Schnitzlers Dramen
- 1. Die süßen Mädel in Schnitzlers Dramen
- 1.1 Ninette in „Das Märchen“ (1891)
- 1.2 „Anatol“-Zyklus (1893)
- 1.2.1 Cora in „Das Abenteuer seines Lebens“
- 1.2.2 Cora in „Die Frage an das Schicksal“
- 1.2.3 Annie in „Abschiedssouper“
- 1.2.4 Annette in „Anatols Größenwahn“
- 1.2.5 Fritzi in „Süßes Mädel“
- 1.3 Mizi Schlager in „Liebelei“ (1896)
- 1.4 Pepi Fischer in „Freiwild“ (1898)
- 1.5 „Das süße Mädel“ im „Reigen“ (1900)
- 1.6 Liesl in „Zum großen Wurstel“ (1906)
- 2. Die zu Unrecht als süße Mädel bezeichneten Frauenfiguren
- 2.1 Fanny Theren in „Das Märchen“ (1891)
- 2.2 Die angeblichen süßen Mädel im „Anatol“-Zyklus (1893)
- 2.3 Christine in „Liebelei“ (1896)
- 2.4 Lolo Langhuber in „Komtesse Mizzi“ (1908)
- 2.5 Erna Wahl in „Das weite Land“ (1911)
- 2.6 Gusti Pflegner in „Im Spiel der Sommerlüfte“ (1930)
- III Das süße Mädel in Theaterinszenierungen ... zu Lebzeiten Schnitzlers in Österreich
- 1. ... in Österreich
- 1.1 Das Märchen
- 1.2 Liebelei
- 1.3 Freiwild
- 1.4 Anatol
- 1.4.1 Das Abenteuer seines Lebens
- 1.4.2 Die Frage an das Schicksal
- 1.4.3 Abschiedssouper
- 1.4.4 Anatols Größenwahn
- 1.4.5 Anatol-Zyklus
- 1.5 Zum großen Wurstel
- 1.6 Reigen
- 1.2 ... im deutschsprachigen Ausland
- 1.2.1 Liebelei
- 1.2.2 Reigen
- 1.3 ... im fremdsprachigen Ausland
- 1.3.1 Liebelei
- 1.3.1.1 in den Niederlanden
- 1.3.1.2 in Schweden
- 1.3.1.3 in Japan
- 1.3.2 Abschiedssouper
- 1.3.2.1 in den Niederlanden
- 1.3.3 Anatol
- 1.3.3.1 in Schweden
- 1.3.4 Reigen
- 1.3.4.1 in Ungarn
- 1.3.4.2 in Russland
- 1.3.3.3 in Frankreich
- 2. ... zur Zeit des politischen Umbruchs der 30er bis 50er Jahre
- 2.1 ...in Österreich
- 2.1.1 Liebelei
- 2.1.2 Anatol
- 2.2 im fremdsprachigen Ausland
- 2.2.1 Liebelei
- 2.2.1.1 in Frankreich
- 2.2.2 Anatol
- 2.2.2.1 in Schweden
- 2.2.2.2 in den USA
- 2.2.3 Reigen
- 2.2.3.1 in Schweden
- Das Frauenbild in Wien um 1900
- Die Charakterisierung des „süßen Mädels“ bei Schnitzler
- Die Darstellung des „süßen Mädels“ in Schnitzlers Dramen
- Inszenierungen und Verfilmungen des „süßen Mädels“
- Vergleich mit anderen weiblichen Figuren in Schnitzlers Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den von Arthur Schnitzler etablierten Typus des „süßen Mädels“ in seinen Dramen und deren Inszenierungen und Verfilmungen. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Charakteristik dieses Frauentyps im Kontext des Wiener Frauenbildes um 1900 und analysiert dessen Darstellung in Schnitzlers Werk.
Zusammenfassung der Kapitel
I Der Typus „süßes Mädel“: Ursprung und Charakteristik: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Charakteristik des „süßen Mädels“ als Frauentypus. Es beleuchtet das Frauenbild in Wien um 1900, sowohl in der Literatur als auch in der Realität, um den historischen Kontext des Typus zu verdeutlichen. Die Analyse konzentriert sich auf Schnitzlers eigene Sicht auf Frauen und wie er diese in seinen Werken, insbesondere durch die Figur des „süßen Mädels“, repräsentiert. Die Kapitel erforscht verschiedene Aspekte des Typus, einschließlich sozialer Status, die Rolle der Sexualität und Jungfräulichkeit, die Naivität als Fassade und die mögliche Schattenseite dieser scheinbar unschuldigen Figur. Es wird auch der Vergleich mit anderen Frauentypen Schnitzlers gezogen, um die Besonderheiten des „süßen Mädels“ hervorzuheben und seine Position innerhalb des Gesamtwerks zu definieren.
II „So heißen s'mich süßes Mädel, ob i süaẞ bin...“: Die süßen Mädel in Schnitzlers Dramen: Dieser Abschnitt analysiert die konkreten Darstellungen des „süßen Mädels“ in verschiedenen Dramen Schnitzlers. Es werden verschiedene Figuren aus unterschiedlichen Werken untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Charakterisierung aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den Figuren, die eindeutig als „süße Mädel“ identifizierbar sind, sondern auch auf denjenigen, die fälschlicherweise so eingestuft werden. Dies ermöglicht eine differenzierte Betrachtung und eine kritische Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit der weiblichen Figuren in Schnitzlers Werk. Der Abschnitt beleuchtet, wie Schnitzler den Typus des „süßen Mädels“ variiert und die Komplexität dieser Figur hervorgehoben werden.
III Das süße Mädel in Theaterinszenierungen ... zu Lebzeiten Schnitzlers in Österreich: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rezeption des „süßen Mädels“ in Theaterinszenierungen zu Schnitzlers Lebzeiten in Österreich. Es untersucht, wie der Typus in verschiedenen Aufführungen interpretiert und inszeniert wurde, und wie sich diese Inszenierungen vom ursprünglichen Text unterscheiden. Die Analyse berücksichtigt den historischen und gesellschaftlichen Kontext der jeweiligen Aufführungen und beleuchtet den Einfluss der Interpretationen auf die Wahrnehmung des „süßen Mädels“ durch das Publikum. Der Abschnitt deckt eine Vielzahl an Stücken ab, und analysiert den Umgang der jeweiligen Inszenierungen mit den besonderen Aspekten der weiblichen Figuren.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, süßes Mädel, Wiener Frauenbild, Dramen, Theaterinszenierungen, Frauenrolle, Sexualität, Naivität, Realität, Fiktion, Literatur um 1900, Österreichische Literatur.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: "Das süße Mädel" bei Arthur Schnitzler
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den von Arthur Schnitzler etablierten Typus des „süßen Mädels“ in seinen Dramen und deren Inszenierungen. Sie beleuchtet die Entstehung und Charakteristik dieses Frauentyps im Kontext des Wiener Frauenbildes um 1900 und analysiert dessen Darstellung in Schnitzlers Werk.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themen: Das Frauenbild in Wien um 1900, die Charakterisierung des „süßen Mädels“ bei Schnitzler, die Darstellung des „süßen Mädels“ in Schnitzlers Dramen, Inszenierungen und Verfilmungen des „süßen Mädels“ sowie ein Vergleich mit anderen weiblichen Figuren in Schnitzlers Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I untersucht den Ursprung und die Charakteristik des „süßen Mädels“, Kapitel II analysiert die Darstellung des Typus in Schnitzlers Dramen, und Kapitel III konzentriert sich auf die Theaterinszenierungen zu Schnitzlers Lebzeiten in Österreich, im deutschsprachigen und fremdsprachigen Ausland, sowie im Kontext des politischen Umbruchs der 30er bis 50er Jahre.
Welche Dramen Schnitzlers werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Dramen Schnitzlers, darunter "Das Märchen", den "Anatol"-Zyklus (mit einzelnen Stücken wie "Das Abenteuer seines Lebens", "Die Frage an das Schicksal", "Abschiedssouper", "Anatols Größenwahn" und "Süßes Mädel"), "Liebelei", "Freiwild", "Der Reigen" und "Zum großen Wurstel". Zusätzlich werden Frauenfiguren aus anderen Stücken untersucht, die fälschlicherweise als "süße Mädel" bezeichnet werden könnten.
Wie wird der Begriff „süßes Mädel“ definiert und charakterisiert?
Die Arbeit untersucht den Begriff „süßes Mädel“ umfassend und differenziert. Es werden Aspekte wie sozialer Status, Rolle der Sexualität und Jungfräulichkeit, scheinbare Naivität und die mögliche Schattenseite dieser Figur analysiert. Ein Vergleich mit anderen Frauentypen Schnitzlers hilft, die Besonderheiten des „süßen Mädels“ und dessen Position innerhalb des Gesamtwerks zu definieren.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext, insbesondere das Wiener Frauenbild um 1900, spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des „süßen Mädels“ als Frauentypus im Kontext der damaligen Literatur und gesellschaftlichen Realität.
Wie werden die Theaterinszenierungen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rezeption des „süßen Mädels“ in Theaterinszenierungen zu Schnitzlers Lebzeiten in Österreich und im Ausland. Sie analysiert, wie der Typus in verschiedenen Aufführungen interpretiert und inszeniert wurde und berücksichtigt den historischen und gesellschaftlichen Kontext der jeweiligen Aufführungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, süßes Mädel, Wiener Frauenbild, Dramen, Theaterinszenierungen, Frauenrolle, Sexualität, Naivität, Realität, Fiktion, Literatur um 1900, Österreichische Literatur.
- Quote paper
- Judith Huber-Wendt (Author), 2005, "Zum Erholen sind sie da." Arthur Schnitzlers Typus des süßen Mädels in Inszenierungen und Verfilmungen seiner Dramen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177641