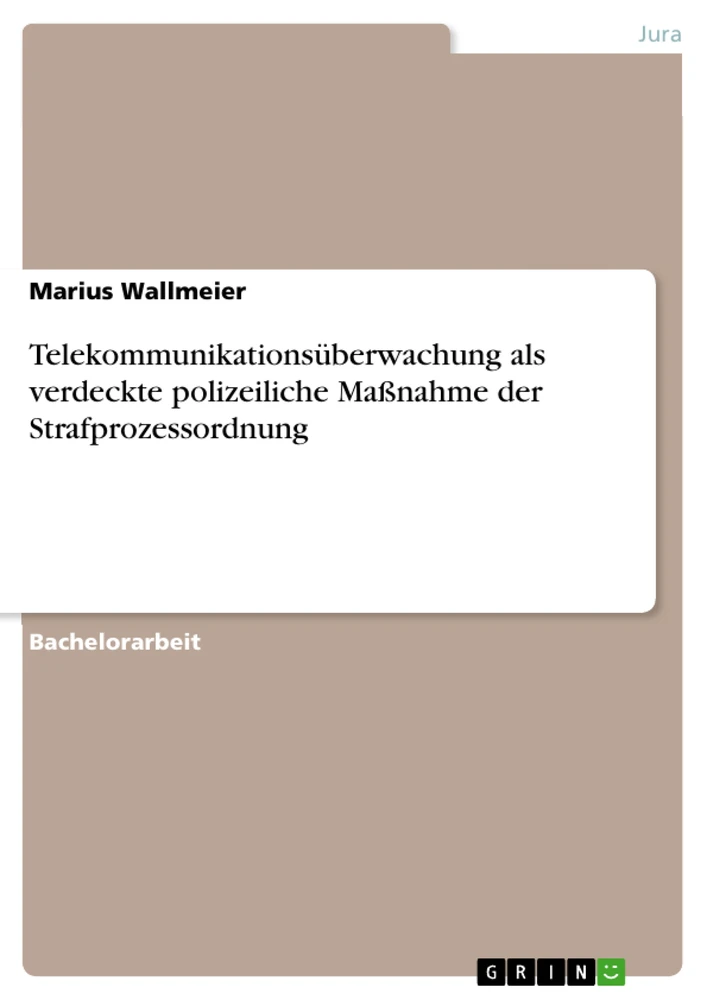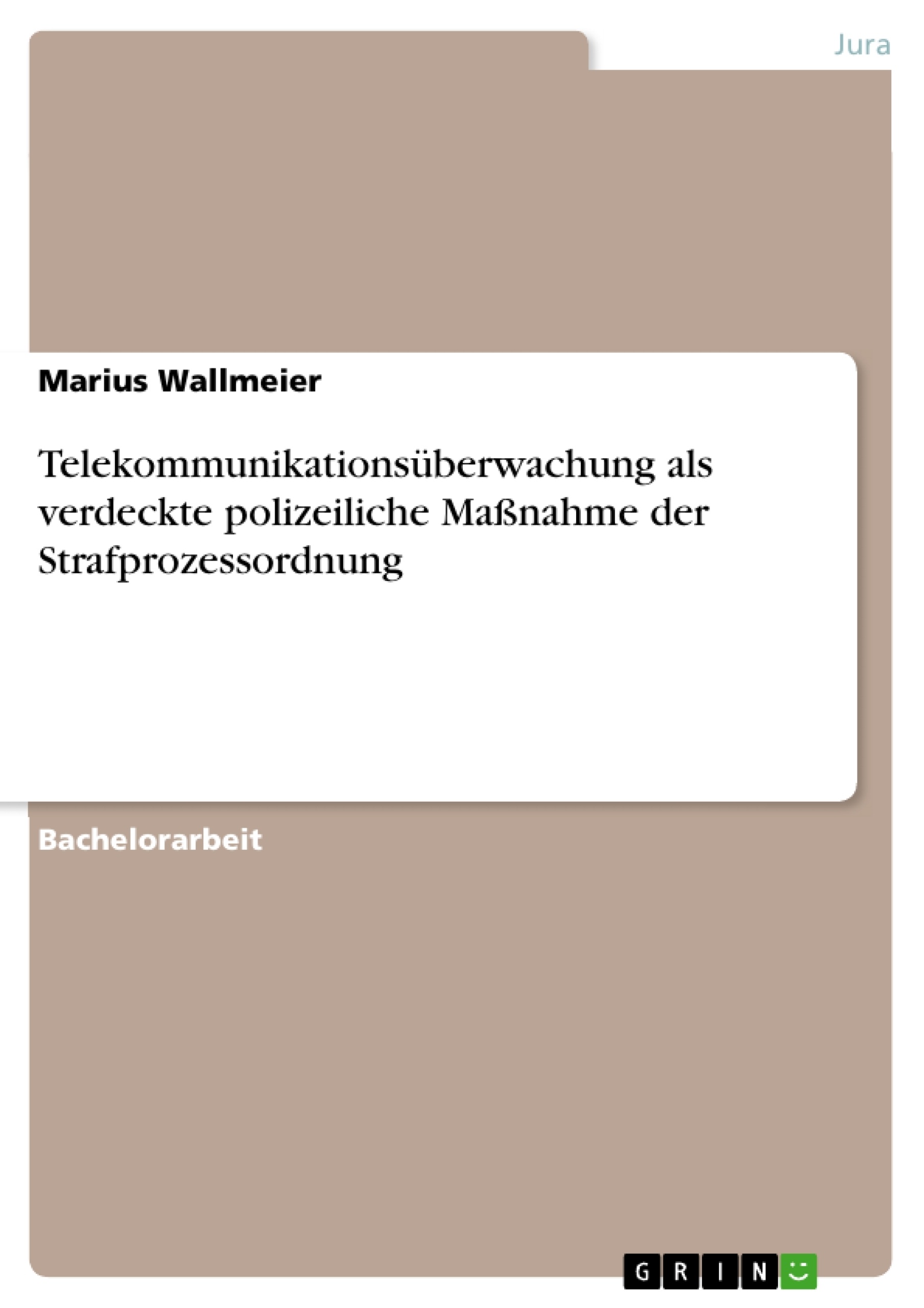Telekommunikationsüberwachung ist eine im Strafverfahrensrecht und Polizeirecht gängige Bezeichnung für die Überwachung von Telekommunikationsvorgängen mit dem Ziel der Feststellung von Kommunikationsinhalte und Kommunikationsdaten. Darunter fallen die Aufzeichnung von Gesprächen und das Auslesen von E-Mails, Kurzmitteilungen in der Form von SMS und MMS sowie Telefax.
Die Möglichkeit der gezielten Überwachung der modernen Telekommunikation ist durch das G 10, auch Abhörgesetz genannt, eröffnet worden. Die Überwachung der Telekommunikation ist eine verdeckte Ermittlungsmaßnahme der Strafprozessordnung und ist in einer Reihe von Vorschriften geregelt, die auf komplexe Weise ineinander greifen und deren jeweiliger Anwendungsbereich mitunter schwer abzugrenzen ist. Die Telekommunikationsüberwachung im Rahmen des Strafverfahrens wurde in § 100a ff. StPO geregelt. Hinzu treten noch die Vorschriften des Telekommunikationsgesetztes und die der Telekommunikations-Überwachungsverordnung.
Die Rechtsfolgen von § 100a StPO gehen über die bloße Wahrnehmung von Gesprächsinhalten hinaus und erfassen ebenfalls auch die entstehenden Daten des technischen Vorganges bei dem jeweiligen Kommunikationsereignis. Insofern erfolgt ein universaler Zugriff auf die persönliche Sphäre des Einzelnen, deren Schutz aus dem Grundgesetz hergeleitet wird.
Betroffen sind hier vor allem Art. 10 und 13 GG, ebenso die informationeller Selbstbestimmung, die aus Art. 2 I 1 I GG abgeleitet wird.
Grundgesetzlich wird bei dem Fernmeldegeheimnis im Sinne des Art. 10 GG die gesamte individuelle Kommunikation über das Medium der drahtlosen oder drahtgebundenen elektromagnetischen Wellen vor dem Zugriff der öffentlichen Gewalt geschützt. Der Schutz umfasst vor allem den Telefon-, Telegramm-, Funk-, Teletext-, Telefaxverkehr und Bildschirmdienst, aber auch die Kommunikation über das Internet.
Eingriffe in Art 10 I GG liegen vor, wenn die öffentliche Gewalt vom Inhalt oder den Daten der Sendungen oder Mitteilungen Kenntnis nimmt, sowie die Speicherung diesbezüglich erlangter Informationen, deren Verwertung und Weitergabe vornimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Statistik
- 3 Begriffsbestimmungen
- 3.1 Telekommunikation
- 3.2 Überwachung und Aufzeichnung
- 4 Rechtliche Betrachtung
- 4.1 Materielle Anordnungsvoraussetzungen
- 4.2 Formelle Anordnungsvoraussetzungen
- 4.3 Betroffene
- 4.4 Mitwirkungspflicht der Telekommunikationsanbieter
- 4.5 Beendigung der Maßnahme / Befristung
- 4.6 Verwendung erlangter Daten / Erkenntnisse
- 4.7 Rechtschutz
- 5 Erhebung von Telekommunikationsdaten
- 5.1 Überwachung von Emails
- 5.2 Abhören von Mailboxen
- 5.3 Überwachung Mobiltelefone im Stand-by-Modus
- 5.4 Überwachung von Raumgesprächen
- 5.5 Einsatz IMSI- / IMEI-Catchers / Lokalisierung eines Mobiltelefons
- 5.6 Einsatz MAC-Catcher
- 5.7 Beschlagnahme von Datenträgern mit Telekommunikationsdaten
- 5.8 Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten
- 5.9 Bestandsdatenabfrage
- 5.10 Sonderfall: Online Durchsuchung
- 5.10.1 Online-Durchsuchung
- 5.10.2 Internet / vernetzte Speichereinheiten
- 5.10.3 VoIP / Internet-Telefonie
- 5.11 Mauterfassung
- 5.12 Zusammenfassung
- 6 Grenzen der Beweissammlung im Strafverfahren
- 6.1 Beweiserhebungsverbote
- 6.1.1 Bestimmung des Bereichs der privaten Lebensgestaltung
- 6.1.2 Verfassungsrechtliche Beweiserhebungsverbote
- 6.2 Beweisverwertungsverbote
- 6.2.1 Gesetzliche Beweisverwertungsverbote
- 6.2.2 Nicht normierte Verwertungsverbote
- 6.2.3 Zufallsfunde
- 6.2.4 „fruit oft he poisonous tree“ / Fernwirkung
- 6.2.5 Geltendmachung von Verwertungsverboten
- 6.1 Beweiserhebungsverbote
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit untersucht die Telekommunikationsüberwachung als verdeckte polizeiliche Maßnahme im Kontext der Strafprozessordnung. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Überwachungsmethode umfassend zu beleuchten.
- Rechtliche Voraussetzungen für die Telekommunikationsüberwachung
- Verschiedene Methoden der Telekommunikationsüberwachung
- Rechte der Betroffenen und deren Schutz
- Verwertung der gewonnenen Daten im Strafverfahren
- Grenzen der Beweissammlung durch Telekommunikationsüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Telekommunikationsüberwachung als verdeckte Ermittlungsmaßnahme ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt die Relevanz des Themas im Kontext des modernen Strafverfahrens dar.
2 Statistik: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit und zum Erfolg von Telekommunikationsüberwachungen. Die Daten dienen als Grundlage für die weitere Analyse der Bedeutung und des Umfangs dieser Ermittlungsmaßnahme.
3 Begriffsbestimmungen: Hier werden die zentralen Begriffe wie "Telekommunikation", "Überwachung" und "Aufzeichnung" präzise definiert, um eine einheitliche terminologische Grundlage für die Arbeit zu schaffen. Dies verhindert Missverständnisse und ermöglicht eine klare Argumentation.
4 Rechtliche Betrachtung: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen der Telekommunikationsüberwachung. Es analysiert die materiellen und formellen Voraussetzungen für eine Anordnung, die Rechte der Betroffenen, die Mitwirkungspflichten der Telekommunikationsanbieter, die Beendigung der Maßnahme, die Verwendung der erlangten Daten und den bestehenden Rechtschutz.
5 Erhebung von Telekommunikationsdaten: Dieses Kapitel beschreibt detailliert verschiedene Methoden der Telekommunikationsüberwachung, von der Überwachung von E-Mails und Mailboxen bis hin zum Einsatz von IMSI-Catchern und der Abfrage von Bestandsdaten. Es analysiert die jeweiligen rechtlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten jeder Methode. Die Zusammenfassungen innerhalb dieses Kapitels verdeutlichen die Vielfältigkeit und den technischen Fortschritt in diesem Bereich.
6 Grenzen der Beweissammlung im Strafverfahren: Dieses Kapitel untersucht die Grenzen der Beweissammlung durch Telekommunikationsüberwachung. Es befasst sich mit Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverboten, darunter verfassungsrechtliche Beschränkungen und die Problematik von Zufallsfunden und der „fruit of the poisonous tree“-Doktrin. Das Kapitel analysiert die Balance zwischen effektiver Strafverfolgung und dem Schutz der Grundrechte.
Schlüsselwörter
Telekommunikationsüberwachung, Strafprozessordnung, verdeckte Ermittlungsmaßnahme, Rechtliche Voraussetzungen, Datenschutz, Grundrechte, Beweismittel, Beweiserhebungsverbote, Beweisverwertungsverbote, Online-Durchsuchung, IMSI-Catcher, Telekommunikationsanbieter.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Telekommunikationsüberwachung im Strafverfahren
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Telekommunikationsüberwachung als verdeckte polizeiliche Maßnahme im Kontext der Strafprozessordnung. Sie beleuchtet umfassend die rechtlichen Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Grenzen dieser Überwachungsmethode.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Voraussetzungen für Telekommunikationsüberwachung, verschiedene Methoden der Überwachung, die Rechte der Betroffenen und deren Schutz, die Verwertung der gewonnenen Daten im Strafverfahren und die Grenzen der Beweissammlung durch Telekommunikationsüberwachung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Statistik, Begriffsbestimmungen, Rechtliche Betrachtung, Erhebung von Telekommunikationsdaten, Grenzen der Beweissammlung im Strafverfahren und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Telekommunikationsüberwachung.
Wie werden die verschiedenen Methoden der Telekommunikationsüberwachung beschrieben?
Kapitel 5 beschreibt detailliert verschiedene Methoden, darunter die Überwachung von E-Mails und Mailboxen, die Überwachung von Mobiltelefonen im Standby-Modus, die Überwachung von Raumgesprächen, den Einsatz von IMSI-/IMEI-Catchern, MAC-Catchern, die Beschlagnahme von Datenträgern, die Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten, die Bestandsdatenabfrage, Online-Durchsuchungen (inkl. VoIP), Mauterfassung. Die rechtlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten jeder Methode werden analysiert.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Kapitel 4 behandelt die rechtlichen Grundlagen, analysiert die materiellen und formellen Voraussetzungen für eine Anordnung der Überwachung, die Rechte der Betroffenen, die Mitwirkungspflichten der Telekommunikationsanbieter, die Beendigung der Maßnahme, die Verwendung der erlangten Daten und den bestehenden Rechtschutz. Kapitel 6 befasst sich mit Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverboten, darunter verfassungsrechtliche Beschränkungen und die Problematik von Zufallsfunden und der „fruit of the poisonous tree“-Doktrin.
Welche statistischen Daten werden verwendet?
Kapitel 2 präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit und zum Erfolg von Telekommunikationsüberwachungen. Diese Daten dienen als Grundlage für die Analyse der Bedeutung und des Umfangs dieser Ermittlungsmaßnahme.
Welche Begriffe werden definiert?
Kapitel 3 definiert zentrale Begriffe wie "Telekommunikation", "Überwachung" und "Aufzeichnung", um eine einheitliche terminologische Grundlage zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Telekommunikationsüberwachung, Strafprozessordnung, verdeckte Ermittlungsmaßnahme, Rechtliche Voraussetzungen, Datenschutz, Grundrechte, Beweismittel, Beweiserhebungsverbote, Beweisverwertungsverbote, Online-Durchsuchung, IMSI-Catcher, Telekommunikationsanbieter.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 7) fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Möglichkeiten und Grenzen der Telekommunikationsüberwachung im Strafverfahren.
- Citar trabajo
- Marius Wallmeier (Autor), 2011, Telekommunikationsüberwachung als verdeckte polizeiliche Maßnahme der Strafprozessordnung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177609