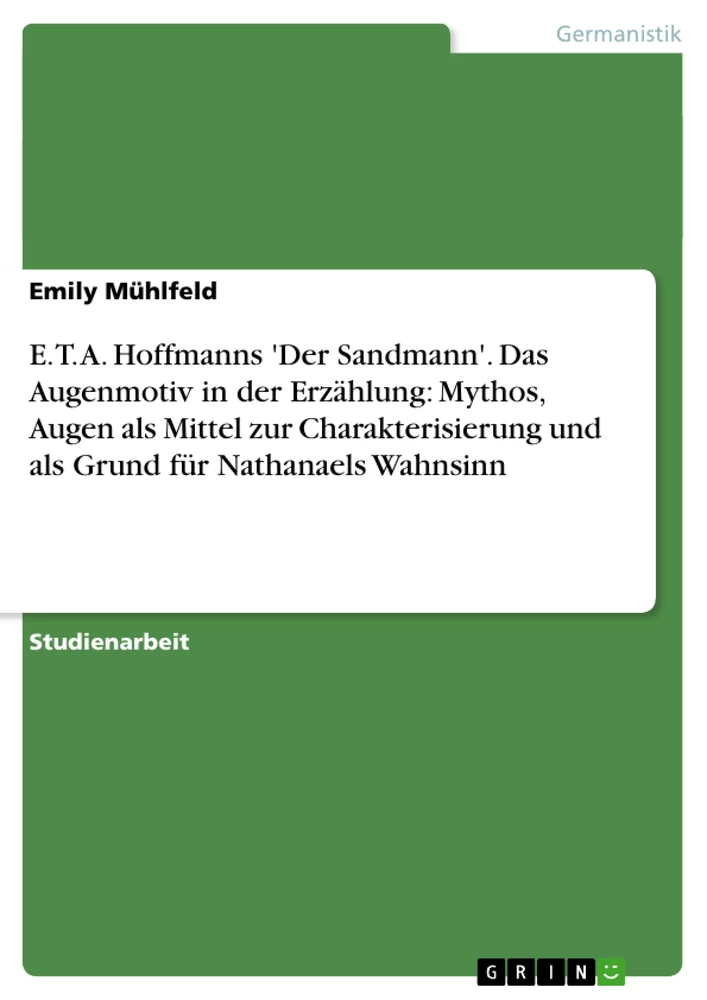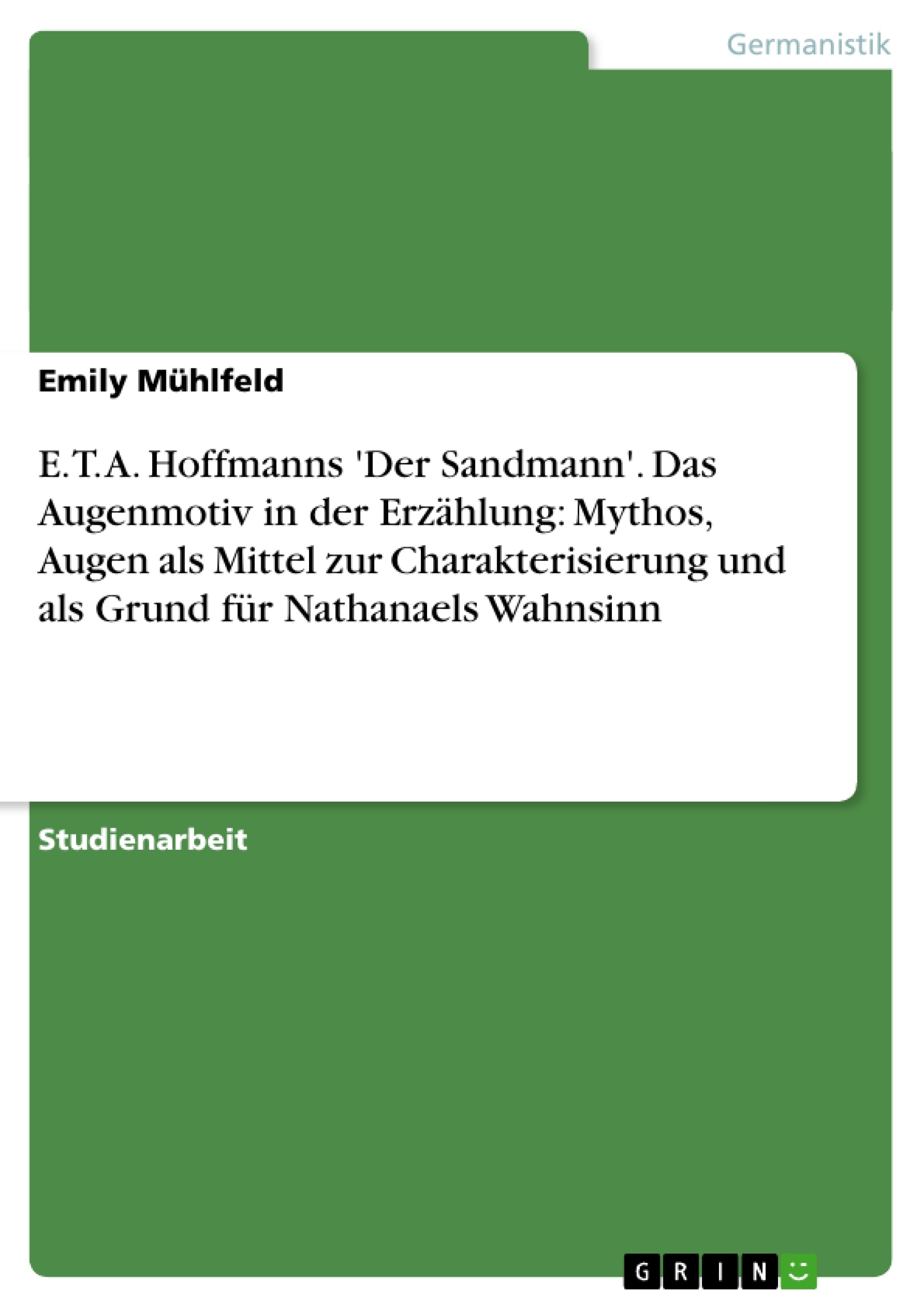[...] Sie verleiht der Geschichte die gruselige Stimmung. Coppelius/Coppola erscheint als eine dunkle Macht; ob er jedoch wirklich der von Nathanael so gefürchtete Sandmann ist, bleibt ungeklärt. Dadurch, dass der Leser die Geschichte nur aus der Sicht von Nathanael erzählt bekommt, fühlt er seine Angst mit. Er kann jedoch nicht wissen, ob Nathanael als Wahnsinniger sich in seiner Geistesgestörtheit den Sandmann nur einbildet, oder ob dieser wirklich existent und nur für die anderen fiktiven Personen nicht sichtbar ist.3 Die Thematik des Unheimlichen behandelte Sigmund Freud in seinem gleichnamigen Aufsatz (s. u.). Danach wurde “Der Sandmann” zum meist-interpretierten Werk Hoffmanns. Kaiser bezeichnet das Stück als im “Perspektivismus und im traumartigen Übergang von figürlichmetaphorischer und gegenständlich-ereignishafter Rede das vielleicht radikalste Erzählexperiment (...)”4 Hoffmanns. Tatsächlich ist dies auch der Haupt-Ansatzpunkt vieler Interpretationen.
Nathanael als subjektiver Erzähler und später der Herausgeber, der aus Nathanaels Sicht erzählt, lassen für den Leser keine objektive Beurteilung der Geschehnisse zu. Der Gegensatz zwischen Nathanael als einem möglicherweise wahnsinnigen Protagonisten und Clara und der Außenwelt als fiktive Personen, die Nathanaels Erlebnisse realistisch und nüchtern betrachten wird von Hoffmann im “Sandmann” geradezu perfekt ausgearbeitet. Gerade diese Tatsache steigert das Unheimliche im “Sandmann”, der deshalb als exemplarisch für die so genannten “Nachstücke” zu Hoffmanns Zeit gelten kann. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Augenmotiv, einem Thema, das sehr oft untersucht wurde.
Trotz der vielen Abhandlungen zu Hoffmanns Augenmotiv im “Sandmann” habe ich versucht, eigenständig zu arbeiten und die Sekundärliteratur vor allem als Unterstützung für meine eigenen Thesen einzusetzen. Die Arbeit beschäftigt sich zuerst mit der wohl wichtigsten Literatur zum “Sandmann”, dann wird die Funktion der Augen als charakterisierendes Mittel dargestellt.
Auch die Rolle der Augen bei der Entwicklung des Wahnsinns in Nathanel habe ich berücksichtigt und untersucht. Als Abschluss dient eine kurze Überlegung darüber, inwieweit Hoffmann optische Geräte als Ergänzung des Augenmotivs dazu benutzt, die Technik-Gläubigkeit seiner Zeit zu kritisieren.
4 Kaiser, Gerhard: E. T. A. Hoffmann. Stuttgart: Metzler 1988 (= Sammlung Metzler 243). S. 54.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der Sandmann - ein Nachtstück
- 2 Interpretation Sigmund Freuds
- 3 Das Augenmotiv
- 3.1 Der Mythos "Auge"
- 3.2 Das Augenmotiv zu Hoffmanns Zeit
- 4 Augen als Mittel zur Charakterisierung
- 4.1 Coppelius/Coppola
- 4.2 Clara
- 4.3 Olimpia
- 4.4 Nathanael
- 5 Augen als das Mittel, das zum Wahnsinn bei Nathanael führt
- 5.1 Augen im Märchen der Amme
- 5.2 Augen in der Laborszene
- 5.3 Nathanaels Dichtung über seine Vorahnungen
- 5.4 Der Kauf und das Erproben des Perspektivs
- 5.5 Die Rolle der Augen bei der Liebe zu Olimpia
- 5.6 Die Rolle der Augen bei den beiden Wahnsinnsanfällen
- 5.6.1 Der erste Wahnsinnsanfall
- 5.6.2 Der zweite Wahnsinnsanfall
- 6 Optische Geräte als Kritik an der Technik-Gläubigkeit zu Hoffmanns Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Augenmotiv in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" und dessen Bedeutung für die Charakterisierung der Figuren und die Entwicklung des Wahnsinns bei Nathanael. Die Analyse berücksichtigt sowohl den mythologischen Hintergrund des Augenmotivs als auch seinen Kontext in Hoffmanns Zeit. Die Interpretation bezieht sich auch auf Sigmund Freuds Analyse des Textes.
- Das Augenmotiv als zentrales Symbol in "Der Sandmann"
- Die Charakterisierung der Figuren durch die Darstellung ihrer Augen und ihres Blicks
- Die Rolle des Augenmotivs in der Entstehung von Nathanaels Wahnsinn
- Der Bezug zu mythologischen Vorstellungen vom Auge
- Die Kritik an der Technikgläubigkeit der Zeit im Kontext des Augenmotivs und optischer Geräte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Der Sandmann - ein Nachtstück: Dieses Kapitel führt in die Novelle "Der Sandmann" ein und klassifiziert sie als "Nachtstück" aufgrund ihrer nächtlichen Handlung, unheimlichen Atmosphäre und der ambivalenten Figur des Sandmanns (Coppelius/Coppola). Die Ambivalenz der Figur und die Erzählperspektive aus Nathanaels Sicht erzeugen beim Leser eine beklemmende Unsicherheit, ob der Sandmann real existiert oder eine Projektion von Nathanaels Wahnsinn darstellt. Das Kapitel betont die Bedeutung der unheimlichen Stimmung und den subjektiven Erzählstil als zentrale Elemente des "Nachtstücks".
2 Interpretation Sigmund Freuds: Dieses Kapitel analysiert Sigmund Freuds Interpretation von "Der Sandmann", die sich auf die zentrale Bedeutung der Angst vor Augenverlust und deren Verbindung zur Kastrationsangst konzentriert. Freud sieht im Motiv des Sandmanns, der Kindern die Augen ausreißt, ein zentrales Symbol für diese Angst. Das Kapitel diskutiert kritische Stimmen zu Freuds Deutung, die seine Fokussierung auf die Kastrationsangst als zu eng und seine Interpretation als weniger eine literaturwissenschaftliche Analyse, sondern als psychologische Untersuchung der Genese von Kastrationsängsten einordnen. Die Diskussion der unterschiedlichen Interpretationen unterstreicht die Vielschichtigkeit des Textes.
3 Das Augenmotiv: Dieser Abschnitt untersucht das Augenmotiv in seiner mythologischen und zeitgeschichtlichen Dimension. Es werden die verschiedenen mythologischen Bedeutungen des Auges beleuchtet und der Kontext des Motivs innerhalb der Literatur und Kunst Hoffmanns Zeit erörtert. Diese Erörterung legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Bedeutung des Augenmotivs in der Charakterisierung der Figuren und der Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn. Die Einbettung des Motivs in einen historischen und kulturellen Kontext erweitert das Verständnis seiner Bedeutung in der Novelle.
4 Augen als Mittel zur Charakterisierung: In diesem Kapitel wird die Funktion der Augen als charakterisierendes Mittel in der Novelle untersucht. Es werden die Figuren Coppelius/Coppola, Clara, Olimpia und Nathanael im Hinblick auf ihre Augen und deren Auswirkung auf ihr Erscheinungsbild und ihre Wirkung auf andere Figuren analysiert. Die unterschiedlichen Darstellungen der Augen helfen, die Persönlichkeiten der Figuren besser zu verstehen und deren Beziehungen zueinander zu beleuchten. Das Kapitel vertieft das Verständnis der Figuren und ihrer Beziehungen durch die detaillierte Analyse ihrer Augen als charakteristische Merkmale.
5 Augen als das Mittel, das zum Wahnsinn bei Nathanael führt: Dieser Abschnitt untersucht die entscheidende Rolle des Augenmotivs bei der Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn. Er analysiert verschiedene Szenen und Ereignisse, in denen Augen eine zentrale Rolle spielen, wie beispielsweise das Märchen der Amme, die Laborszene, Nathanaels Gedichte und seine Beziehung zu Olimpia. Durch die Verknüpfung dieser Szenen wird deutlich, wie das Augenmotiv Nathanaels psychische Instabilität und seinen zunehmenden Wahnsinn befeuert. Die Analyse betont den kausalen Zusammenhang zwischen den Augensymbolen und der psychischen Dekonstruktion Nathanaels.
6 Optische Geräte als Kritik an der Technik-Gläubigkeit zu Hoffmanns Zeit: Dieses Kapitel untersucht die Verwendung optischer Geräte in der Novelle als mögliche Kritik an der aufkommenden Technikgläubigkeit im 19. Jahrhundert. Es wird erörtert, wie die optischen Geräte die Wahrnehmung von Nathanael beeinflussen und zu seiner Desorientierung und seinem Wahnsinn beitragen. Die Interpretation deutet auf eine mögliche Kritik an dem blinden Vertrauen in den Fortschritt und die technischen Errungenschaften. Es wird dargelegt, wie die Technologie nicht nur das Sehen beeinflusst, sondern auch die geistige Gesundheit des Protagonisten bedroht.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Augenmotiv, Wahnsinn, Nathanael, Charakterisierung, Mythos, Kastrationsangst, Sigmund Freud, Technikkritik, Romantik, Nachtstück, Unheimliches, Olimpia, Coppelius/Coppola, Clara.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Augenmotiv in E.T.A. Hoffmanns Novelle "Der Sandmann" und dessen Bedeutung für die Charakterisierung der Figuren und die Entwicklung des Wahnsinns bei Nathanael. Die Analyse betrachtet den mythologischen Hintergrund, den historischen Kontext und bezieht sich auch auf Sigmund Freuds Interpretation.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse umfasst das Augenmotiv als zentrales Symbol, die Charakterisierung der Figuren durch ihre Augen und ihren Blick, die Rolle des Augenmotivs bei Nathanaels Wahnsinn, den Bezug zu mythologischen Vorstellungen vom Auge und die Kritik an der Technikgläubigkeit der Zeit im Kontext des Augenmotivs und optischer Geräte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 führt in die Novelle ein und beschreibt sie als "Nachtstück". Kapitel 2 analysiert Sigmund Freuds Interpretation. Kapitel 3 untersucht das Augenmotiv in mythologischer und historischer Perspektive. Kapitel 4 analysiert die Charakterisierung der Figuren durch ihre Augen. Kapitel 5 untersucht die Rolle der Augen bei Nathanaels Wahnsinn. Kapitel 6 analysiert optische Geräte als Kritik an der Technikgläubigkeit.
Wie wird Sigmund Freuds Interpretation behandelt?
Die Arbeit analysiert Freuds Interpretation, die sich auf die Angst vor Augenverlust und die Kastrationsangst konzentriert. Sie diskutiert aber auch kritische Stimmen zu Freuds Deutung und deren Fokussierung auf die Kastrationsangst.
Welche Rolle spielen die Augen in der Charakterisierung der Figuren?
Die Augen werden als wichtiges Mittel der Charakterisierung eingesetzt. Die Arbeit analysiert die Augen von Coppelius/Coppola, Clara, Olimpia und Nathanael und deren Wirkung auf ihr Erscheinungsbild und ihre Beziehungen zueinander.
Wie wird der Wahnsinn Nathanaels erklärt?
Die Arbeit argumentiert, dass das Augenmotiv zentral für die Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn ist. verschiedene Szenen (Märchen der Amme, Laborszene, Gedichte, Beziehung zu Olimpia) werden analysiert, um den kausalen Zusammenhang zwischen Augensymbolen und Nathanaels psychischer Dekonstruktion aufzuzeigen.
Welche Bedeutung haben optische Geräte in der Novelle?
Die Arbeit interpretiert die optischen Geräte als mögliche Kritik an der aufkommenden Technikgläubigkeit im 19. Jahrhundert. Sie beeinflusst Nathanaels Wahrnehmung, trägt zu seiner Desorientierung und seinem Wahnsinn bei und symbolisiert ein blindes Vertrauen in den technischen Fortschritt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Augenmotiv, Wahnsinn, Nathanael, Charakterisierung, Mythos, Kastrationsangst, Sigmund Freud, Technikkritik, Romantik, Nachtstück, Unheimliches, Olimpia, Coppelius/Coppola, Clara.
- Quote paper
- Emily Mühlfeld (Author), 2000, E. T. A. Hoffmanns 'Der Sandmann'. Das Augenmotiv in der Erzählung: Mythos, Augen als Mittel zur Charakterisierung und als Grund für Nathanaels Wahnsinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17744