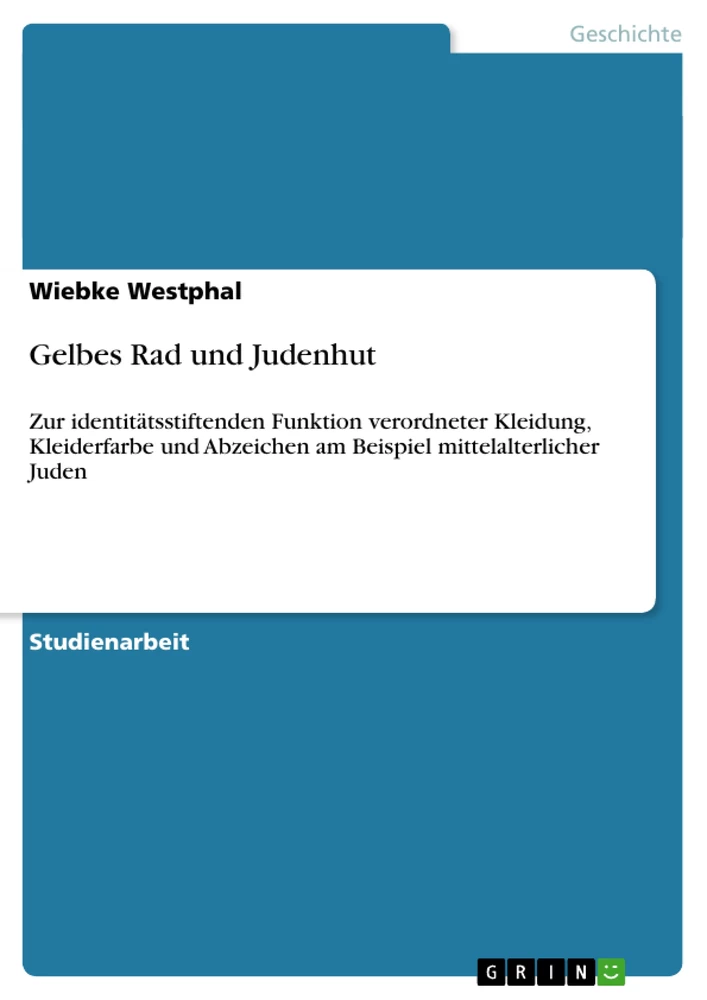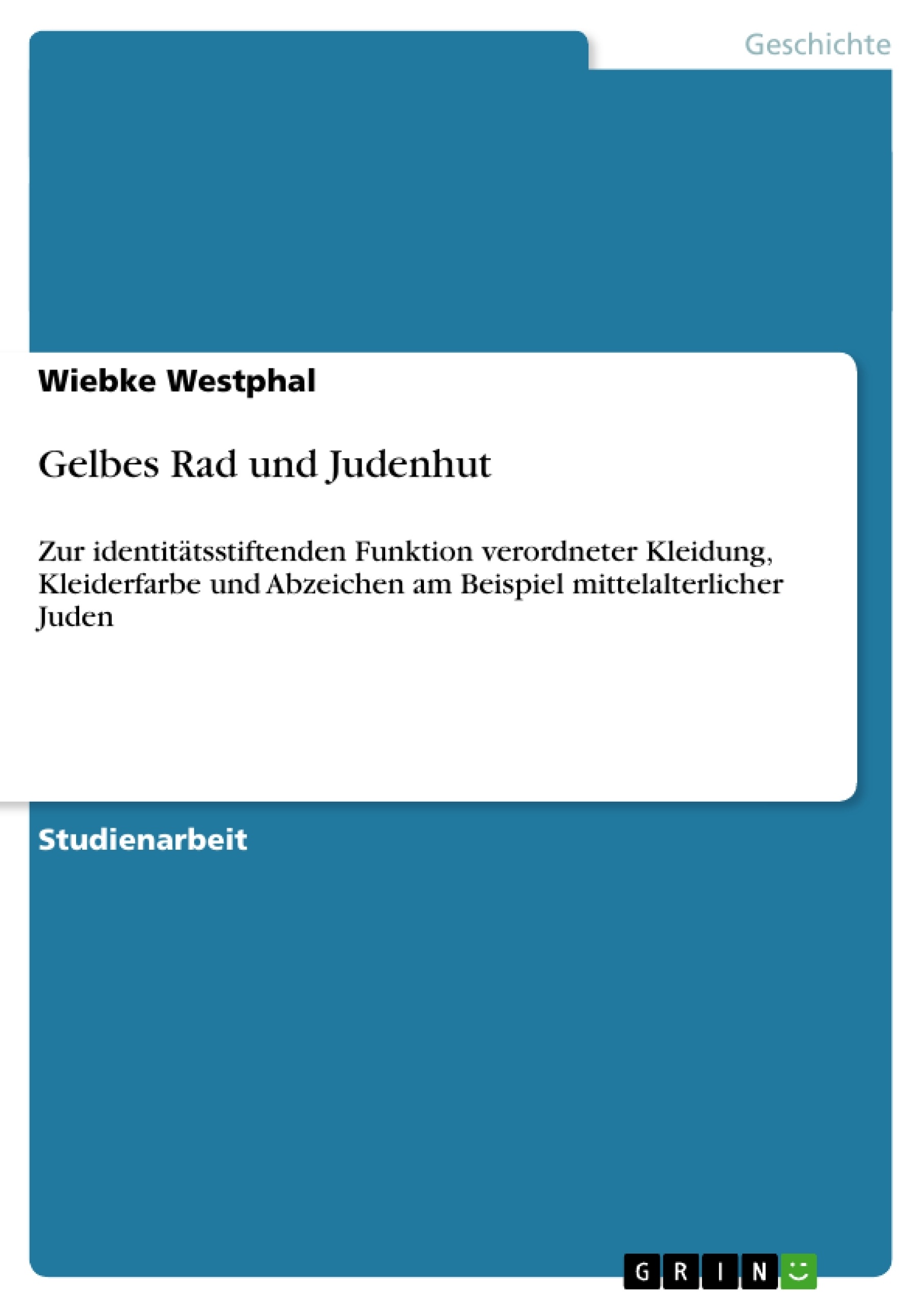„Kleider machen Leute“ – dieser Ausspruch galt von jeher. Obgleich in der heutigen marktwirtschaftlich geprägten Konsum- und Massengesellschaft die polyvalente und vielfältige Zeichenfunktion der Kleidung häufig nicht mehr so deutlich zu erkennen ist wie in früheren Epochen oder in so genannten „vorindustriellen“ Gesellschaften – ihre Aufgabe, Identität zu schaffen und zu vermitteln, ist geblieben. Auch wenn man heute nicht mehr unbedingt von einer normativ vermittelten Kongruenz zwischen Kleidung und sozialem Rang ausgehen kann, wenn Kleidung vor allem zu einem Mittel der Selbstdarstellung geworden ist, zu einem äußerlich sichtbaren Ausdruck der Persönlichkeit – in früheren Zeiten, vor allem ab Ende des 11. Jahrhunderts, war Kleidung mehr als ein tragbares Schneckenhaus, das der Mensch immer und überall zur Schau stellen oder sich darin verstecken konnte. In der spätmittelalterlichen Gesellschaft als „System der Veräußerlichung des Sozialprestige“ kam der Kleidung besondere Relevanz zu – eindeutige soziale Zuordnung war gleichsam erwünscht und gefordert. Mehr noch: Das Verlassen des einem Individuum zugestandenen Kleidungsrahmens war strafbar.
Das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung der Frage, wie sich Kleidergesetzgebung im Mittelalter vollzog und wie sie sich im jüdischen Alltag niederschlug. Welche Macht hatten Stoffe, Farben und Formen? Zu diesem Zweck soll zunächst ganz allgemein dargelegt werden, was Kleidung und Textilien zu tun vermögen, welche Funktionen sie – jenseits von Schutz, Scham und Schmuck – haben und wie sie kommunizieren. Wie steigert oder mindert ein bestimmtes Kleidungsstück das Ansehen einer Person? Wie kann Kleidung auch über den tatsächlichen Stand innerhalb einer Gemeinschaft hinwegtäuschen? In diesem Zuge soll auch auf die Wichtigkeit der Farbe hingewiesen werden: Wie konnte ein bestimmtes Kleidungsstück an Bedeutung gewinnen oder verlieren, indem es seine Farbe änderte? Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der Farbe Gelb zukommen, die als klassische Außenseiter- und Negativfarbe bald die Kleidung eines mittelalterlichen Juden dominierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur sozialen Funktion von Kleidung
- Die soziale Dimension der Farbe
- Die Farbe Gelb
- Genese mittelalterlicher Kleiderordnungen
- Zur Funktion von Kleiderordnungen
- Die soziale Dimension der Farbe
- Marginalisiert und stigmatisiert - Juden im Mittelalter
- Notwendig und unerwünscht - jüdisches Leben am Rande der christlichen Gesellschaft
- Stigma - eine Definition
- Jüdische Kleidung als Stigma
- Stigma-Management
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der identitätsstiftenden Funktion von Kleidung am Beispiel mittelalterlicher Juden. Sie analysiert, wie Kleidung zu einem Stigma-Symbol werden konnte und welche Rolle Kleiderordnungen im Mittelalter spielten.
- Die soziale Funktion von Kleidung im Mittelalter
- Die Bedeutung von Farbe und Symbolen in der Kleiderordnung
- Die Marginalisierung von Juden in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Jüdische Kleidung als Stigma und die Folgen für den Alltag
- Die Macht von Kleiderordnungen und ihre Auswirkungen auf die Identität von Juden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Kleidung und Identität im Mittelalter dar und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Wie wurde Kleidung im Mittelalter zu einem Symbol der Stigmatisierung, insbesondere im Kontext der jüdischen Gemeinschaft?
Kapitel 2 analysiert die soziale Funktion von Kleidung, mit besonderem Fokus auf die Bedeutung von Farbe und Symbolen in der Kleiderordnung. Es wird die Genese mittelalterlicher Kleiderordnungen beleuchtet und deren Normierungsfunktion erklärt.
Kapitel 3 widmet sich der Marginalisierung von Juden im Mittelalter und untersucht, wie Kleidung als Stigma verwendet wurde. Es wird die Definition des Begriffs „Stigma“ erörtert und die Rolle von Kleidung als Stigma im jüdischen Alltag analysiert. Der Abschnitt behandelt auch die Strategien des „Stigma-Managements“.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die soziale Funktion von Kleidung im Mittelalter, die Verwendung von Kleidung als Symbol der Stigmatisierung, insbesondere im Kontext der mittelalterlichen jüdischen Gemeinschaft, die Genese mittelalterlicher Kleiderordnungen und deren Auswirkungen auf den Alltag von Juden.
- Quote paper
- Wiebke Westphal (Author), 2009, Gelbes Rad und Judenhut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177300