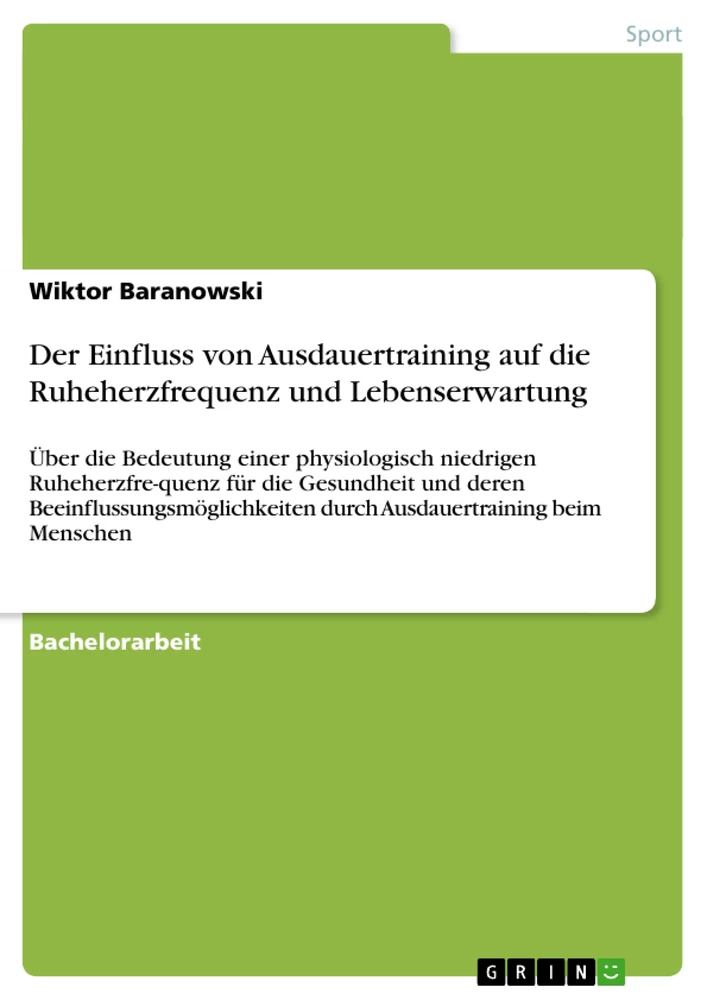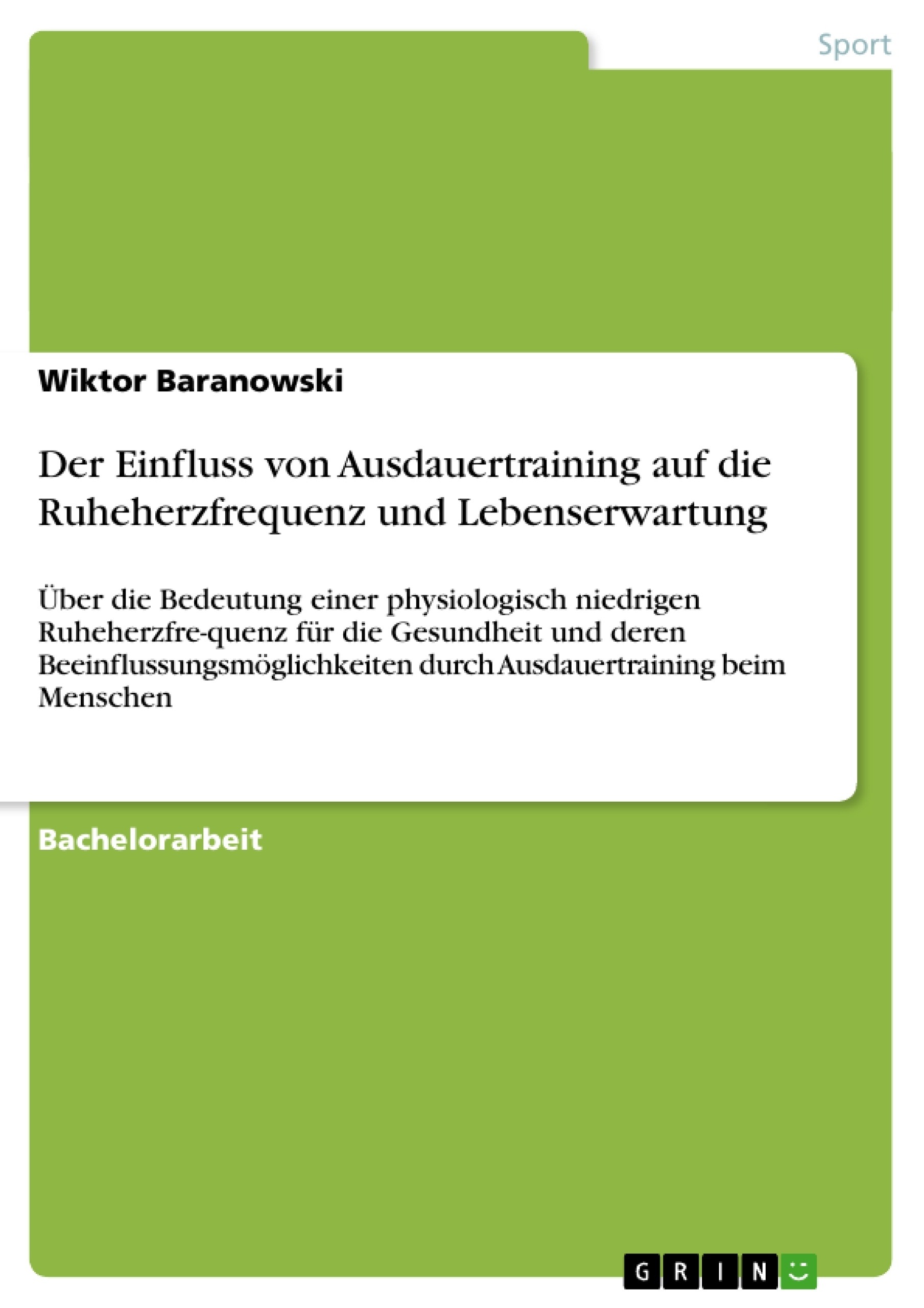Ausgangspunkt dieser Arbeit war die steigende Bedeutungsbeimessung des Ruheherz-frequenzwertes. Wie eingangs auf Basis einer Literaturrecherche gezeigt wurde, diver-gieren die in den aktuellen Lehrbüchern und Leitlinien-Publikationen ausgeschriebenen Herzfrequenz-Normwerte zum Teil stark voneinander und sind unzureichend dokumen-tiert. Dabei ist insbesondere der obere Grenzwert von 100 S/min unbegründet hoch an-gesetzt.
Ausgehend von dieser Erkenntnislage wurden führende epidemiologische Studien der letzten zwei Jahrzehnte nach Evidenzen für den prognostizierenden Aussagewert einer dauerhaft erhöhten Ruheherzfrequenz analysiert. Diesbezüglich wurde dargestellt, dass eine positive Korrelation mit dem Sterblichkeitsrisiko bereits ab Ruheherzfrequenzen von 79 – 84 S/min nachgewiesen wurde. Weiterhin bestätigte sich eine dauerhaft er-höhte Ruheherzfrequenz in diesen Studien auch nach einer Bereinigung für verschie-dene Störvariablen als ein unabhängiger Risikofaktor. Die untersuchte Verbindung konnte unter anderem auch in der allgemeinen gesunden Bevölkerung belegt werden; allerdings erwies sich der Zusammenhang beim weiblichen Geschlecht als weniger konsistent. Angesichts dieser Datenlage ist die Etablierung von sichereren geschlechts-spezifischen Normwert-Obergrenzen angezeigt, die für Männer bei 80-85 S/min und für Frauen, aufgrund der im Allgemeinen etwas höheren Ruheherzfrequenzwerte, bei 85-90 S/min angesetzt werden sollten.
Bezüglich der potentiellen Ursachen für den beobachteten Sterblichkeitsanstieg wird ei-ne zugrundeliegende sympathikotone Dominanz diskutiert, deren Marker möglicher-weise eine erhöhte Herzfrequenz ist. So könnte der Sterblichkeitsanstieg lediglich durch die Vergesellschaftung der Sympathikus-Überaktivität mit vielen weiteren Risikofaktoren erklärt werden. Die pathophysiologische Forschung liefert jedoch weitaus konkretere Belege zu möglichen pathophysiologischen Wirkungsmechanismen, welche der erhöh-ten Ruheherzfrequenz eine direkte Rolle in der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beimessen.
So verhält sich der myokardiale Sauerstoffbedarf proportional zur Schlagzahl, wodurch das Risiko akuter Myokardischämien signifikant steigt. Gleichfalls erhöht sich scher-stressbedingt auch die oxidative Belastung durch freie Radikale. Dieser Vorgang leitet wiederum das Entstehen einer endothelialen Dysfunktion ein und fördert die weitere Progression arteriosklerotischer Veränderungen. [Weiterhin ....]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Der Herzfrequenz Normwert
- 1.1 Normwerte in der Literatur
- 1.2 Probleme und Schwierigkeiten bei der Normwertdefinition der Herzfrequenz
- 1.3 Ansätze von Neudefinitionen der Normherzfrequenz
- 1.4 Zusammenhang zwischen erhöhter Herzfrequenz und Sterblichkeitsrate
- 1.5 Zusammengefasst:
- 2 Anatomisch-physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems
- 2.1 Funktion, Aufbau und Größe des Herzmuskels
- 2.2 Herzeigener Sauerstoff- und Energieverbrauch
- 2.3 Erregungsbildung und -ausbreitung
- 2.4 Einfluss des autonomen Nervensystems
- 2.5 Arbeitsphasen des Herzens
- 2.6 Ausgewählte Parameter der Herzfunktion
- 2.7 Zusammengefasst:
- 3 Adaptationsprozesse an ein Ausdauertraining
- 3.1 Anpassungserscheinungen funktioneller Art
- 3.1.1 Funktionelle Veränderungen
- 3.1.2 Konsequenzen für die Arbeitsweise des Herzens
- 3.2 Anpassungserscheinungen struktureller Art
- 3.2.1 Notwendige Belastungsreize zur Entwicklung eines Sportherzens
- 3.2.2 Dimensionale Veränderungen
- 3.2.3 Konsequenzen für die Arbeitsweise
- 3.3 Zusammengefasst:
- 3.1 Anpassungserscheinungen funktioneller Art
- 4 Pathophysiologische Wirkmechanismen einer erhöhten Herzfrequenz
- 4.1 Myokardischämien
- 4.2 Endotheldysfunktion
- 4.3 Plaquerupturen
- 4.4 Zusammengefasst:
- 5 Diskussion
- 5.1 100 S/min: Ist die Normwertobergrenze und gleichzeitige Definition der Tachykardie noch zeitgemäß?
- 5.2 Ist eine Herzfrequenzsenkung erfolgsversprechend?
- 5.3 Pharmakologische Herzfrequenzsenkung vs. Ausdauertraining
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Ausdauertraining auf die Ruheherzfrequenz und die Lebenserwartung. Ziel ist es, die Bedeutung einer physiologisch niedrigen Ruheherzfrequenz für die Gesundheit und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung durch Ausdauertraining zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den aktuellen Kenntnisstand bezüglich der Normherzfrequenz, die physiologischen Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems und die Anpassungsprozesse an Ausdauertraining.
- Definition und Interpretation der Normherzfrequenz
- Physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems
- Anpassungsprozesse an Ausdauertraining
- Pathophysiologische Mechanismen erhöhter Herzfrequenz
- Ausdauertraining und kardiovaskuläre Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Problematik um die Definition und Interpretation der Ruheherzfrequenz. Sie hebt die Diskrepanzen in der Literatur hervor und betont den Stellenwert des Ausdauertrainings in der Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Zusammenhang zwischen Ausdauertraining, Ruheherzfrequenz und Lebenserwartung zu untersuchen und die Bedeutung körperlicher Aktivität für die kardiovaskuläre Gesundheit herauszustellen.
1 Der Herzfrequenz Normwert: Dieses Kapitel analysiert die Definition des Normwertes der Herzfrequenz. Es zeigt die bestehenden Unstimmigkeiten und unterschiedlichen Angaben in der Fachliteratur auf und diskutiert die Probleme bei der Festlegung eindeutiger Grenzwerte. Der Zusammenhang zwischen erhöhter Herzfrequenz und Sterblichkeit wird ebenfalls beleuchtet, wobei die epidemiologischen Studien und deren Ergebnisse im Fokus stehen. Der Kapitelzusammenfassung werden die verschiedenen in der Literatur angegebenen Normbereiche (z.B. 50-100 bpm, 60-100 bpm, 60-80 bpm) und deren Unterschiede diskutiert. Die Bedeutung der Definition einer klaren und einheitlichen Norm wird betont.
2 Anatomisch-physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktion des Herz-Kreislaufsystems, mit besonderem Fokus auf die Herzfrequenzregulierung. Es erläutert die Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen, den Einfluss des autonomen Nervensystems und die verschiedenen Arbeitsphasen des Herzens. Der Kapitelzusammenfassung umfasst die detaillierte Erklärung der physiologischen Mechanismen, die die Herzfrequenz beeinflussen. Der Fokus liegt auf denjenigen Aspekten, die für das Verständnis der Anpassungsprozesse an Ausdauertraining relevant sind.
3 Adaptationsprozesse an ein Ausdauertraining: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anpassungen des Herz-Kreislaufsystems an Ausdauertraining. Es unterscheidet zwischen funktionellen und strukturellen Veränderungen und beschreibt detailliert die Auswirkungen des Trainings auf die Herzfunktion und -struktur (z.B. vergrößertes Herzvolumen, reduzierte Ruheherzfrequenz). Die Zusammenfassungen erläutern, wie das Ausdauertraining zu diesen Anpassungen führt und welche langfristigen Auswirkungen diese auf die kardiovaskuläre Gesundheit haben. Die Bedeutung adäquater Trainingsreize für die positiven Anpassungen wird ebenfalls thematisiert.
4 Pathophysiologische Wirkmechanismen einer erhöhten Herzfrequenz: Dieses Kapitel beleuchtet die negativen Auswirkungen einer dauerhaft erhöhten Ruheherzfrequenz. Es werden pathophysiologische Mechanismen wie Myokardischämien, Endotheldysfunktion und Plaquerupturen erläutert, die mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen verbunden sind. Der Kapitelzusammenfassung stellt die schädlichen Auswirkungen einer erhöhten Herzfrequenz auf die Herzgesundheit dar und verdeutlicht den Gegensatz zu den positiven Anpassungen durch Ausdauertraining.
Schlüsselwörter
Ruheherzfrequenz, Ausdauertraining, Lebenserwartung, Herz-Kreislauf-System, Adaptation, Pathophysiologie, Myokardischämie, Endotheldysfunktion, Normwert, Tachykardie, Prävention, Rehabilitation, epidemiologische Studien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Ausdauertraining auf die Ruheherzfrequenz und die Lebenserwartung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Ausdauertraining auf die Ruheherzfrequenz und die Lebenserwartung. Sie beleuchtet die Bedeutung einer physiologisch niedrigen Ruheherzfrequenz für die Gesundheit und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung durch Ausdauertraining. Die Arbeit analysiert den aktuellen Kenntnisstand bezüglich der Normherzfrequenz, die physiologischen Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems und die Anpassungsprozesse an Ausdauertraining.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition und Interpretation der Normherzfrequenz, Anatomisch-physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems, Adaptationsprozesse an Ausdauertraining, Pathophysiologische Wirkmechanismen einer erhöhten Herzfrequenz, Diskussion und Zusammenfassung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: Definition und Interpretation der Normherzfrequenz, Physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems, Anpassungsprozesse an Ausdauertraining, Pathophysiologische Mechanismen erhöhter Herzfrequenz und der Zusammenhang zwischen Ausdauertraining und kardiovaskulärer Gesundheit.
Wie wird die Normherzfrequenz definiert und interpretiert?
Das Kapitel "Der Herzfrequenz Normwert" analysiert die Definition des Normwertes der Herzfrequenz und zeigt bestehende Unstimmigkeiten und unterschiedliche Angaben in der Fachliteratur auf. Es diskutiert die Probleme bei der Festlegung eindeutiger Grenzwerte und den Zusammenhang zwischen erhöhter Herzfrequenz und Sterblichkeit.
Welche physiologischen Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems werden behandelt?
Das Kapitel "Anatomisch-physiologische Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems" beschreibt Aufbau und Funktion des Herz-Kreislaufsystems, mit Fokus auf die Herzfrequenzregulierung. Es erläutert Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen, den Einfluss des autonomen Nervensystems und die Arbeitsphasen des Herzens.
Welche Anpassungsprozesse finden durch Ausdauertraining statt?
Das Kapitel "Adaptationsprozesse an ein Ausdauertraining" befasst sich mit den Anpassungen des Herz-Kreislaufsystems an Ausdauertraining. Es unterscheidet zwischen funktionellen und strukturellen Veränderungen und beschreibt die Auswirkungen des Trainings auf Herzfunktion und -struktur (z.B. vergrößertes Herzvolumen, reduzierte Ruheherzfrequenz).
Welche pathophysiologischen Mechanismen einer erhöhten Herzfrequenz werden erläutert?
Das Kapitel "Pathophysiologische Wirkmechanismen einer erhöhten Herzfrequenz" beleuchtet die negativen Auswirkungen einer dauerhaft erhöhten Ruheherzfrequenz. Es werden Mechanismen wie Myokardischämien, Endotheldysfunktion und Plaquerupturen erläutert, die mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen verbunden sind.
Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen der Diskussion?
Die Diskussion befasst sich mit Fragen wie der Aktualität der Normwertobergrenze von 100 Schlägen pro Minute und der Erfolgsaussichten einer Herzfrequenzsenkung. Der Vergleich zwischen pharmakologischer Herzfrequenzsenkung und Ausdauertraining wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ruheherzfrequenz, Ausdauertraining, Lebenserwartung, Herz-Kreislauf-System, Adaptation, Pathophysiologie, Myokardischämie, Endotheldysfunktion, Normwert, Tachykardie, Prävention, Rehabilitation, epidemiologische Studien.
- Quote paper
- Wiktor Baranowski (Author), 2011, Der Einfluss von Ausdauertraining auf die Ruheherzfrequenz und Lebenserwartung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177219