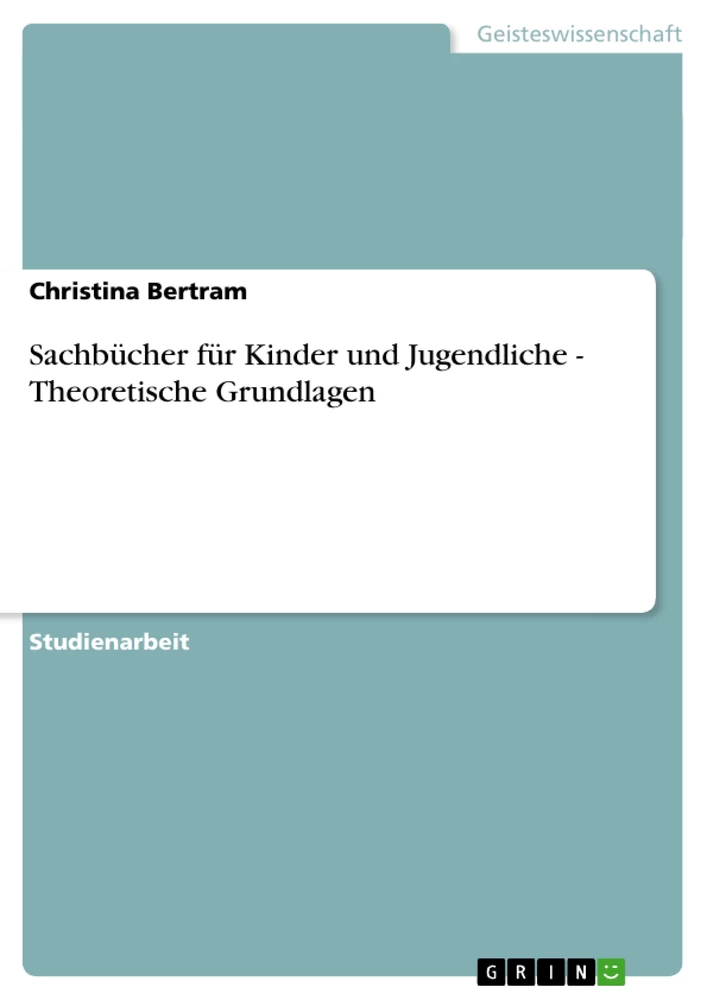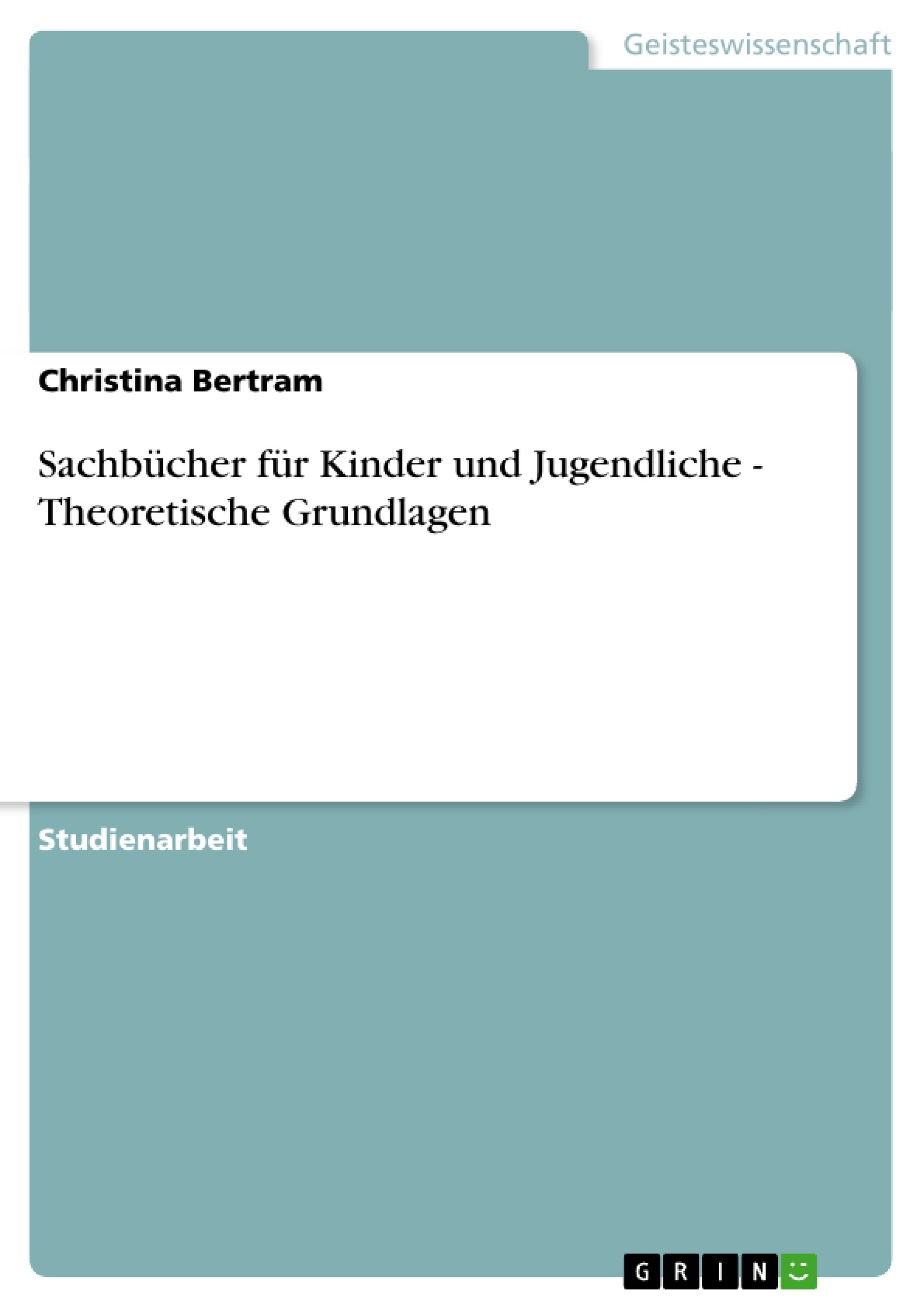Bei meiner ersten Literaturdurchsicht zum Thema „Sachbücher für Kinder und Jugendliche“
bin ich mit einer geradezu unüberschaubaren Vielfalt in den grundlegenden Fragestellungen
der Sachbuchdiskussion konfrontiert worden. Gestoßen bin ich auf unterschiedlichste
Ansätze, den Begriff „Sachbuch“ zu definieren, die Funktionen dieses Literaturtyps zu
bestimmen oder auch verschiedene Formen des Sachbuchs in Typologien zu vereinen und
gleichermaßen zu differenzieren.
Besonders auffällig ist zudem die Multidisziplinarität, mit der diese Fragestellungen
angegangen werden. Denn nicht nur Literaturwissenschaftler wagen eine Annäherung,
sondern auch Erziehungswissenschaftler, Entwicklungspsychologen, Medienexperten, usw..
Eine Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen des Themas halte ich für unabdingbar,
damit meine Kommilitonen in den folgenden Vorträgen den Sachbuchmarkt, wie er sich heute
praktisch darstellt, angemessen und mit einheitlichen Begrifflichkeiten präsentieren können.
Um eine Klärung dieser Grundbegriffe habe ich mich in den Kapiteln 2 bis 4 bemüht.
Kapitel 5 habe ich der Geschichte des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche gewidmet, deren
rückblickende Betrachtung ich für sehr aufschlußreich für die Betrachtung des heutigen
Marktes halte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist ein Sachbuch?
- 2.1. Verschiedene Definitionsansätze
- 2.1.1. Das „Metzler Literaturlexikon“ (1990) zur Definition des Sachbuches
- 2.1.2. Definition von Doderer (1961)
- 2.1.3. Zu den Fähigkeiten eines Sachbuchautors
- 2.1.4. Lexika, Wörterbücher
- 2.2. Zusammenfassung: Charakteristika der Gattung Sachbuch
- 3. Wie unterscheiden sich Sachbücher für Kinder und Jugendliche von solchen für Erwachsene?
- 3.1. Wie sind Sachbücher gestaltet, die speziell den Ansprüchen von Heranwachsenden genügen?
- 3.1.1. Das Prinzip der „Kindgemäßheit“
- 3.1.2. Lesemotivation
- 4. Welche Typen von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche lassen sich unterscheiden?
- 4.1. Das informative und das erzählende Sachbuch
- 4.2. Typologie nach Heinke Martensen (1994)
- 4.2.1. Darstellungsbücher
- 4.2.2. Sachbilderbücher
- 4.2.3. How-to-do-Bücher
- 4.2.4. Lexika
- 5. Die Geschichte des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche
- 5.1. Ideologische Grundbedingungen für den Beginn der Sachbuchproduktion
- 5.2. Das 17. Jahrhundert
- 5.2.1. „Orbis sensualium pictus“ von Comenius
- 5.3. Das 18. Jahrhundert
- 5.3.1. Die Nachahmer des Comenius'
- 5.3.2. Das Werk des Philanthropen Campe
- 5.4. Das 19. Jahrhundert
- 5.5. Das 20. Jahrhundert
- 5.5.1. Die ersten Sachbuchreihen
- 5.5.2. Blütezeit des Sachbuchs nach dem zweiten Weltkrieg
- 5.5.2.1. „Deutscher Jugendbuchpreis“
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit den theoretischen Grundlagen von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, eine Klärung grundlegender Begriffe und Konzepte zu liefern, um den Sachbuchmarkt und seine verschiedenen Ausprägungen besser verstehen zu können. Die Arbeit bietet einen Überblick über verschiedene Definitionsansätze des Sachbuchs, untersucht die Unterschiede zwischen Sachbüchern für Kinder und Jugendliche und solchen für Erwachsene, und klassifiziert verschiedene Sachbuchtypen. Die historische Entwicklung des Genres wird ebenfalls beleuchtet.
- Definition und Charakteristika von Sachbüchern
- Spezifika von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche
- Typologisierung von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche
- Historische Entwicklung des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche
- Relevanz der theoretischen Grundlagen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Komplexität und die interdisziplinäre Natur der Debatte um Sachbücher. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, grundlegende Begriffe zu klären, um den Sachbuchmarkt adäquat zu analysieren. Die Arbeit legt den Fokus auf die Klärung dieser Begriffe in den Kapiteln 2 bis 4 und die historische Entwicklung im Kapitel 5.
2. Was ist ein Sachbuch?: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Definitionen des Sachbuchs, beginnend mit dem „Metzler Literaturlexikon“ und der Definition von Doderer. Es werden unterschiedliche Aspekte beleuchtet, wie die Abgrenzung zur Belletristik und Fachliteratur, sowie die Fähigkeiten, die ein Sachbuchautor idealerweise mitbringen sollte (Wissenschaftler, Lehrer, Journalist).
3. Wie unterscheiden sich Sachbücher für Kinder und Jugendliche von solchen für Erwachsene?: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Gestaltung von Sachbüchern, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten sind. Es analysiert das Prinzip der „Kindgemäßheit“ und die Bedeutung der Lesemotivation bei jungen Lesern. Es wird darauf eingegangen, welche Anpassungen in Bezug auf Sprache, Gestaltung und Inhalt notwendig sind, um junge Leser anzusprechen.
4. Welche Typen von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche lassen sich unterscheiden?: Hier werden verschiedene Typologien von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Die Unterscheidung zwischen informativen und erzählenden Sachbüchern wird erklärt, und es wird eine detaillierte Darstellung der Typologie nach Heinke Martensen (1994) gegeben (Darstellungsbücher, Sachbilderbücher, How-to-do-Bücher, Lexika).
5. Die Geschichte des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche, beginnend mit den ideologischen Voraussetzungen und der Entstehung im 17. Jahrhundert (Comenius’ „Orbis sensualium pictus“). Die Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert wird dargestellt, bevor der Fokus auf die Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt wird. Die Rolle von Preisen wie dem „Deutschen Jugendbuchpreis“ wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Sachbuch, Kinderliteratur, Jugendliteratur, Non-Fiction, Definitionsansätze, Typologie, Kindgemäßheit, Lesemotivation, historische Entwicklung, Comenius, Sachbilderbuch, informatives Sachbuch, erzählendes Sachbuch.
Häufig gestellte Fragen zum Referat: Sachbücher für Kinder und Jugendliche
Was ist der Inhalt dieses Referats?
Das Referat befasst sich umfassend mit Sachbüchern für Kinder und Jugendliche. Es behandelt deren Definition, verschiedene Typen, die Unterschiede zu Büchern für Erwachsene, die historische Entwicklung und die relevanten theoretischen Grundlagen. Es bietet einen Überblick über verschiedene Definitionsansätze, untersucht die Gestaltungsprinzipien für junge Leser und klassifiziert verschiedene Sachbuchtypen anhand bestehender Typologien. Die historische Entwicklung des Genres wird von seinen Anfängen bis zur Nachkriegszeit beleuchtet.
Welche Definitionen von Sachbüchern werden behandelt?
Das Referat analysiert verschiedene Definitionsansätze, darunter die Definitionen aus dem „Metzler Literaturlexikon“ (1990) und die von Doderer (1961). Es werden die Charakteristika der Gattung Sachbuch herausgearbeitet und die Abgrenzung zu Belletristik und Fachliteratur diskutiert. Die Fähigkeiten eines idealen Sachbuchautors werden ebenfalls betrachtet (Wissenschaftler, Lehrer, Journalist).
Wie unterscheiden sich Sachbücher für Kinder und Jugendliche von solchen für Erwachsene?
Der Fokus liegt auf den spezifischen Gestaltungsmerkmalen von Sachbüchern für junge Leser. Das Prinzip der „Kindgemäßheit“ und die Bedeutung der Lesemotivation werden analysiert. Es wird erläutert, welche Anpassungen in Sprache, Gestaltung und Inhalt notwendig sind, um Kinder und Jugendliche anzusprechen.
Welche Arten von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche werden unterschieden?
Das Referat präsentiert verschiedene Typologien. Es unterscheidet zwischen informativen und erzählenden Sachbüchern und beschreibt detailliert die Typologie nach Heinke Martensen (1994), welche Darstellungsbücher, Sachbilderbücher, How-to-do-Bücher und Lexika umfasst.
Wie ist die historische Entwicklung des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche dargestellt?
Die historische Entwicklung wird von den ideologischen Voraussetzungen über die Anfänge im 17. Jahrhundert (mit Comenius' „Orbis sensualium pictus“) bis ins 20. Jahrhundert nachgezeichnet. Die Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert wird ebenso behandelt wie die Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Rolle von Preisen wie dem „Deutschen Jugendbuchpreis“.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Referat behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sachbuch, Kinderliteratur, Jugendliteratur, Non-Fiction, Definitionsansätze, Typologie, Kindgemäßheit, Lesemotivation, historische Entwicklung, Comenius, Sachbilderbuch, informatives Sachbuch und erzählendes Sachbuch.
Welche Kapitel umfasst das Referat?
Das Referat beinhaltet folgende Kapitel: Einleitung, Was ist ein Sachbuch?, Wie unterscheiden sich Sachbücher für Kinder und Jugendliche von solchen für Erwachsene?, Welche Typen von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche lassen sich unterscheiden?, Die Geschichte des Sachbuchs für Kinder und Jugendliche und Resümee. Jedes Kapitel wird im Referat detailliert zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt das Referat?
Das Referat zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen von Sachbüchern für Kinder und Jugendliche zu klären. Es soll ein besseres Verständnis des Sachbuchmarktes und seiner verschiedenen Ausprägungen ermöglichen. Die Relevanz der theoretischen Grundlagen für die Praxis wird ebenfalls betont.
- Quote paper
- Christina Bertram (Author), 2003, Sachbücher für Kinder und Jugendliche - Theoretische Grundlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17707