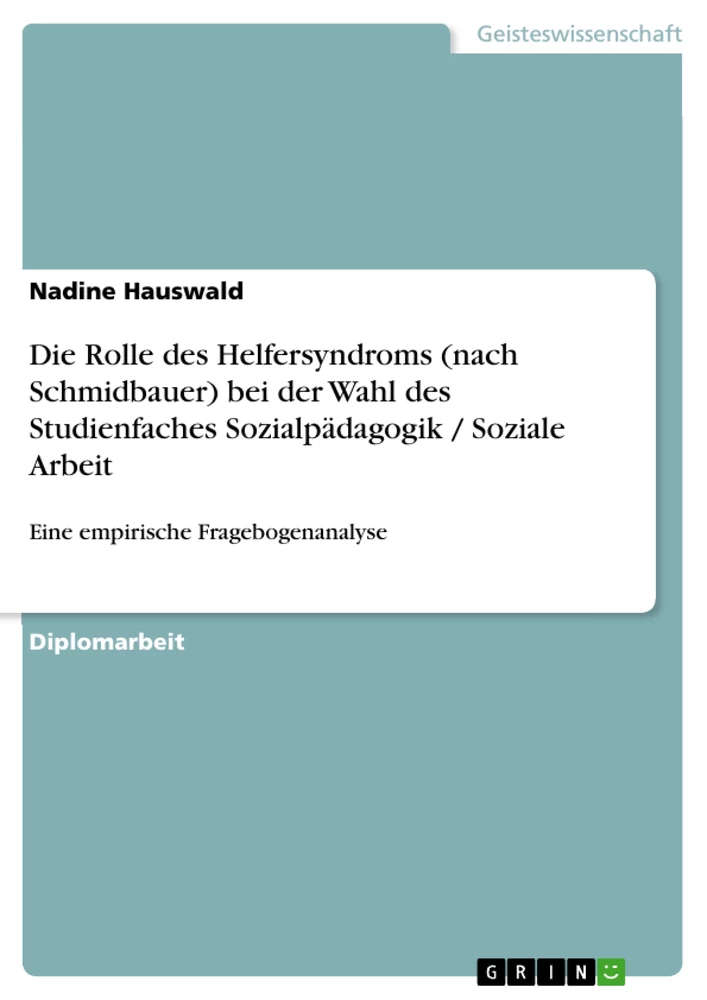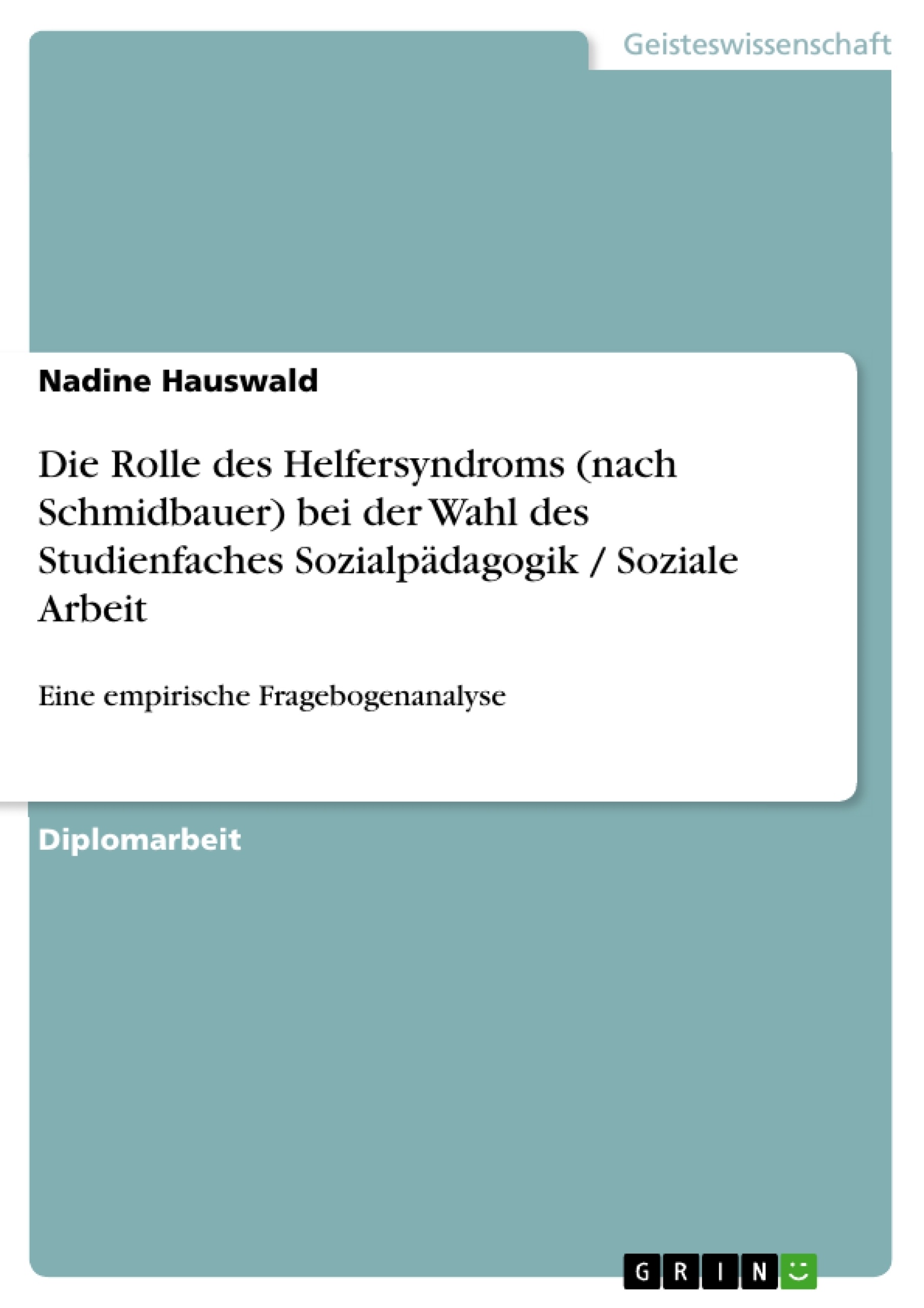[...] In meiner Diplomarbeit möchte ich untersuchen, in wie weit das psychoanalytische Modell und Phänomen „Helfersyndrom“ nach Schmidbauer mit all seinen Verwinklungen tatsächlich und empirisch nachgewiesen auf angehende Sozialpädagogen und Sozialarbeiter zutrifft. (Anmerkung der Verfasserin: ich werde in meiner Arbeit, der Übersicht halber, gänzlich das generische Maskulinum verwenden.) Genauer gesagt beschäftigt mich die Frage: Kann verallgemeinert festgestellt werden, ob aus der Motivation eines in sich schlummernden Helfersyndroms heraus ein Studium der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit (SP / SA) aufgenommen wird und wie genau diese Motivation dann aussieht? Wie sehr unterscheidet sie sich von anderen, fern von Altruismus und der Anthropologie, welche soziales Miteinander als Urform im Kampf des Überlebens zählt und auch fern vom „social-support-Begriff“, der die soziale Unterstützung und Hilfe zwischen Menschen in nichtprofessionellen Beziehungen in ihren alltäglichen Netzwerken beschreibt und die psychische Gesundheit eines jeden unterstützen soll (vgl. Nestmann 1988, S. 19). Bisher existieren nur nachträgliche Feststellungen eines Helfersyndroms von bereits ausübenden Sozialarbeitern / Sozialpädagogen (SP / SA) und zahlreiche Untersuchungen über Motive für ein SP / SA-Studium, die jedoch das Thema des Helfersyndroms nur ungenügend implizieren.
Das Helfersyndrom ist meines Erachtens im Alltagsgebrauch gängig und oberflächlich bekannt. Zudem ist es negativ konnotiert, teilweise wird ihm auch das Etikett des „Klischees aller Sozialberufe“ zugeschrieben, empirisch bestätigt ist das Helfersyndrom jedoch noch nicht. Nachdem ich im ersten Teil meiner Arbeit den Begriff sorgfältig definieren werde, möchte ich in die Tiefe der Kindheit gehen und die Entstehung eines Helfersyndroms (nach Schmidbauer) näher beleuchten. Was bedeutet es, das Helfersyndrom in sich zu tragen, unter welchen Bedingungen entsteht es, in welche Richtungen kann das eigene Leben gelenkt werden und was für Gefahren birgt es? Ich werde die „Helferpersönlichkeit“ (HPSK) nach Schmidbauer eruieren und kritisch hinterfragen, indem ich andere Meinungen heranholen und gegenüberstellen werde.
Um schließlich den Übergang vom Helfersyndrom zu seiner Rolle bei der Studienwahl des Faches SP / SA herzustellen, werde ich die Motive des Helfens untersuchen, die im engeren Sinne bei der Studien- und Berufswahl und im weiteren Sinne über die Berufswahl hinaus für das weiterführende Leben eine [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Helfersyndrom
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.1.1 Entstehung des Helfersyndroms (im weiten Sinne)
- 2.1.2 Ursprung des Helfersyndroms (im engeren Sinne)
- 2.1.3 Helfersyndrom und Gesellschaft
- 2.2 Helfersyndrom und Burn-out-Gefahr
- 2.2.1 Verfestigung des Helfersyndroms
- 2.2.2 Burn-out
- 2.2.3 Prävention und Helfersyndrom-Bewältigung
- 2.3 Kritiker und Befürworter - warum helfen wir?
- 2.3.1 Fengler
- 2.3.2 Richter
- 2.3.3 Fricke / Grauer
- 2.3.4 Missel und Fisher
- 2.3.5 Wellhöfer
- 2.4 Zusammenfassung
- 2.1 Begriffsklärung
- 3. Stand der Forschung
- 3.1 Motivation Helfen
- 3.1.1 Geschichtlicher Rückblick
- 3.1.2 Exkurs: humanistische Herangehensweise
- 3.1.3 Roßrucker
- 3.1.4 Gildemeister
- 3.2 Berufswahl Sozialpädagogik / Soziale Arbeit - quantitative Studien
- 3.2.1 Garlichs
- 3.2.2 Seifert
- 3.2.3 Knüppel
- 3.2.4 Kraak
- 3.2.5 Wirth
- 3.3 Berufswahl Sozialpädagogik / Soziale Arbeit - qualitative Studien
- 3.3.1 Ackermann
- 3.3.2 Groß
- 3.4 Zusammenfassung
- 3.1 Motivation Helfen
- 4. Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit
- 4.1 Theoretische Vorüberlegung
- 4.2 Erhebungsinstrument: Der Online-Fragebogen
- 4.3 Fragestellung und Hypothesenbildung
- 4.4 Operationalisierung
- 4.4.1 Instruktion
- 4.4.2 Sozialstatistische Angaben
- 4.4.3 Motive zur Studienfachwahl
- 4.4.4 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“
- 4.4.5 Begriff Helfersyndrom
- 4.4.6 Kommentare und Kritik
- 4.5 Datenerhebung / Datenaufbereitung
- 4.6 Datenauswertung
- 4.7 Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 4.7.2 Motive für die Studienfachwahl
- 4.7.3 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“
- 4.7.4 Begriff Helfersyndrom
- 4.7.5 Kommentare und Kritik
- 4.7.6 Die „Helferpersönlichkeiten“
- 4.8 Deutung und Interpretation der Ergebnisse
- 4.8.1 Motive für die Studienfachwahl
- 4.8.2 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“ / „Helferpersönlichkeiten“
- 4.8.3 Begriff Helfersyndrom
- 4.9 Hypothesenwiederaufgriff
- 4.10 Resümee
- 5. Fragestellung für weiterführende Untersuchungen und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht empirisch, inwieweit das psychoanalytische Modell des "Helfersyndroms" nach Schmidbauer die Studienwahl von angehenden Sozialpädagogen und Sozialarbeitern beeinflusst. Ziel ist es, herauszufinden, ob und wie stark die Motivation, ein Helfersyndrom zu haben, mit der Entscheidung für ein Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik zusammenhängt.
- Das Helfersyndrom nach Schmidbauer: Begriffsklärung und Entstehung
- Der Einfluss des Helfersyndroms auf die Berufswahl
- Empirische Untersuchung der Motive zur Studienwahl Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Analyse der Ergebnisse und Interpretation im Kontext des Helfersyndroms
- Ableitung von Schlussfolgerungen und Ausblick auf weiterführende Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein: Inwieweit spielt das Helfersyndrom (nach Schmidbauer) eine Rolle bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik/Soziale Arbeit? Die Autorin erläutert ihre Motivation für die Arbeit und den Forschungsansatz. Sie hebt die Notwendigkeit einer empirischen Untersuchung hervor, da bisherige Studien das Helfersyndrom nur unzureichend berücksichtigen. Der Fokus liegt auf der differenzierten Betrachtung der Motive zur Studienwahl im Kontext des Helfersyndroms, abseits von rein altruistischen oder gesellschaftlichen Faktoren.
2. Das Helfersyndrom: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Helfersyndrom" nach Schmidbauer und beleuchtet dessen Entstehung und Auswirkungen. Es werden verschiedene Facetten des Helfersyndroms diskutiert, einschließlich des Risikos von Burn-out. Die Autorin analysiert kritische und befürwortende Positionen zum Helfen und bezieht verschiedene theoretische Ansätze ein. Der zentrale Punkt ist die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses des Helfersyndroms als komplexes psychosoziales Phänomen.
3. Stand der Forschung: Das Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Motivation, Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit zu studieren. Es werden sowohl quantitative als auch qualitative Studien vorgestellt, wobei die Autorin kritisch die Behandlung des Helfersyndroms in diesen Studien bewertet und die Lücken in der Forschung aufzeigt. Dies untermauert die Notwendigkeit der eigenen empirischen Untersuchung.
4. Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, einschließlich der Entwicklung und Durchführung eines Online-Fragebogens. Es werden die Fragestellungen und Hypothesen vorgestellt, die Operationalisierung der Variablen erläutert und der Prozess der Datenanalyse beschrieben. Die Darstellung konzentriert sich auf die methodischen Aspekte der Studie und bereitet den Boden für die Interpretation der Ergebnisse in den folgenden Abschnitten.
Schlüsselwörter
Helfersyndrom, Schmidbauer, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Studienwahlmotivation, Empirische Forschung, Fragebogenanalyse, Berufsmotivation, Altruismus, Burn-out, Qualitative Forschung, Quantitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: "Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit"
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht empirisch den Einfluss des psychoanalytischen Modells des "Helfersyndroms" nach Schmidbauer auf die Studienwahl von angehenden Sozialpädagogen und Sozialarbeitern. Konkret wird der Zusammenhang zwischen der Motivation, ein Helfersyndrom zu haben, und der Entscheidung für ein Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik analysiert.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob und wie stark die Motivation, ein Helfersyndrom zu haben, mit der Entscheidung für ein Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik zusammenhängt. Die Arbeit möchte die Motive zur Studienwahl im Kontext des Helfersyndroms differenziert betrachten, über rein altruistische oder gesellschaftliche Faktoren hinausgehend.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Helfersyndrom, Stand der Forschung, Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik/Soziale Arbeit und Fragestellungen für weiterführende Untersuchungen und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Aspekt, beginnend mit einer Begriffsklärung des Helfersyndroms und einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand, gefolgt von der Beschreibung der eigenen empirischen Untersuchung (Methodik, Ergebnisse, Interpretation) und abschließend einem Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Was wird unter dem "Helfersyndrom" nach Schmidbauer verstanden?
Das Kapitel "Das Helfersyndrom" definiert den Begriff nach Schmidbauer, beleuchtet dessen Entstehung und Auswirkungen, diskutiert verschiedene Facetten, einschließlich des Risikos von Burn-out, und analysiert kritische und befürwortende Positionen zum Thema Helfen unter Einbezug verschiedener theoretischer Ansätze. Es wird ein umfassendes Verständnis des Helfersyndroms als komplexes psychosoziales Phänomen entwickelt.
Wie wird der Stand der Forschung zum Thema dargestellt?
Das Kapitel "Stand der Forschung" gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Motivation, Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit zu studieren. Es werden quantitative und qualitative Studien vorgestellt und kritisch hinsichtlich der Behandlung des Helfersyndroms bewertet. Die Lücken in der Forschung werden aufgezeigt, um die Notwendigkeit der eigenen empirischen Untersuchung zu untermauern.
Welche Methodik wurde in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einem Online-Fragebogen. Das Kapitel beschreibt die Methodik detailliert, einschließlich der Entwicklung und Durchführung des Fragebogens, der Fragestellungen und Hypothesen, der Operationalisierung der Variablen und der Datenanalyse. Der Fokus liegt auf den methodischen Aspekten der Studie.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel "Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik/Soziale Arbeit" dargestellt und im Kontext des Helfersyndroms interpretiert. Die Darstellung konzentriert sich auf die Motive zur Studienwahl, die Ergebnisse des "Helfersyndrom-Persönlichkeitstests" und die Interpretation der "Helferpersönlichkeiten".
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, zieht Schlussfolgerungen und formuliert Fragestellungen für weiterführende Untersuchungen. Es wird ein Ausblick auf zukünftige Forschung gegeben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Studie?
Die Schlüsselbegriffe sind: Helfersyndrom, Schmidbauer, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Studienwahlmotivation, Empirische Forschung, Fragebogenanalyse, Berufsmotivation, Altruismus, Burn-out, Qualitative Forschung, Quantitative Forschung.
- Quote paper
- Nadine Hauswald (Author), 2011, Die Rolle des Helfersyndroms (nach Schmidbauer) bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176993