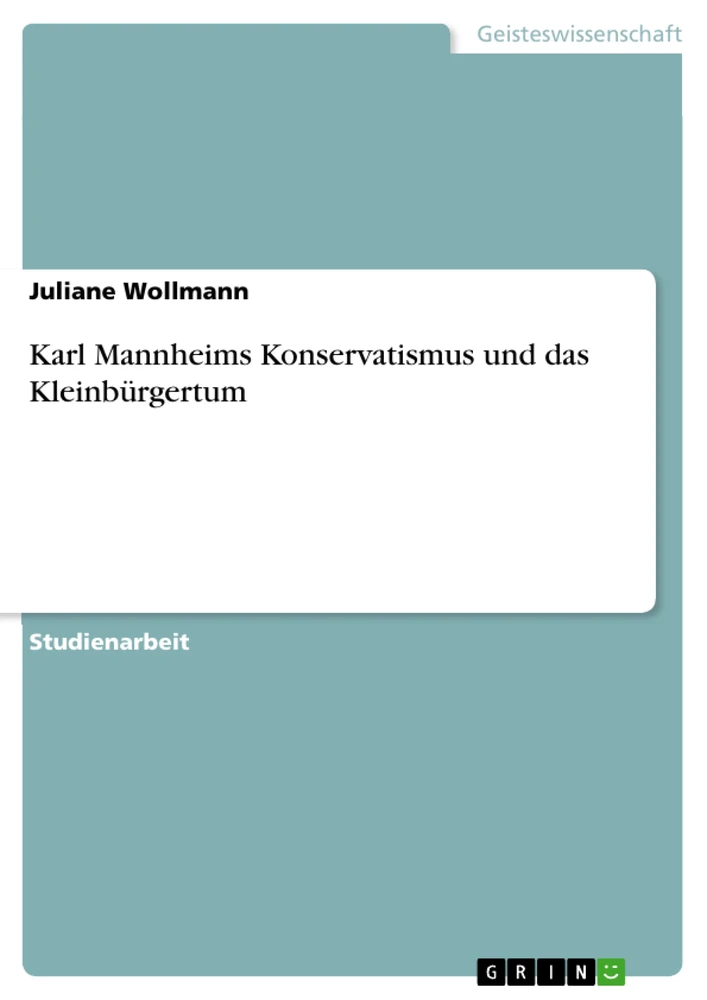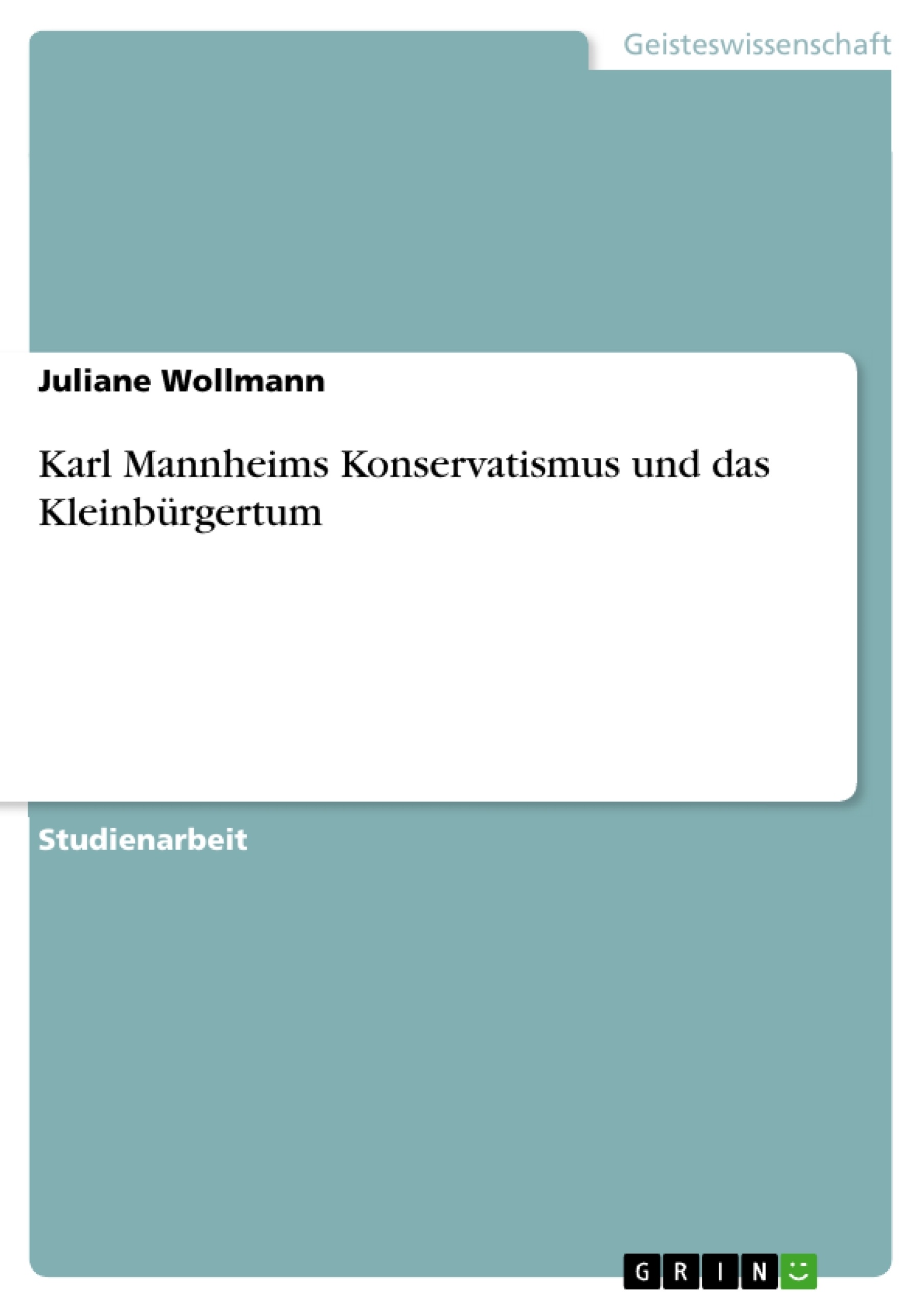Das Kleinbürgertum ist neben dem bürgerlich-humanistischen Milieu der Teil der Mittelschicht, der als konservativ beschrieben wird.
Die Mentalität und der Lebenstil des Kleinbürgertums ist gut erforscht und somit leicht zu identifizieren.
Diese Aussage kann man meines Erachtens über den Konservatismus nicht treffen. Ihm fehlen die einheitlichen Ziele, die für eine Ideologie bezeichnend wären. Auch als politische Richtung ist das in seiner Abhängigkeit von den Umständen der jeweiligen Zeit wenig gleichförmig. Die Gemeinsamkeit besteht im Allgemeinverständnis lediglich in der Verteidigung der jeweils herrschenden Sozialordnung. Zudem ist die Bezeichnung einer Personengruppe als konservativ meist als ein Werturteil zu verstehen.
Eine genaue Umschreibung des Inhalts des Konservatismus ist also nur schwer möglich. Diese Feststellung führte Mannheim dazu, den Konservatismus als Denkstruktur oder Denkart zu beschreiben. Von Interesse sind für ihn dabei nicht die sich wandelnden inhaltlichen Elemente, sondern "... die formalen Bestimmungen dieses Denkens ...".
Hier setzt nun meine Fragestellung an. Wenn das kleinbürgerliche Denken ein konservatives Denken ist, müssen die Eigenarten der kleinbürgerlichen Mentalität auch in dem von Mannheim beschriebenen konservativen Denkstil angelegt sein. Hierbei soll ein Phänomen im kleinbürgerlichen Leben im Zentrum der Betrachtung stehen: die Beschränkung oder besser die Kleinbürgerlichkeit als Lebensstil der Reduktion.
Daher lautet meine These: Das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung ist eine konsequent gelebte Form des durch Mannheim beschrieben konservativen Denkstils. Die Grundlage bildet der Konkretismus -- das konkrete Erleben. Der Konkretismus bildet den konstituierenden Hintergrund sowohl für den Konservatismus (nach Mannheim) als auch für das begrenzte Bewußtsein des Kleinbürgertums.
Ich werde zunächst die kleinbürgerliche Mentalität unter dem Aspekt der Beschränkung und das konservative Denken skizzieren, um dann die konservativen Elemente im kleinbürgerlichen Leben herauszustellen.
Anschließend folgt, um meine These zu belegen, die Betrachtung der Rolle des Konkretismus.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung - ein begrenztes Bewußtsein
- 2.1 Die begrenzte Reichweite
- 2.2 Die begrenzte Wahrnehmung
- 2.3 Das begrenzte Wissen
- 3 Konservatives Denken nach Mannheims wissenssoziologischen Ausführungen
- 3.1 Das konkrete Erleben
- 3.2 Der Eigentumsbegriff
- 3.3 Der Freiheitbegriff
- 3.4 Der Zeitbegriff
- 4 Konservatismus und Kleinbürgertum
- 4.1 Das konservative Denken in der kleinbürgerlichen Mentalität
- 4.2 Der Konkretismus als Hintergrund des beschränkten Bewußtsein des Kleinbürgertums
- 5 Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Verbindung zwischen Karl Mannheims Theorie des konservativen Denkens und der Mentalität des Kleinbürgertums. Das Hauptziel ist es, die These zu belegen, dass das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung eine konsequent gelebte Form des von Mannheim beschriebenen konservativen Denkstils darstellt, basierend auf dem Konzept des Konkretismus.
- Das kleinbürgerliche Bewußtsein und seine Begrenzungen (Reichweite, Wahrnehmung, Wissen)
- Mannheims Theorie des konservativen Denkens als Denkstruktur
- Der Konkretismus als konstituierender Hintergrund sowohl für den Konservatismus als auch für das kleinbürgerliche Bewußtsein
- Die Rolle von Familie, Lokalität und Eigentum in der kleinbürgerlichen Lebenswelt
- Die Bedeutung von Erfahrbarkeit und Alltagstrott im kleinbürgerlichen Leben
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Verbindung zwischen konservativen Denken und kleinbürgerlicher Mentalität in den Mittelpunkt. Sie betont die Schwierigkeit, Konservatismus präzise zu definieren, und greift Mannheims Ansatz auf, Konservatismus als Denkstruktur zu verstehen. Die Arbeit argumentiert, dass die Eigenarten des kleinbürgerlichen Denkens im von Mannheim beschriebenen konservativen Denkstil angelegt sind, wobei die Beschränkung als zentrales Phänomen betrachtet wird. Die These der Arbeit ist, dass das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung eine konsequent gelebte Form des konservativen Denkstils nach Mannheim darstellt, basierend auf dem Konkretismus – dem konkreten Erleben.
2 Das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung - ein begrenztes Bewußtsein: Dieses Kapitel analysiert die kleinbürgerliche Mentalität unter dem Aspekt der Beschränkung. Es definiert die "begrenzte Reichweite" als Fokussierung auf das Nahe, das Vorhandene und Alltägliche, mit Familie, Lokalität und Eigentum als zentralen Bezugspunkten. Die Beschränkung wird nicht nur als wirtschaftliche und soziale, sondern auch als kulturelle Gegebenheit beschrieben, die Geborgenheit und Überschaubarkeit vermittelt. Das Kapitel betont die Bedeutung der Erfahrbarkeit als Kriterium, das die Reichweite begrenzt und das Leben des Kleinbürgers an den Dingen der nächsten Umgebung ausrichtet. Der Kleinbürger reduziert die Welt auf das ihm Bekannte und Erfahrbare, anstatt sich mit größeren Zusammenhängen auseinanderzusetzen.
Schlüsselwörter
Konservatismus, Kleinbürgertum, Karl Mannheim, Wissenssoziologie, Konkretismus, begrenztes Bewußtsein, Beschränkung, Reichweite, Wahrnehmung, Eigentum, Familie, Lokalität, Alltagstrott, Mentalität, Lebensstil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kleinbürgerliches Glück in der Beschränkung - Ein konservativer Denkstil nach Mannheim
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Karl Mannheims Theorie des konservativen Denkens und der Mentalität des Kleinbürgertums. Sie argumentiert, dass das kleinbürgerliche Glück in seiner Beschränkung eine konsequente Ausprägung des von Mannheim beschriebenen konservativen Denkstils darstellt.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These besagt, dass das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung eine konsequent gelebte Form des konservativen Denkstils nach Mannheim ist, basierend auf dem Konzept des Konkretismus (konkretes Erleben).
Welche Aspekte des kleinbürgerlichen Bewusstseins werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Begrenzungen des kleinbürgerlichen Bewusstseins in Bezug auf Reichweite (Fokus auf das Naheliegende), Wahrnehmung (Begrenzung auf das Erfahrbare) und Wissen (Reduktion auf das Bekannte). Familie, Lokalität und Eigentum werden als zentrale Bezugspunkte betrachtet.
Wie wird Mannheims Theorie des konservativen Denkens in die Analyse einbezogen?
Mannheims Wissenssoziologie und sein Ansatz, Konservatismus als Denkstruktur zu verstehen, bilden den theoretischen Rahmen der Arbeit. Der Konkretismus – die Orientierung am konkreten Erleben – wird als konstituierender Hintergrund sowohl für den Konservatismus als auch für das kleinbürgerliche Bewusstsein identifiziert.
Welche Rolle spielt der Konkretismus?
Der Konkretismus, die Fokussierung auf das konkret Erfahrbare und Alltägliche, wird als entscheidender Faktor für das Verständnis sowohl des konservativen Denkens als auch der kleinbürgerlichen Mentalität gesehen. Er erklärt die Beschränkung des Bewusstseins und die Orientierung an Familie, Lokalität und Eigentum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse des kleinbürgerlichen Bewusstseins und seiner Begrenzungen, ein Kapitel zu Mannheims Theorie des konservativen Denkens, ein Kapitel zum Zusammenhang von Konservatismus und Kleinbürgertum und abschließende Schlussbemerkungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konservatismus, Kleinbürgertum, Karl Mannheim, Wissenssoziologie, Konkretismus, begrenztes Bewusstsein, Beschränkung, Reichweite, Wahrnehmung, Eigentum, Familie, Lokalität, Alltagstrott, Mentalität, Lebensstil.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die These zu belegen, dass das kleinbürgerliche Glück in der Beschränkung eine konsequent gelebte Form des von Mannheim beschriebenen konservativen Denkstils darstellt.
- Citar trabajo
- Juliane Wollmann (Autor), 2005, Karl Mannheims Konservatismus und das Kleinbürgertum , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176977