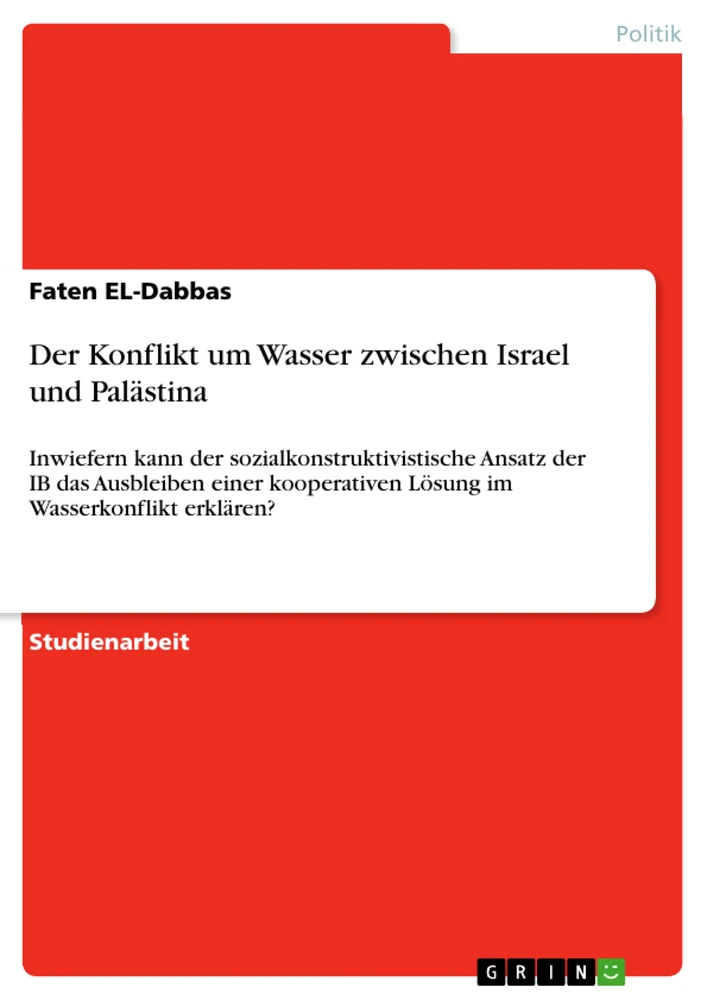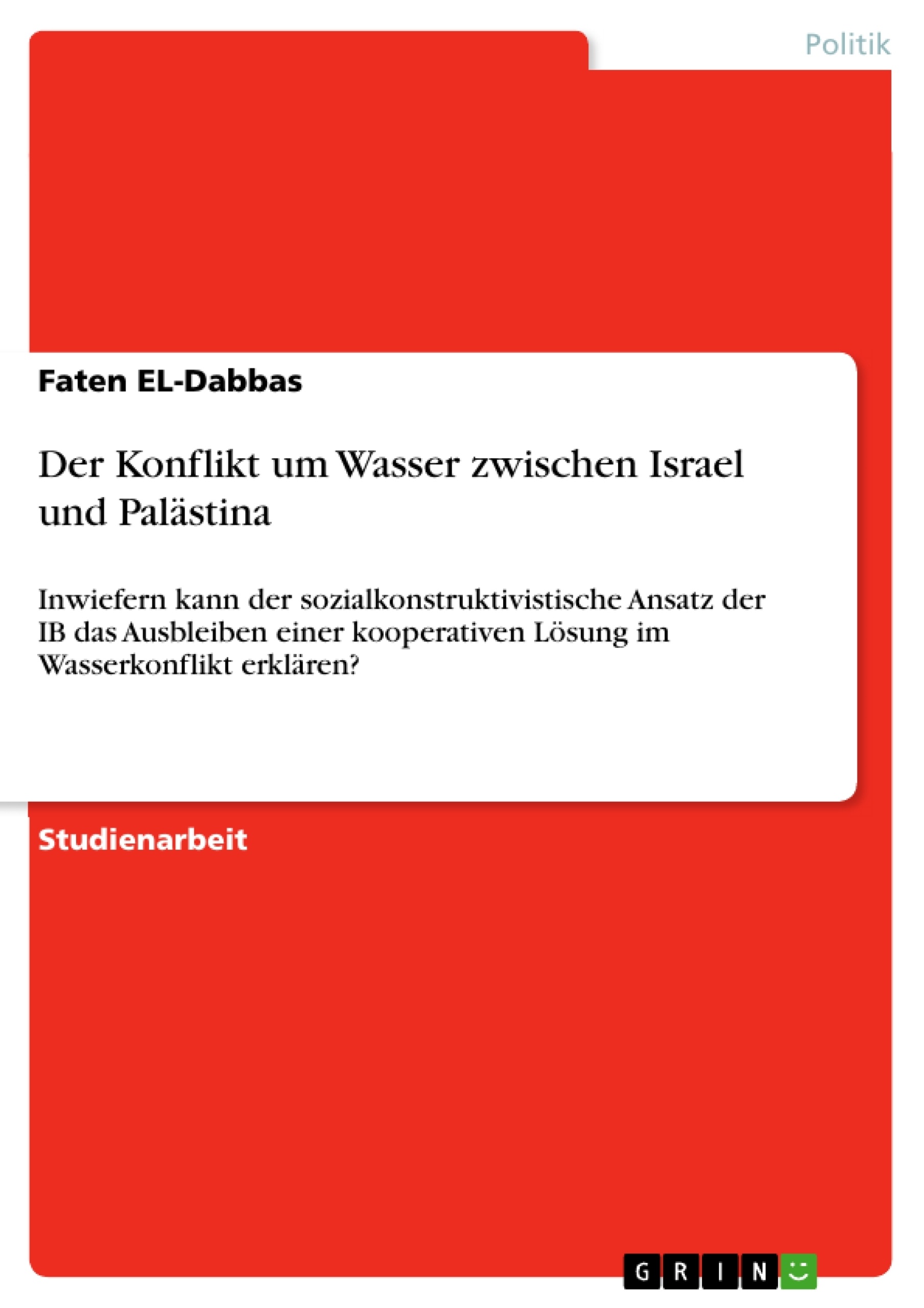Der Nahe Osten ist als Konfliktherd bekannt. Als eine der wasserärmsten Regionen der Welt wird die Lage im Nahen Osten immer mehr durch den Wassermangel aufgeheizt. Wasser findet als „blood flowing through the arteries of the nation“ vor allem in Israel und Palästina seine Entsprechung. Das semi-aride Klima in der Region zeichnet sich durch heiße, trockene Sommer und einer feuchten Winterzeit aus. Die Schwankungen der Niederschlagsmengen zwischen den regenreichen Winter- und den regenarmen Sommermonaten einerseits, und zwischen den unterdurchschnittlichen Jahresniederschlagsmengen andererseits, stellen für die Wasserversorgung der Länder einen erschwerenden Faktor dar. Dieser „chronische Wassermangel“ wird durch eine immer zunehmendere Bevölkerung verschärft und führte bereits in der Vergangenheit zu Kriegen. Eine Lösung des Wasserkonflikts muss im Interesse beider Länder sein. Doch mit Beginn des Oslo-Prozesses hat es keinen Wandel, noch Aussicht auf Veränderung der Wasserversteilung gegeben. Zwar haben die Palästinenser inzwischen das Recht, die Wasserversorgung in vereinbarten Gebieten selbst zu verwalten, doch ist diese Souveränität sehr begrenzt und eine endgültige Klärung dieses Streitpunkts wurde seitens Israels auf Endstatushandlungen verschoben. Angesichts dessen drängt sich die Frage auf, weshalb es nicht zu einer Lösung des Wasserkonflikts kommt, wenn beide Länder akut von dem Mangel betroffen sind? Der sozialkonstruktivistische Ansatz der Internationalen Beziehungen soll zur Beantwortung dieser Frage herangezogen werden. Er stellt Normen, Identitäten und Wertvorstellungen in den Mittelpunkt, auf deren Basis die Staaten miteinander agieren oder eben nicht, wenn diese Basis wegfällt. Wasser steht im gemeinsamen Interesse beider Länder, die sich aber aufgrund gegensätzlicher Werte und tiefer gehenden Konflikten verfeindet gegenüber stehen. Die zentrale Frage dieser Arbeit ist daher: Inwiefern kann der sozialkonstruktivistische Ansatz der IB das Ausbleiben einer kooperativen Lösung im Wasserkonflikt erklären? Im ersten Teil werden die Grundannahmen des Sozialkonstruktivismus vorgestellt und die ungleiche Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina beleuchtet. Der zweite Teil befasst sich mit der Analyse ausgewählter Faktoren, welche die israelisch-palästinensische Beziehung prägen. Mit den daraus gefolgerten Schlüssen wird im dritten Teil die zentrale Fragestellung beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der sozialkonstruktivistische Ansatz
- 3. Die natürlichen Wasserressourcen in der Region des Jordanbeckens
- 4. Die Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina
- 5. Konfliktanalyse
- 5.1 Zionismus vs. panarabischer bzw. palästinensischer Nationalismus
- 5.2 Jerusalem
- 5.3 Autonomie, Grenzen, Rückkehrrecht - Weitere kompromisslose Konflikte
- 5.4 Israelis und Palästinenser - Heterogene Gesellschaften
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern der sozialkonstruktivistische Ansatz in der Internationalen Beziehungen das Ausbleiben einer kooperativen Lösung im Wasserkonflikt zwischen Israel und Palästina erklären kann. Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Auswirkungen gegensätzlicher Normen, Identitäten und Wertvorstellungen auf die Kooperation im Kontext von knappen Wasserressourcen.
- Der sozialkonstruktivistische Ansatz in der internationalen Politik
- Die hydrologischen Gegebenheiten und die Wasserverteilung im Jordanbecken
- Der Einfluss von Nationalismus und historischen Konflikten auf die Wasserpolitik
- Die Rolle von Identitäten und Normen im israelisch-palästinensischen Wasserkonflikt
- Die Herausforderungen für eine kooperative Wassermanagementlösung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Wasserkonflikt zwischen Israel und Palästina im Kontext des Nahostkonflikts dar. Sie hebt den chronischen Wassermangel in der Region hervor und verweist auf die fehlende kooperative Lösung trotz des gemeinsamen Interesses an einer gerechten Wasserverteilung. Die Einleitung führt die zentrale Forschungsfrage ein: Inwiefern kann der sozialkonstruktivistische Ansatz das Ausbleiben einer kooperativen Lösung erklären? Der Bezug auf den Oslo-Prozess unterstreicht den anhaltenden Konflikt trotz bestehender Verhandlungen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Vorstellung des sozialkonstruktivistischen Ansatzes, hydrologischer Überblick und Analyse relevanter Faktoren im israelisch-palästinensischen Verhältnis.
2. Der sozialkonstruktivistische Ansatz: Dieses Kapitel präsentiert die Grundannahmen des sozialkonstruktivistischen Ansatzes in den Internationalen Beziehungen. Im Gegensatz zum Realismus und Institutionalismus betont der Sozialkonstruktivismus die Bedeutung von sozial konstruierten Ideen, Interpretationen, Normen, Identitäten und Wertvorstellungen für das Handeln von Staaten. Das Kapitel hebt hervor, dass Interessen nicht vorgegeben sind, sondern durch Selbst- und Fremdbilder gebildet werden. Gemeinsame Werte fördern Kooperation, während gegensätzliche Werte zu Konflikten führen. Die zentrale These ist, dass Anarchie nicht als Unsicherheit durch das Fehlen einer übergeordneten Instanz, sondern als eine spezifische Form sozialer Ordnung verstanden wird, die von der Interaktion zwischen den Staaten abhängt ("Anarchy is what states make of it").
3. Die natürlichen Wasserressourcen in der Region des Jordanbeckens: Das Kapitel gibt einen hydrologischen Überblick über die Wasserressourcen im Jordanbecken, einschließlich Oberflächengewässer (Jordan, Dan, Hasbani, Banias, Yarmuk und See Genezareth) und Grundwasser. Es betont, dass die Verfügungsgewalt über diese Ressourcen nicht nur Israel und Palästina, sondern auch Jordanien, Syrien und den Libanon betrifft. Die Darstellung der Quellflüsse und deren geographische Lage verdeutlicht die Komplexität der Wasserverteilung und die bestehenden territorialen Streitigkeiten, insbesondere bezüglich der von Israel besetzten Golanhöhen. Die quantitativen Angaben zu den durchschnittlichen Abflüssen der einzelnen Flüsse unterstreichen die Knappheit der Wasserressourcen.
4. Die Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina: Dieses Kapitel beleuchtet die ungleiche Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina. Es analysiert die historische Entwicklung und die aktuelle Situation der Wasserrechte beider Parteien. Die Ausführungen verdeutlichen die Diskrepanz zwischen dem Recht der Palästinenser auf Selbstverwaltung der Wasserversorgung in vereinbarten Gebieten und der begrenzten Souveränität in der Praxis. Der Hinweis auf die Verschiebung endgültiger Klärungen auf Endstatushandlungen seitens Israels unterstreicht den anhaltenden Konflikt. Das Kapitel legt den Fokus auf die ungerechte Verteilung und die politische Dimension des Wasserproblems.
Schlüsselwörter
Sozialkonstruktivismus, Internationale Beziehungen, Wasserkonflikt, Israel, Palästina, Jordanbecken, Wasserressourcen, Nationalismus, Kooperation, Konfliktanalyse, Identitäten, Normen, Wertvorstellungen, Anarchie.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Sozialkonstruktivistischer Ansatz und der israelisch-palästinensische Wasserkonflikt
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert den israelisch-palästinensischen Wasserkonflikt unter Anwendung des sozialkonstruktivistischen Ansatzes der Internationalen Beziehungen. Es untersucht, wie gegensätzliche Normen, Identitäten und Wertvorstellungen die Kooperation im Umgang mit knappen Wasserressourcen im Jordanbecken behindern.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern kann der sozialkonstruktivistische Ansatz das Ausbleiben einer kooperativen Lösung im Wasserkonflikt zwischen Israel und Palästina erklären? Das Dokument untersucht die Auswirkungen gegensätzlicher Normen, Identitäten und Wertvorstellungen auf die Kooperation im Kontext knapper Wasserressourcen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der sozialkonstruktivistische Ansatz, Die natürlichen Wasserressourcen in der Region des Jordanbeckens, Die Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina, Konfliktanalyse (inkl. Unterkapitel zu Zionismus vs. Panarabismus/palästinensischer Nationalismus, Jerusalem, Autonomie/Grenzen/Rückkehrrecht und den heterogenen Gesellschaften) und Fazit.
Was ist der sozialkonstruktivistische Ansatz in diesem Kontext?
Der sozialkonstruktivistische Ansatz betont die Bedeutung von sozial konstruierten Ideen, Interpretationen, Normen, Identitäten und Wertvorstellungen für das Handeln von Staaten. Im Gegensatz zu Realismus und Institutionalismus werden Interessen nicht als vorgegeben, sondern als durch Selbst- und Fremdbilder gebildet betrachtet. Gemeinsame Werte fördern Kooperation, gegensätzliche Werte führen zu Konflikten. Anarchie wird als eine spezifische Form sozialer Ordnung verstanden, die von der Interaktion zwischen den Staaten abhängt.
Wie beschreibt das Dokument die hydrologischen Gegebenheiten im Jordanbecken?
Das Dokument bietet einen hydrologischen Überblick über die Wasserressourcen im Jordanbecken, einschließlich Oberflächengewässer (Jordan, Dan, Hasbani, Banias, Yarmuk und See Genezareth) und Grundwasser. Es hebt die Knappheit der Ressourcen und die Komplexität der Wasserverteilung hervor, die durch die Beteiligung von Israel, Palästina, Jordanien, Syrien und dem Libanon gekennzeichnet ist und durch territoriale Streitigkeiten, wie die israelische Besetzung der Golanhöhen, weiter verschärft wird.
Wie wird die Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina dargestellt?
Das Dokument analysiert die ungleiche Wasserverteilung zwischen Israel und Palästina, die historische Entwicklung und die aktuelle Situation der Wasserrechte beider Parteien. Es zeigt die Diskrepanz zwischen dem Recht der Palästinenser auf Selbstverwaltung der Wasserversorgung und der begrenzten Souveränität in der Praxis auf. Die Verschiebung endgültiger Klärungen auf Endstatushandlungen seitens Israels wird als ein Ausdruck des anhaltenden Konflikts hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Nationalismus und historische Konflikte?
Das Dokument hebt die bedeutende Rolle von Nationalismus und historischen Konflikten, insbesondere den Zionismus und den panarabischen/palästinensischen Nationalismus, für die Wasserpolitik hervor. Diese Konflikte beeinflussen die Identitäten und Normen der beteiligten Akteure und tragen maßgeblich zum Ausbleiben einer kooperativen Lösung bei. Der Konflikt um Jerusalem und die Fragen der Autonomie, Grenzen und des Rückkehrrechts werden als besonders konfliktträchtige Themen genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Sozialkonstruktivismus, Internationale Beziehungen, Wasserkonflikt, Israel, Palästina, Jordanbecken, Wasserressourcen, Nationalismus, Kooperation, Konfliktanalyse, Identitäten, Normen, Wertvorstellungen, Anarchie.
Welche Schlussfolgerung zieht das Dokument?
Das Dokument zieht die Schlussfolgerung, dass der sozialkonstruktivistische Ansatz wertvolle Erkenntnisse zur Erklärung des Ausbleibens einer kooperativen Lösung im israelisch-palästinensischen Wasserkonflikt liefert. Die gegensätzlichen Normen, Identitäten und Wertvorstellungen der beteiligten Akteure spielen eine zentrale Rolle für das Scheitern von Kooperationsversuchen.
- Arbeit zitieren
- Faten EL-Dabbas (Autor:in), 2011, Der Konflikt um Wasser zwischen Israel und Palästina, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176943