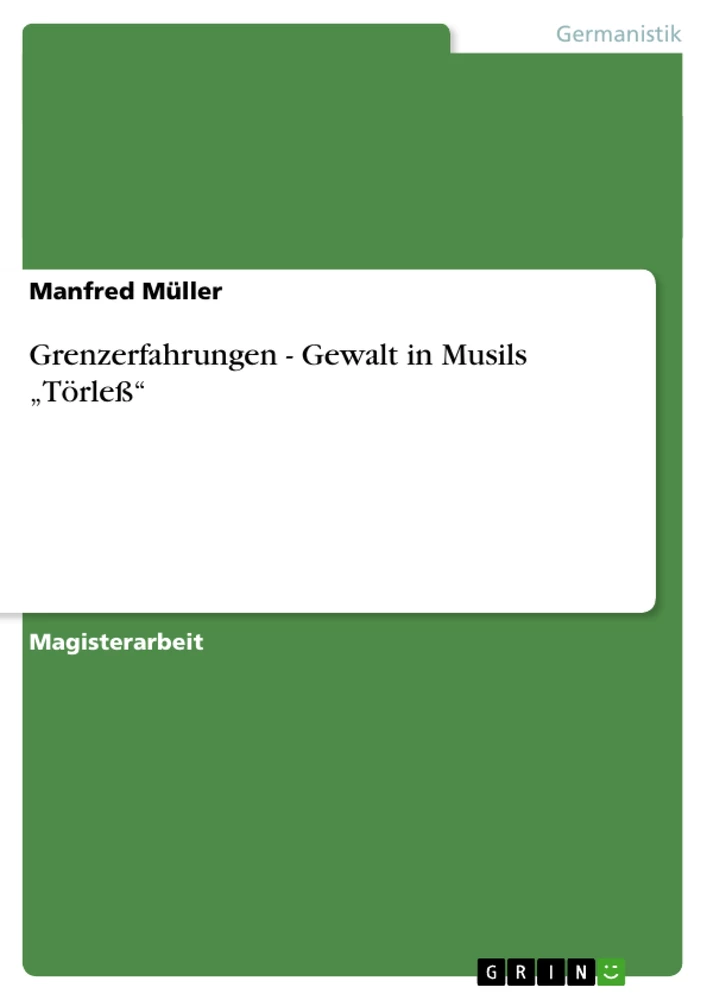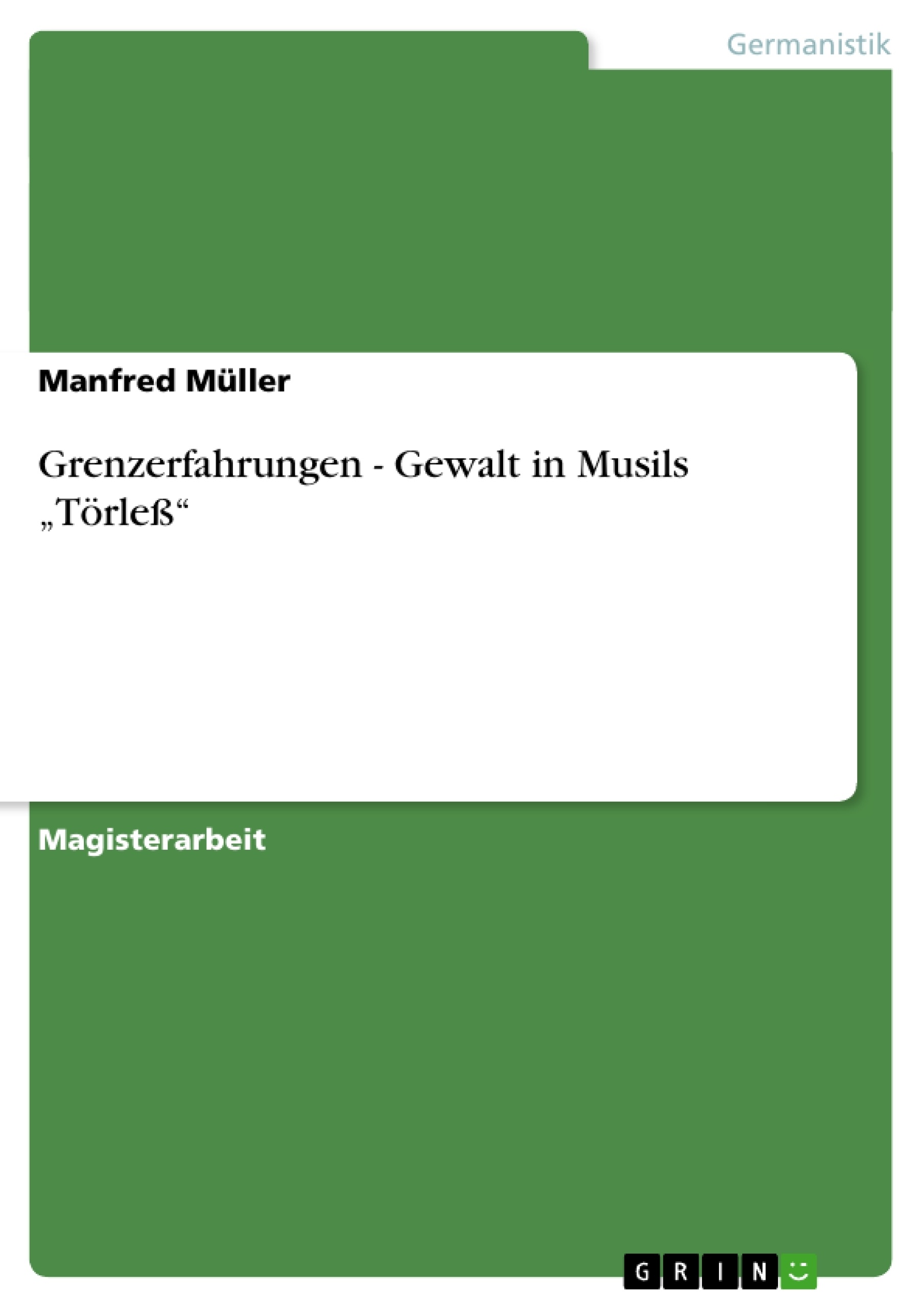Das zentrale Thema, das hier behandelt werden wird, ist die Gewalt, ihre Ausprägung und ihre Darstellung, ihre Wirkung auf die Protagonisten und ihre Stellung im Gesamtkontext.
Aber nicht nur von Gewalt im vordergründigen, physischen Sinne wird die Rede sein, sondern auch von Selbstjustiz, Macht, von Demütigungen und Erniedrigungen, von körperlichen und seelischen Mißhandlungen, von denjenigen, die ausüben, begehen und veranlassen, und von denjenigen, die ertragen (müssen).
Die Wertigkeit des dem anderen Zugefügten wird in ihrer Unterschiedlichkeit deutlich werden, dabei wird es nicht erstaunen, daß die Formen, die auf den ersten Blick ’harmloser’ daherkommen, letztendlich die größeren Wunden reißen.
Verschiedene Motivationen, Ziele und Wege werden aufgezeigt, auch die Reaktionen auf die jeweilige Art der Repression (vor allem aus Richtung Basinis) fallen uneinheitlich aus und sollen deshalb hier genauer analysiert werden.
Ein Schlüsselbegriff des Romans ist der der ’Grenze’.
Es lassen sich Grenzen auf den verschiedensten Ebenen und Gebieten ausmachen: Grenze der Erkenntnis, Grenze der Sprache, Grenze der Moral, Grenze der Toleranz, Grenze zwischen Jugendlichem und Erwachsenem, Grenzen innerhalb der Gesellschaft, Grenze der Pädagogik, Grenze zwischen Bestrafung und Mißhandlung, Grenze der Kontrolle, Grenze innerhalb eines Individuums usw. usw.
Daß auch Wege und Grenzen der Gewalt angesprochen werden, liegt bei dem Thema dieser Arbeit nahe.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Qualitäten und Ausprägungen der Gewalt
- a. Reiting
- b. Beineberg
- c. Törleß
- d. Basini
- e. Božena und die Dorfbewohner
- f. Das Internat und die Schulklasse
- g. Einordnung und Gesamtschau
- Von Gewalt, Macht und Grenzen
- Die Diktatoren in nucleo
- Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Kurzroman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ von Robert Musil mit dem Schwerpunkt auf der Darstellung von Gewalt, Macht und Grenzen. Ziel ist es, die verschiedenen Ausprägungen der Gewalt im Roman aufzuzeigen und deren Wirkung auf die Protagonisten zu untersuchen.
- Darstellung von Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Protagonisten
- Analyse der Grenzen zwischen Jugendlichem und Erwachsenem
- Untersuchung der Grenzen von Moral und Toleranz
- Die Bedeutung der Grenzen innerhalb der Gesellschaft und des Bildungssystems
- Die Rolle von Macht und Selbstjustiz im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit Vorbemerkungen, die den Kontext und den Schwerpunkt der Analyse beleuchten. Es wird deutlich gemacht, dass die Arbeit sich ausschließlich mit „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ beschäftigt und den Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ nicht berücksichtigt. Das zentrale Thema wird als Gewalt, Macht und Grenzen definiert.
Der nächste Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Qualitäten und Ausprägungen der Gewalt im Roman. Dabei werden die Akteure und ihre jeweiligen Motivationen und Handlungen im Detail betrachtet. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Formen der Gewalt, wie sie sich in dem Roman zeigen, sowie auf deren Auswirkungen auf die Protagonisten.
Weitere Abschnitte befassen sich mit den Themen Macht und Grenzen, den „Diktatoren in nucleo“ und schlussendlich mit einem Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ von Robert Musil und analysiert vor allem die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt und deren Auswirkungen auf die Protagonisten. Weitere wichtige Themen sind die Grenzen von Moral und Toleranz, Macht und Selbstjustiz sowie die Darstellung des Spannungsfeldes zwischen Jugendlichem und Erwachsenem im Kontext des Bildungssystems.
- Citar trabajo
- Manfred Müller (Autor), 2000, Grenzerfahrungen - Gewalt in Musils „Törleß“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176770