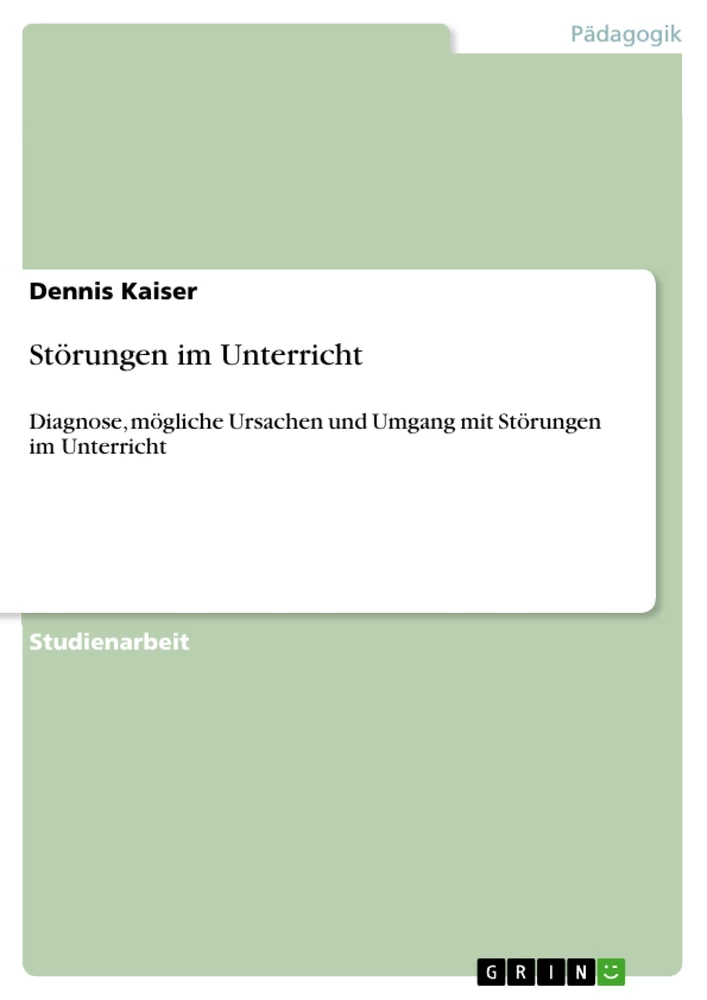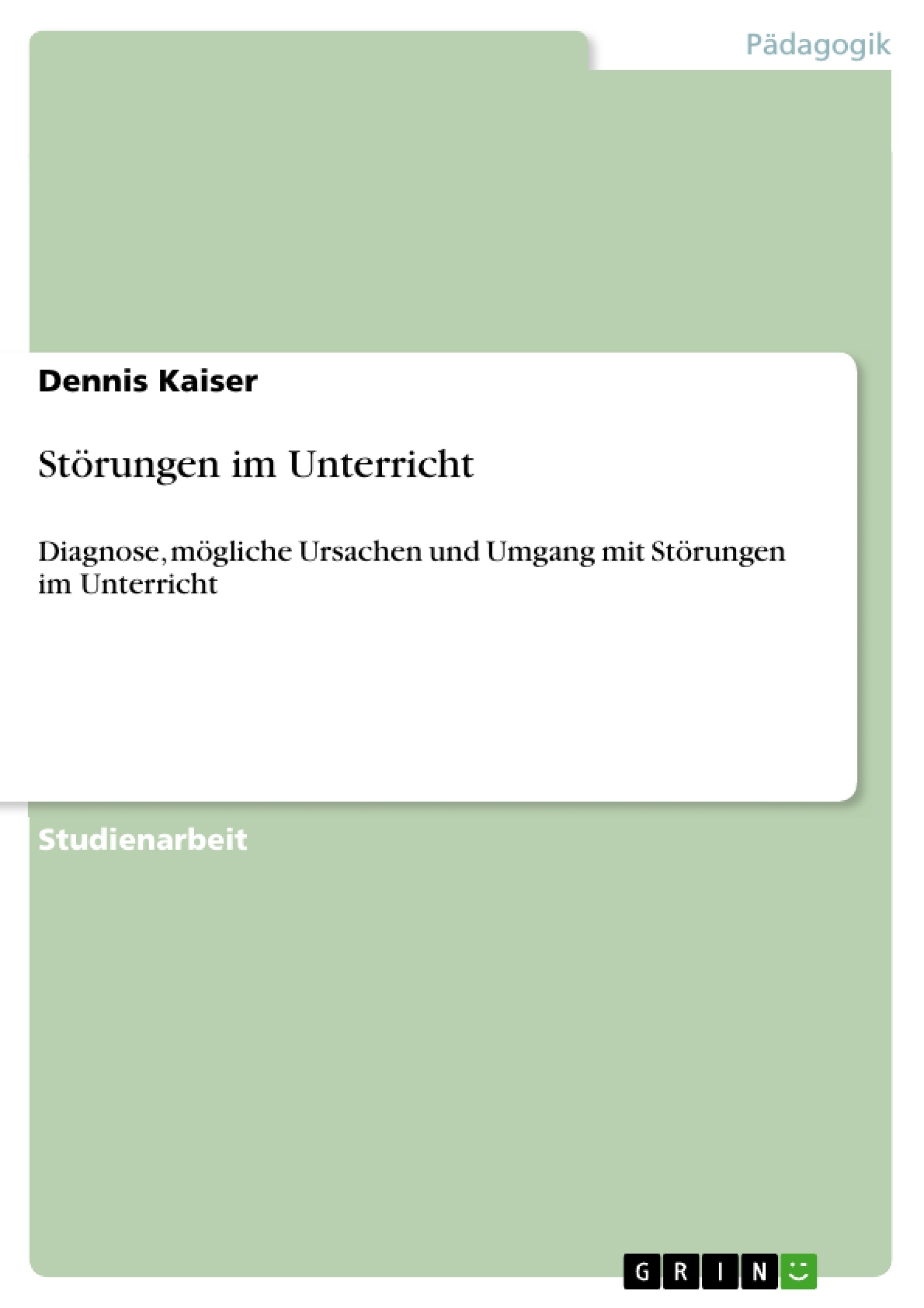„Damit Lehren und Lernen stattfinden können, ist Disziplin notwendig. [...] Unter Disziplin soll eine hilfreiche Ordnung verstanden werden, die gemeinsames und wirksames Lernen ermöglicht (Werning 2010, S.19f). Jegliche Störung des Unterrichts verändert den von der Lehrkraft gewünschten Verlauf. Eine Lehrkraft kann noch so versiert auf ihrem Themengebiet sein, wenn sie nicht weiß, wie mit Unterrichtsstörungen intervenierend und präventiv umgegangen werden muss, wird ein ertragreicher Unterricht beinahe unmöglich. Stichworte wie die Rütli-Schule zeigen, dass heute, neben dem fachlichen Wissen, vor allem die Klassenführung eine unumgänglich benötigte Kompetenz darstellt. Durch Unterrichtsstörungen verstreichen schätzungsweise 35% der schuljährlichen Unterrichtszeit (Werning 2010, S.19). Durch den falschen Umgang mit den Störungen können sich die Situationen in Zukunft sogar noch verschlimmern. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Störungen im Unterricht“. Zunächst wird geklärt, was „Störungen“ in diesem Sinne eigentlich bedeuten. Im Anschluss daran, wird die Fragestellung bearbeitet, wie man als Lehrkraft die Ursachen der Störungen diagnostizieren, und was es für Ursachen geben kann. Zum Abschluss geht es um die Intervention der Störungen, die sich vor allem an der Frage orientiert: Was kann die Lehrkraft tun um bei der Intervention von Störungen nicht das Feindbild Einzelner oder sogar der ganzen Klasse zu werden?
INHALTSVERZEICHNIS
A. EINLEITUNG
B. HAUPTTEIL
1. STÖRUNGEN IM UNTERRICHT
2. Diagnose von Unterrichtsstörungen
3. Mögliche Ursachen für Störungen
4. Umgang mit Unterrichtsstörungen
C. FAZIT
D. LITERATURVERZEICHNIS
A. Einleitung
„Damit Lehren und Lernen stattfinden können, ist Disziplin notwendig. [...] Unter Disziplin soll eine hilfreiche Ordnung verstanden werden, die gemeinsames und wirksames Lernen ermöglicht (Werning 2010, S.19f). Jegliche Störung des Unterrichts verändert den von der Lehrkraft gewünschten Verlauf. Eine Lehrkraft kann noch so versiert auf ihrem Themengebiet sein, wenn sie nicht weiß, wie mit Unterrichtsstörungen intervenierend und präventiv umgegangen werden muss, wird ein ertragreicher Unterricht beinahe unmöglich. Stichworte wie die Rütli-Schule[1] zeigen, dass heute, neben dem fachlichen Wissen, vor allem die Klassenführung eine unumgänglich benötigte Kompetenz darstellt. Durch Unterrichtsstörungen verstreichen schätzungsweise 35% der schuljährlichen Unterrichtszeit (Werning 2010, S.19). Durch den falschen Umgang mit den Störungen können sich die Situationen in Zukunft sogar noch verschlimmern. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Störungen im Unterricht“. Zunächst wird geklärt, was „Störungen“ in diesem Sinne eigentlich bedeuten. Im Anschluss daran, wird die Fragestellung bearbeitet, wie man als Lehrkraft die Ursachen der Störungen diagnostizieren, und was es für Ursachen geben kann. Zum Abschluss geht es um die Intervention der Störungen, die sich vor allem an der Frage orientiert: Was kann die Lehrkraft tun um bei der Intervention von Störungen nicht das Feindbild Einzelner oder sogar der ganzen Klasse zu werden?
B. Hauptteil
1. Störungen im Unterricht
Es ist offensichtlich, dass eine Störung eine Abweichung von einer Norm darstellt. Hierzu muss klar sein, was diese Norm beinhaltet und inwieweit Abweichungen derer, als eine Störung beschrieben werden. Diese Norm beschreibt die eigene Einstellung zum gewünschten Schülerverhalten in bestimmten Unterrichtssituationen. (Beispiel: Dürfen Schüler auch ohne sich zu melden „reinrufen“, wenn sie etwas nicht verstanden haben?) (vgl. Nolting 2010, S.21) Deshalb ist eine eindeutige Definition schwierig. Es gibtjedoch eine Schnittmenge, die vermutlich vonjedem Lehrer als störend empfunden wird. Eine allgemeine Definition ist folgende: „Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz außer Kraft setzen“ (Lohmann 2003, S.12). Hans-Peter Nolting unterscheidet zwischen aktiven und passiven Störungen, sowie Störungen zwischen den Schülern selbst, den Schüler-Schüler-Interaktionsstörungen (vgl. Keller 2010, S.12f). Aktive Störungen werden die meisten wohl am ehesten mit dem Begriff „Störung“ verbinden. Hierzu zählen Situationen die den Unterricht zum gegenwärtigen Zeitpunkt negativ beeinflussen wie zum Beispiel akustische (Schwätzen mit dem Banknachbar) oder motorische Störungen (Herumlaufen) (Nolting 2010, S.21f). Passive Störungen können als „ein Mangel an gewünschten Aktivitäten“ (Nolting 2009, S.12) beschrieben werden. Dazu gehören beispielsweise nicht gemachte Hausaufgaben oder Tagträumerei. Die Schüler-Schüler-Interaktion muss nicht zwingend den laufenden Unterricht stören, jedoch beeinflusst eine Störung unter den Schülern das Klassenklima und so indirekt auch den Unterricht. Ein Beispiel wären hier vor allem „Mobbing“. Störungen die ihre Ursache in Problemen mit der Lehrkraft haben werden hier nicht explizit erwähnt. Dies erscheint stimmig, da diese meist durch eine passive oder aktive Störung in Erscheinung treten.
Zusätzlich zu den genannten Störungen sollten allerdings auch noch Störungen hinzugezogen werden, die nicht von den beteiligten Personen ausgehen. Beispielsweise Bau- oder Verkehrslärm (Nolting 2010, S.23). Diese sind allerdings selten beeinflussbar und werden deshalb in dieser Arbeit nicht weiter erörtert.
2. Diagnose von Unterrichtsstörungen
Tritt eine Störung vermehrt auf und ist die Ursache nicht sofort ersichtlich, kann die Lehrkraft versuchen eine Diagnose zu erstellen. Hierzu ist eine gute Beobachtungsgabe von Nöten. Hans-Peter Nolting zeigt in seinem Buch einige Methoden zur Diagnose auf, von denen einige Gedanken aufgegriffen werden. Er erwähnt dabei nicht explizit, dass diese von ihm einzeln beschriebenen Schritte aufeinander aufbauen. In dieser Arbeit wird dafür plädiert, die Schritte in der gegebenen Reihenfolge zu durchlaufen, da oftmals die Erkenntnisse der vorigen Untersuchung nützlich erscheinen. Es müssen dabei nicht immer alle Schritte durchlaufen werden, da man auch schon früher Erkenntnisse gewinnen kann.
1. Ausführliche Problem- und Situationsbeschreibung
Die Situationen in denen gestört wird werden im Vakuum gesehen, das heißt ohne Hinzuziehung jeglicher Gefühlseindrücke und Wertungen beschrieben (vgl. Nolting 2009, S.109).Vor allem die oben beschriebenen SchülerSchüler-Interaktionsstörungen können hierbei oft schnell diagnostiziert werden. Aber natürlich auch die Beobachtung eines Verhaltens in einer bestimmten Unterrichtssituation bringt schon erste Erkenntnisse, die dann aber vor allem im zweiten Schritt, der Selbstreflexion tiefgründiger bestimmt werden müssen. Diese Analyse stellt die Grundlage für alle weiteren Schritte dar. Kommt man durch diese Analyse nicht von selbst auf den Grund, könnte zunächst das Lehrerkollegium hinzugezogen werden. Sie entdecken durch eine andere Sichtweisen eventuell das Problem (vgl. Nolting 2009, S.111).
2. Selbstreflexion
Wie groß der Anteil des Lehrers an einer Störung sein kann, kann schon anhand eines Selbstversuchs überprüft werden. Jeder weiß noch aus seiner Schulzeit, wie groß die disziplinären Unterschiede der Klassen bei verschiedenen Lehrern waren. Dies zeigt auch die Größe des Handlungsspielraums, die dem Lehrer in dieser Frage zukommt (vgl. Störungen in der Schulklasse S. 20). Gerade aus diesem Grund, stellt die Selbstreflexion in dieser Arbeit die wichtigste Diagnosemöglichkeit dar. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse aus den vorhergegangenen Schritten, das Problem aus der eigenen Perspektive zu beurteilen. Oftmals erhält die Lehrkraft aus der gezielten Beobachtung Hinweise darauf, dass eigentlich nur in bestimmten Unterrichtsszenarien gestört wird. Bei der Selbstreflexion stehen aber natürlich nicht nur Didaktik und Methodik im Vordergrund, sondern auch der Umgang und Tonfall, der den Schülern gegenüber angewandt wird. Gerade auch passive Unterrichtsstörungen haben beispielsweise oftmals etwas mit fehlender Methodenvielfalt im Unterricht zu tun (vgl. Winter 2008, S.12). Leitfragen die Nolting in seiner Veröffentlichung nennt sind: 1. Wie empfinde ich das Problem, warum macht es mir soviel aus? 2. Wie bin ich bisher damit umgegangen? Habe ich durch mein Verhalten möglicherweise zu dem Problem beigetragen? 3. Habe ich ein konkretes Ziel vor Augen, dass ich erreichen möchte? (Nolting 2009, S.113) Weitere Fragen die die Lehrkraft an sich selbst stellen kann, gibt Joachim Bröcher. Diese stellen sich, wenn das Problem nur einzelne Schüler betrifft: War der Unterricht dem Kind angemessen? Bot ich ihm auch ausreichend Gelegenheit, sich in den Unterricht ein[zu]bringen? Entsprach der Unterricht seinem Lerntyp, seinen besonderen Lernvoraussetzungen? Hatte der Jugendliche Mitgestaltungsmöglichkeiten? (Bröcher 2005, S. 140) Nolting schlägt weiter vor, die Klasse einen Fragebogen ausfüllen zu lassen, die Fragen zur Lehrerpersönlichkeit und zum Unterrichtsgeschehen enthalten (vgl. Nolting 2009, S.113f).
3. Perspektivenwechsel
Der nächste durchzuführende Schritt ist der Perspektivenwechsel (vgl. Nolting 2009, S.115, zitiert nach Weinert & Huber (1984), Becker (2006)). Hiermit ist gemeint, dass die Lehrkraft versucht, sich in die Störenden hineinzuversetzen. Hierzu könnte wieder die oben genannte Beschreibung der Situationen behilflich sein. Wichtig hierbei ist, dass auch versucht wird, sich in die Mitschüler, sozusagen das Publikum hineinzuversetzen, da auch sie oftmals einen großen Einfluss auf die Störung haben. Meist werfen die Gedanken in einem Perspektivenwechsel noch mehr Fragen auf, sodass eine Befragung nötig wird (vgl. Nolting 2009. S.115).
4. Befragung
Befragungen können in verschiedenen Variationen stattfinden. Je nach Störfall kann ein Einzelgespräch beziehungsweise ein Gespräch mit der Störgruppe oder auch mit der gesamten Klassengemeinschaft durchgeführt werden (dies darf allerdings keine Anklagebank darstellen! (vgl. Nolting 2009, S.115)). Verschiedene Möglichkeiten der Befragung zeigt Nolting ebenfalls auf. Mündliche Klassenbefragungen könnten zum Beispiel sehr gut durch das „Reporterspiel“ (vgl. Nolting 2009, S.116) durchgeführt werden. Hierbei werden durch die Schüler Fragen notiert („Warum ist es bei uns so laut?“). Aus der Klasse werden nun einige Reporter auserwählt, die die restlichen Schüler, die Passanten, befragen. Die Antworten geben die Diskussionsgrundlage (Nolting 2009, S. 116). Der Vorteil dieser Idee ist sicher, dass die Lehrkraft sich weitestgehend heraushalten kann. Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Befragung ebenso wenig „anonym“ ist wie eine sofortige Diskussion. Zur schriftlichen Befragung nennt Nolting „Multiple-Choice-Fragebögen“ oder eine Art „stille Post“ bei der jeder seine Meinung aufschreibt und die Meinungen dann durch die Lehrkraft oder ausgewählte Schüler ausgewertet werden (Nolting 2009, S.116f). Oftmals ist das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler so gestört, dass eine außenstehende Person die beste Alternative zur Befragung darstellen könnte, beispielsweise durch einen Vertrauenslehrer.
3. Mögliche Ursachen fürStörungen
Wie die Lehrkraft an eine Diagnose kommen kann wurde nun erläutert. Doch was gibt es überhaupt für Gründe, die hinter den Störungen stecken könnten?
Wie weiter oben im Text schon vermerkt, wird in dieser Arbeit großen Wert auf die Einflussmöglichkeit des Lehrers gelegt. Deshalb wird diese mögliche Ursache für eine Störung auch als erstes aufgezeigt. Was könnte die Lehrkraft nun alles falsch machen? Einige Gründe sind Mangel an Normverdeutlichung, eine unfreundliche, nahezu aggressive Art, die fehlende Umsetzung von Konsequenzen die im vornherein angedroht wurden, das Kränken und entmutigen von Schülern und vor allem ein schlechter Unterricht. (vgl. Winkel 2010, S.32). Ein weiterer Grund kann die Überforderung eines Schülers mit dem Lernstoff darstellen (Winter 2008, S.11). Ebenso kann die Schule als Institution, beispielsweise bei zu großen oder schlecht zusammengesetzten Klassen, Schuld an der Störung sein (vgl. Nolting 2009, S.18f). Weitere Gründe für Störungen können Entwicklungsverletzungen in der Kindheit, zum Beispiel durch Misshandlung sein. Zur Kompensation können sich Fehlverhaltensweisen ausbilden. (Winkel 2010, S.29.) Bei älteren Schülern darf auch die Pubertät nicht vernachlässigt werden, die sich bei dem Schüler oftmals durch aggressive oder depressive Stimmung ausdrücken kann. Vor allem im sonderpädagogischen Bereich, aber natürlich auch auf Regelschulen muss beachtet werden, dass auch neurobiologische Ursachen hinter der Störung stecken können. „Zumeist wird [eine Krankheit wie das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom] erst spät entdeckt, was schwere Folgen für das Kind haben kann.“ (LWL-Klinik Marsberg unter www.lwl.org) „Man geht davon aus, dass etwa 3% bis 6% der Schülerinnen und Schüler an ADS leiden“ (Winkel 2010, S.31). Auch die Familie kann Auslöser für Fehlverhalten in der Schule sein. Da in der heutigen Zeit 35 bis 40% (vgl. Winkel 2010, S.31) der Ehen geschieden werden, stellt auch dies einen hohen Belastungsfaktor für das Kind dar. Aber auch Erziehungsfehler der Eltern können die Kinder in Schwierigkeiten bringen (vgl. Winkel 2010, S.31). Es wird offensichtlich, dass das Problem meist im Detail liegt und der Schüler selbst nicht gleich als das Problem angesehen werden darf. Es steckt fast immer mehr hinter der Störung.
4. Umgang mit Unterrichtsstörungen
Was kann die Lehrkraft tun, um das Klassenklima wieder auf ein akzeptables Arbeitsniveau zu heben? „Viele Lehrer werden wegen des Konflikts zwischen den eigenen Intentionen und Bedürfnissen und der offiziellen Rollenfestlegung orientierungslos und gleichgültig. Deshalb greifen sie häufig auf einfach strukturierte Alltagstheorien zurück, um in komplexen unterrichtsgeschehen handlungsfähig zu bleiben“ (Bröcher 2005, S.143). Gerade von diesem Standpunkt sollte sich eine moderne Lehrkraft distanzieren. Es gibt heutzutage andere Möglichkeiten der Intervention als die traditionellen Bestrafungsmethoden wie „Strafarbeit, Nachsitzen oder vor die Türe gehen“. Da durch diese traditionellen Methoden die Lehrer-Schüler-Beziehung eher noch mehr leidet, werden hier vor allem andere Möglichkeiten aufgezeigt.
Es muss akzeptiert werden, dass die Lehrkraft nicht immer alles in der Hand haben kann, es passieren immer unvorhergesehene Dinge (vgl. Bröcher 2005, S.143). So kann eine Störung auch als Bestandteil des Schulgeschehens gesehen werden, was den Umgang eventuell erleichtert.
[...]
[1] Rütli-Schule: Die Schule in Neukölln geriet 2006 in die Schlagzeilen, da das Lehrerkollegium hilfesuchend in einem Brief an die Schulaufsicht gewandt hatte. Sie sahen sich nicht mehr in der Lage, die Gewalt an ihrer Schule ohne fremde Hilfe in denGriff zu bekommen. (vgl. Zeitonline. URL: http://www.zeit.de/online/2006/14/ruetlischule)
- Quote paper
- Dennis Kaiser (Author), 2010, Störungen im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176509