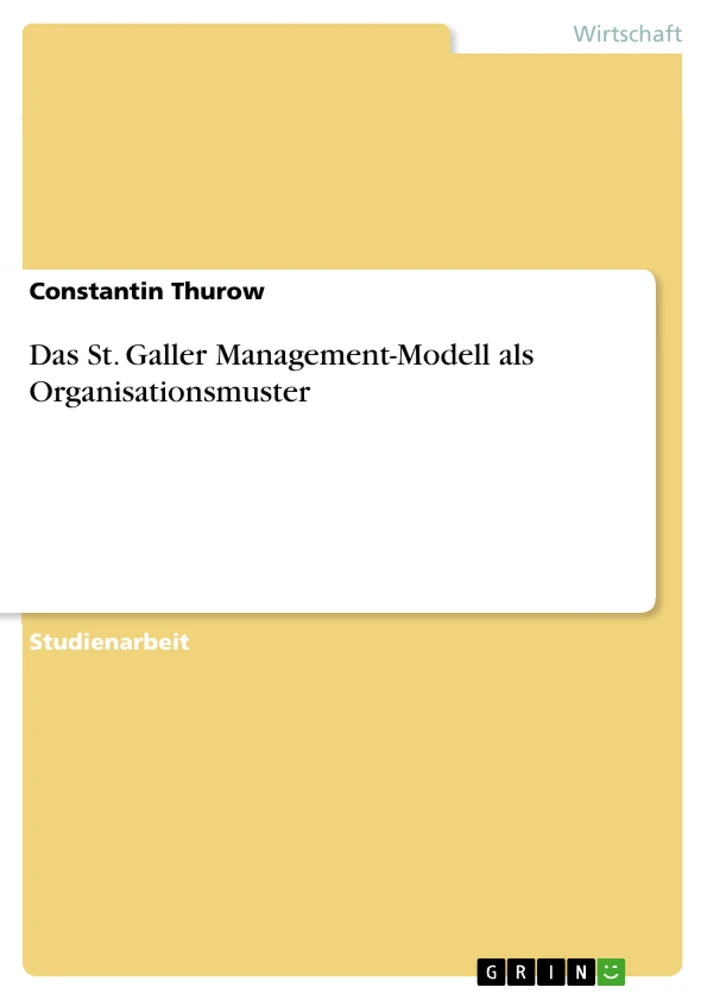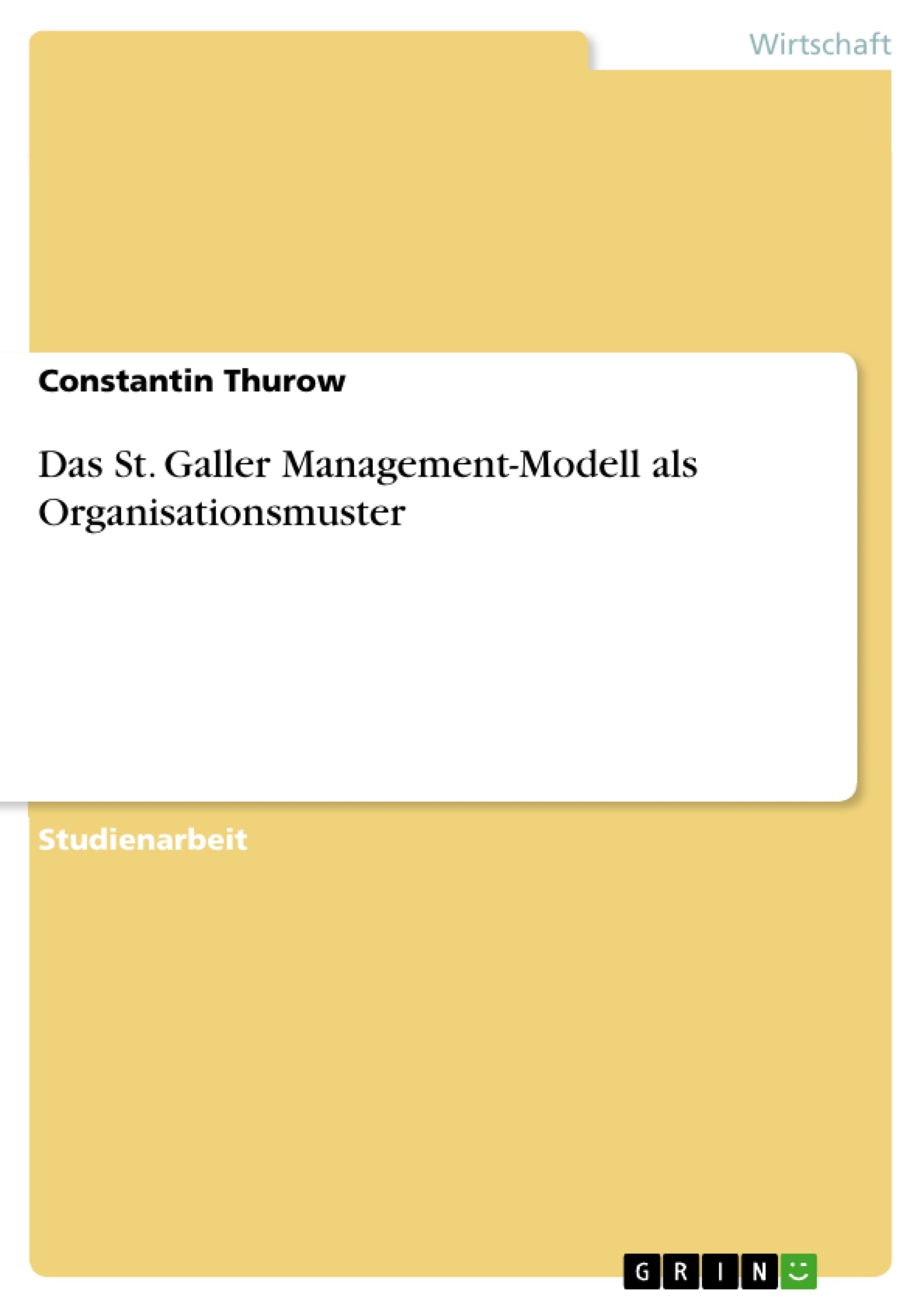Als sich Mitte der Sechziger Jahre eine Arbeitsgruppe am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Hans Ulrich mit dem Ziel, ein allgemeines, ganzheitlich-integratives Modell für das Management komplexer Organisationen zu entwickeln, gründete, bedeutete dies den Anfang eines Konzeptes, das als St. Galler Management-Modell große Bekanntheit erlangte. Anlass für die Ausarbeitung eines neuen Management-Modells war die Vermittlung von Erkenntnissen einer Managementlehre, die auf zuvor am Lehrstuhl entwickelte Ansätze zur Systemtheorie und Kybernetik und deren Anwendung auf Problemstellungen im Management basierte. Ziel war es anhand dieses systemorientierten Managementansatzes einen abstrakten, theoretischen aber dennoch praxisnahen Bezugsrahmen zur Lösung von Führungsproblemen zu entwickeln, der als einen zentralen Aspekt der zunehmenden Komplexität und Dynamik von Austausch- und Einwirkungsprozessen einer Unternehmung mit ihrer Umwelt Rechnung trug. Im Vordergrund stand bei der Ausarbeitung des Modells die Abbildung sachlogischer Zusammenhänge der Realität ohne dabei normative Aussagen über ein konkretes Management-Handeln, das sich in einem stark situationsbedingten Kontext vollzieht, zu geben. Das von Hans Ulrich entwickelte St. Galler Management-Modell, und im gleichnamigen mit Dr. Walter Krieg erstmals 1972 publiziertem Werk, wurde daher auch als „Leerstellengerüst für Sinnvolles“ bezeichnet. Dieses Leerstellengerüst war derart konzipiert, dass es für Ergänzungen und Weiterentwicklungen, den Fortschritt der Lehre einbeziehend, offen stand.
So wurde das St. Galler Management-Modell seit seiner Erstveröffentlichung von verschiedenen Wissenschaftlern aufgrund der sich ergebenen Änderungen in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft modifiziert. Die relevantesten Weiterentwicklungen stammen von Prof. Dr. Dr. Knut Bleicher und Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm. Sie werden als St. Galler Management-Modelle der zweiten beziehungsweise dritten Generation bezeichnet. Sie sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit und werden nach einer kurzen Einführung über den zugrundeliegenden systemtheoretischen Ansatz und einer ausführlichen Betrachtung des Ausgangsmodells von Hans Ulrich behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der systemtheoretische Ansatz
- 3. Das St. Galler Management-Modell nach Ulrich/Krieg..
- 3.1 Das Unternehmensmodell.
- 3.2 Das Führungsmodell
- 3.3 Das Organisationsmodell .
- 4. Das St. Galler Management-Konzept nach Bleicher
- 4.1 Die erste Dimension: Normatives, strategisches und operatives Management
- 4.2 Die zweite Dimension: Aktivitäten, Strukturen und Verhalten
- 4.3 Die dritte Dimension: Die Unternehmensentwicklung.
- 5. Das neue St. Galler Management-Modell nach Rüegg-Stürm..
- 5.1 Die Umweltsphären.
- 5.2 Die Anspruchsgruppen.
- 5.3 Die Interaktionsthemen
- 5.4 Die Ordnungsmomente
- 5.5 Die Prozesse.
- 5.6 Die Entwicklungsmodi..
- 6. Schlussbemerkungen ..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Weiterentwicklung des St. Galler Management-Modells, einem ganzheitlich-integrativen Modell für das Management komplexer Organisationen. Das Modell entstand aus der Systemtheorie und Kybernetik und soll als praxisnaher Bezugsrahmen zur Lösung von Führungsproblemen dienen.
- Der systemtheoretische Ansatz als Grundlage des St. Galler Management-Modells
- Die Entwicklung des St. Galler Management-Modells nach Ulrich/Krieg
- Die Weiterentwicklung des Modells durch Bleicher und Rüegg-Stürm
- Die verschiedenen Dimensionen des Modells (Unternehmensmodell, Führungsmodell, Organisationsmodell)
- Die Bedeutung des Modells für die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel stellt die Entstehung und Entwicklung des St. Galler Management-Modells vor und erläutert die Notwendigkeit eines systemorientierten Managementansatzes angesichts der zunehmenden Komplexität und Dynamik in der Wirtschaft.
- Kapitel 2: Der systemtheoretische Ansatz Dieses Kapitel beleuchtet den systemtheoretischen Ansatz als Grundlage des St. Galler Management-Modells. Es beschreibt die Unternehmung als ein offenes, dynamisches und soziales System, das in ständiger Interaktion mit seiner Umwelt steht.
- Kapitel 3: Das St. Galler Management-Modell nach Ulrich/Krieg Dieses Kapitel analysiert das ursprüngliche St. Galler Management-Modell von Hans Ulrich und Walter Krieg. Es stellt die drei Kernmodelle (Unternehmensmodell, Führungsmodell, Organisationsmodell) vor und erläutert ihre einzelnen Dimensionen.
- Kapitel 4: Das St. Galler Management-Konzept nach Bleicher Dieses Kapitel befasst sich mit der Weiterentwicklung des St. Galler Management-Modells durch Knut Bleicher, die als zweite Generation bezeichnet wird. Es erläutert die drei Dimensionen des Modells: normatives, strategisches und operatives Management; Aktivitäten, Strukturen und Verhalten; sowie die Unternehmensentwicklung.
- Kapitel 5: Das neue St. Galler Management-Modell nach Rüegg-Stürm Dieses Kapitel behandelt die dritte Generation des St. Galler Management-Modells, entwickelt von Johannes Rüegg-Stürm. Es erläutert die sechs zentralen Elemente des Modells: Umweltsphären, Anspruchsgruppen, Interaktionsthemen, Ordnungsmomente, Prozesse und Entwicklungsmodi.
Schlüsselwörter
Systemtheorie, Kybernetik, Management, Organisation, Unternehmensführung, St. Galler Management-Modell, Ulrich/Krieg, Bleicher, Rüegg-Stürm, Umwelt, Anspruchsgruppen, Prozesse, Entwicklung, Führungskräfte, Aus- und Weiterbildung, Komplexität, Dynamik.
- Quote paper
- Constantin Thurow (Author), 2009, Das St. Galler Management-Modell als Organisationsmuster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176471