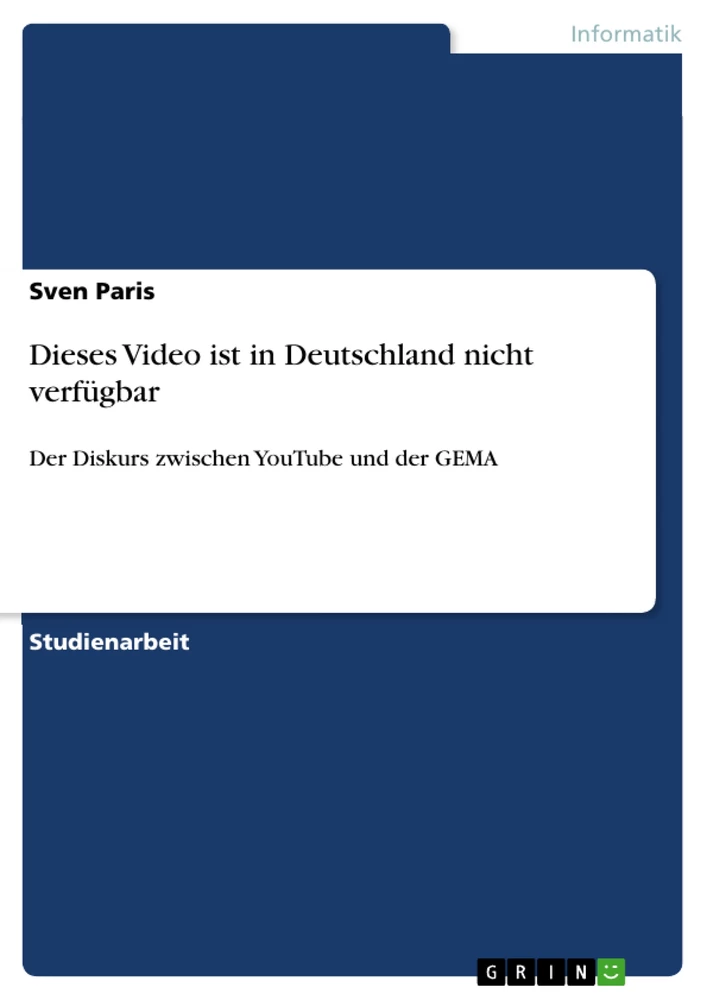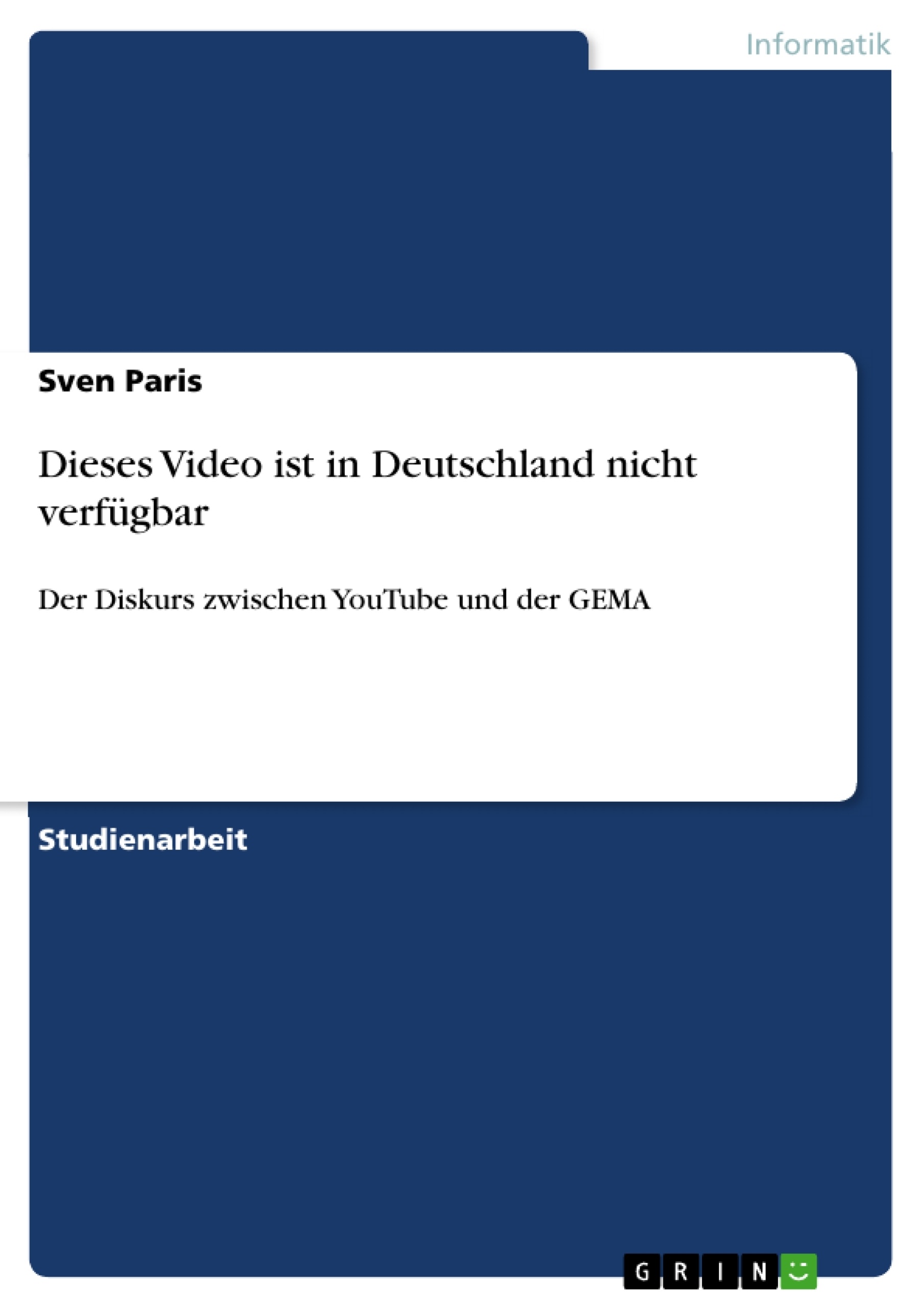Am 19. Juli 2009 erstellte ein User namens "TheKheinz", bürgerlich Kevin Heinz, auf der Videoplattform YouTube einen Account und lud ein Video seiner Hochzeit6 namens "JK Wedding Entrance Dance" hoch. Zu Beginn des Videos erscheint mit weißer Schrift auf orangefarbenem Grund der Titel "Jill and Kevin's Big Day". Ihm folgt in den weiteren 5 Minuten des Videos ein Hochzeitstanz, bei dem alle Beteiligten in ausgelassener Weise vor den Hochzeitsgästen über den Hochzeitsgang tanzen. Die Tanzenden wirken ähnlich amüsiert wie die Hochzeitsgäste, die im Rhythmus der Musik klatschen - einem Song von James Brown namens " Forever". Zum Ende des Videos erscheint die Braut, tanzt ebenfalls vergnügt nach vorne, wird dort vom Bräutigam abgeholt und von ihm die letzten Meter geführt. Unter großem Applaus steht das Paar nun vorne - bereit für die Trauung -, während das Video mit einer Danksagung ausgeblendet wird. Seit dem Upload wurde dieses Video 67.339.056 Mal angesehen. Diese große Aufmerksamkeit führte dazu, dass das gespielte Lied - Chris Browns "Forever" -, welches am 19. April 2008 erschienen war und damit seine Abverkaufs- und Chartphase längst hinter sich hatte, einen zweiten Frühling erlebte. Eine Gewinnsituation für alle Beteiligten: Jill Peterson und Kevin Heinz konnten diesen außergewöhnlichen Moment ihrer Hochzeit mit anderen teilen, Verwerter und Urheber erzielten weitere Erlöse durch die kostenlose Werbung, YouTube konnte seinen Usern gefragten Inhalt bieten, um dadurch ebenfalls weitere Werbeeinnahmen zu generieren und die Nutzer der Videoplattform konnten eine lustige und innovative Vorstellung ansehen. Doch trotz der eigentlich wünschenswerten Situation, ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar. Der Versuch eines Aufrufes aus Deutschland führt zu einer Fehlermeldung. Dieses Konfliktpotential, das in der Vergangenheit immer wieder für Unmut bei den deutschen Nutzern der Videoplattform sorgte, ist Teil eines längeren Diskurses, der medial jüngst wieder in Erscheinung trat und den ich daher nachfolgend analysieren möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Akteure
- 2.1 YouTube
- 2.2 GEMA
- 2.3 Verwerter
- 2.4 Nutzer
- 2.5 Anonymous
- 3 Technik
- 3.1 Streaming
- 3.2 User Generated Content
- 3.3 Geoblocking
- 3.4 Digitalisierung
- 3.5 Breitbandanschlüsse
- 4 Normen
- 4.1 Urheberrecht
- 4.2 GEMA
- 4.3 Digitale Verwertung
- 4.4 Folgen für die Nutzer
- 5 Kommunikation
- 5.1 Der ursprüngliche Konflikt
- 5.2 Der aktuelle Konflikt
- 5.2.1 YouTube
- 5.2.2 Verwerter
- 5.2.3 Anonymous
- 5.2.4 GEMA
- 6 Macht
- 6.1 Definitionsmacht
- 6.2 Verhinderungsmacht
- 6.3 Durchsetzungsmacht
- 7 Ideologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Diskurs zwischen YouTube und der GEMA, der sich über mehrere Jahre erstreckte. Die Analyse zielt darauf ab, diesen Diskurs anhand des TMINK-Schemas (Technik, Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation) zu untersuchen und die verschiedenen Facetten des Konflikts zu beleuchten.
- Der Konflikt zwischen Urheberrecht und der Nutzung von User Generated Content auf Plattformen wie YouTube.
- Die Rolle verschiedener Akteure (YouTube, GEMA, Nutzer, Verwerter).
- Die technischen Aspekte des Streaming und der Digitalisierung im Kontext des Urheberrechts.
- Die Machtstrukturen und deren Einfluss auf den Diskurs.
- Die ideologischen Überzeugungen der beteiligten Parteien.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt des Diskurses zwischen YouTube und der GEMA, beginnend mit dem Hochladen eines Hochzeitsvideos auf YouTube und dessen Folgen. Sie stellt das TMINK-Analyseschema vor, das als Rahmen für die gesamte Analyse dient und die Bedeutung des Konflikts für das Verständnis von Urheberrecht in der digitalen Welt hervorhebt.
2 Akteure: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Akteure im Diskurs vor: YouTube als Plattform, die GEMA als Verwertungsgesellschaft, die Rechteverwerter, die Nutzer der Plattform und die Gruppe Anonymous. Es beschreibt die jeweiligen Interessen und Positionen der Akteure und deren Einfluss auf den Konfliktverlauf. Die Charakterisierung jedes Akteurs liefert ein differenziertes Bild der komplexen Interessenlage.
3 Technik: Das Kapitel beleuchtet die technischen Aspekte, die den Diskurs prägen: Streaming als Technologie der Videoübertragung, User Generated Content als Grundlage von YouTube, Geoblocking als Methode der regionalen Inhaltskontrolle, die allgemeine Digitalisierung und die Bedeutung von Breitbandanschlüssen für die Nutzung von Online-Videos. Die technische Infrastruktur wird als wichtiger Faktor für das Verständnis des Konflikts herausgestellt.
4 Normen: Hier wird der normative Rahmen des Diskurses untersucht, insbesondere das Urheberrecht und die Rolle der GEMA als deren Hüterin. Das Kapitel analysiert, wie die digitale Verwertung von urheberrechtlich geschütztem Material die bestehenden Normen herausfordert und welche Folgen dies für die Nutzer hat. Es wird ein detaillierter Einblick in den Rechtskonflikt gegeben und die unterschiedlichen Interpretationen der bestehenden Gesetzgebung beleuchtet.
5 Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kommunikation der beteiligten Parteien, sowohl im ursprünglichen Konflikt als auch im aktuellen Konflikt. Es analysiert die Strategien und die Art der Kommunikation von YouTube, den Rechteverwertern, Anonymous und der GEMA, um den Konflikt zu verstehen und die wechselseitige Beeinflussung der Kommunikationsstrategien zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Kommunikationsmustern und deren Auswirkungen auf den Diskurs.
6 Macht: Dieses Kapitel untersucht die Machtstrukturen im Diskurs. Es differenziert zwischen Definitionsmacht, Verhinderungsmacht und Durchsetzungsmacht der beteiligten Akteure und analysiert, wie diese Macht ausgeübt wird und welche Auswirkungen dies auf den Konflikt hat. Die Analyse der Machtverhältnisse ist essentiell, um die Dynamik des Diskurses zu verstehen.
7 Ideologie: Das Kapitel untersucht die ideologischen Hintergründe des Konflikts, die jeweiligen Weltanschauungen und Überzeugungen der beteiligten Akteure und wie diese den Diskurs beeinflussen. Die ideologischen Positionen der einzelnen Akteure werden eingehend beleuchtet, um die tieferen Motive hinter den Handlungen und Positionen zu verstehen.
Schlüsselwörter
YouTube, GEMA, Urheberrecht, User Generated Content, Streaming, Digitalisierung, Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation, Konflikt, Digitales Urheberrecht, Online-Videoplattformen, Verwertungsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des YouTube-GEMA-Konflikts
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert den langjährigen Diskurs zwischen YouTube und der GEMA. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Konflikts anhand des TMINK-Schemas (Technik, Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation), um die verschiedenen Facetten des Konflikts umfassend zu beleuchten.
Welche Akteure werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse betrachtet YouTube als Plattform, die GEMA als Verwertungsgesellschaft, die Rechteverwerter, die Nutzer der Plattform und die Gruppe Anonymous. Ihre jeweiligen Interessen und Positionen sowie deren Einfluss auf den Konfliktverlauf werden detailliert beschrieben.
Welche technischen Aspekte werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet Streaming-Technologien, User Generated Content, Geoblocking, die allgemeine Digitalisierung und die Bedeutung von Breitbandanschlüssen für den Konflikt. Die technische Infrastruktur wird als essentieller Faktor für das Verständnis des Konflikts hervorgehoben.
Wie werden die Normen und das Urheberrecht im Kontext des Konflikts untersucht?
Die Analyse untersucht den normativen Rahmen, insbesondere das Urheberrecht und die Rolle der GEMA. Sie analysiert, wie die digitale Verwertung urheberrechtlich geschützten Materials die bestehenden Normen herausfordert und welche Folgen dies für die Nutzer hat. Unterschiedliche Interpretationen der Gesetzgebung werden beleuchtet.
Wie wird die Kommunikation der beteiligten Parteien analysiert?
Die Analyse untersucht die Kommunikationsstrategien von YouTube, den Rechteverwertern, Anonymous und der GEMA im ursprünglichen und aktuellen Konflikt. Der Fokus liegt auf den Kommunikationsmustern und deren Auswirkungen auf den Diskurs und die wechselseitige Beeinflussung.
Welche Machtstrukturen werden im Diskurs untersucht?
Die Analyse differenziert zwischen Definitionsmacht, Verhinderungsmacht und Durchsetzungsmacht der Akteure und untersucht deren Ausübung und Auswirkungen auf den Konflikt. Die Analyse der Machtverhältnisse ist essentiell für das Verständnis der Diskursdynamik.
Wie werden die ideologischen Hintergründe des Konflikts betrachtet?
Die Analyse untersucht die ideologischen Hintergründe, Weltanschauungen und Überzeugungen der Akteure und deren Einfluss auf den Diskurs. Die ideologischen Positionen werden eingehend beleuchtet, um die tieferen Motive hinter Handlungen und Positionen zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: YouTube, GEMA, Urheberrecht, User Generated Content, Streaming, Digitalisierung, Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation, Konflikt, Digitales Urheberrecht, Online-Videoplattformen, Verwertungsgesellschaft.
Wie ist die Analyse strukturiert?
Die Analyse ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Akteure, Technik, Normen, Kommunikation, Macht und Ideologie. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Untersuchung des jeweiligen Aspekts des YouTube-GEMA-Konflikts.
Welche Methode wird für die Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet das TMINK-Schema (Technik, Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation) als analytischen Rahmen, um den komplexen Konflikt strukturiert zu untersuchen.
- Quote paper
- Sven Paris (Author), 2011, Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176146