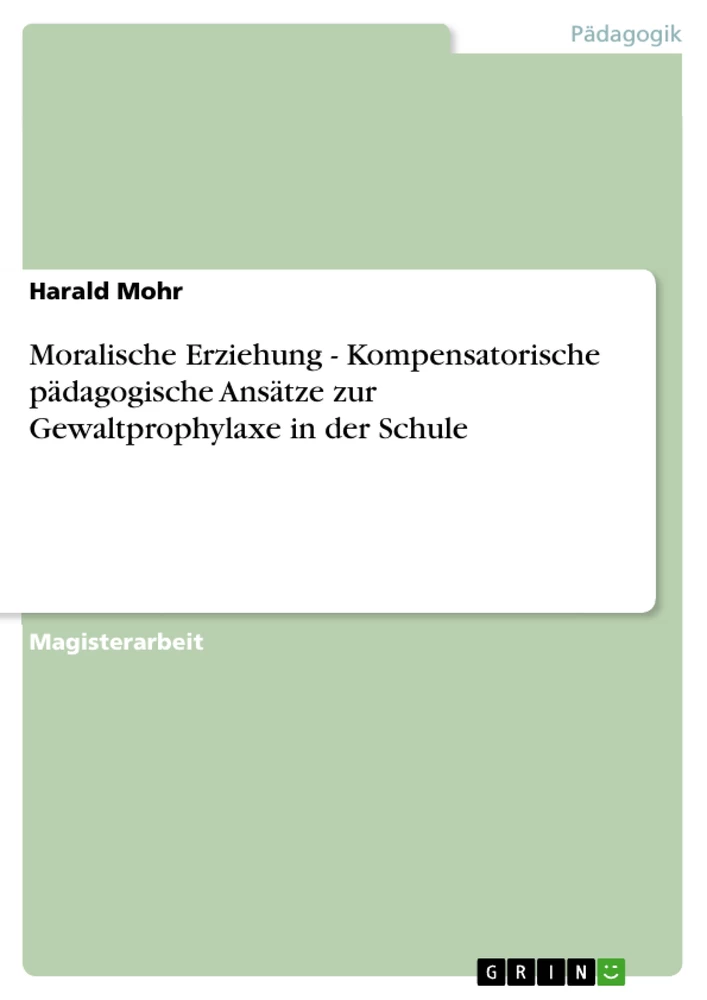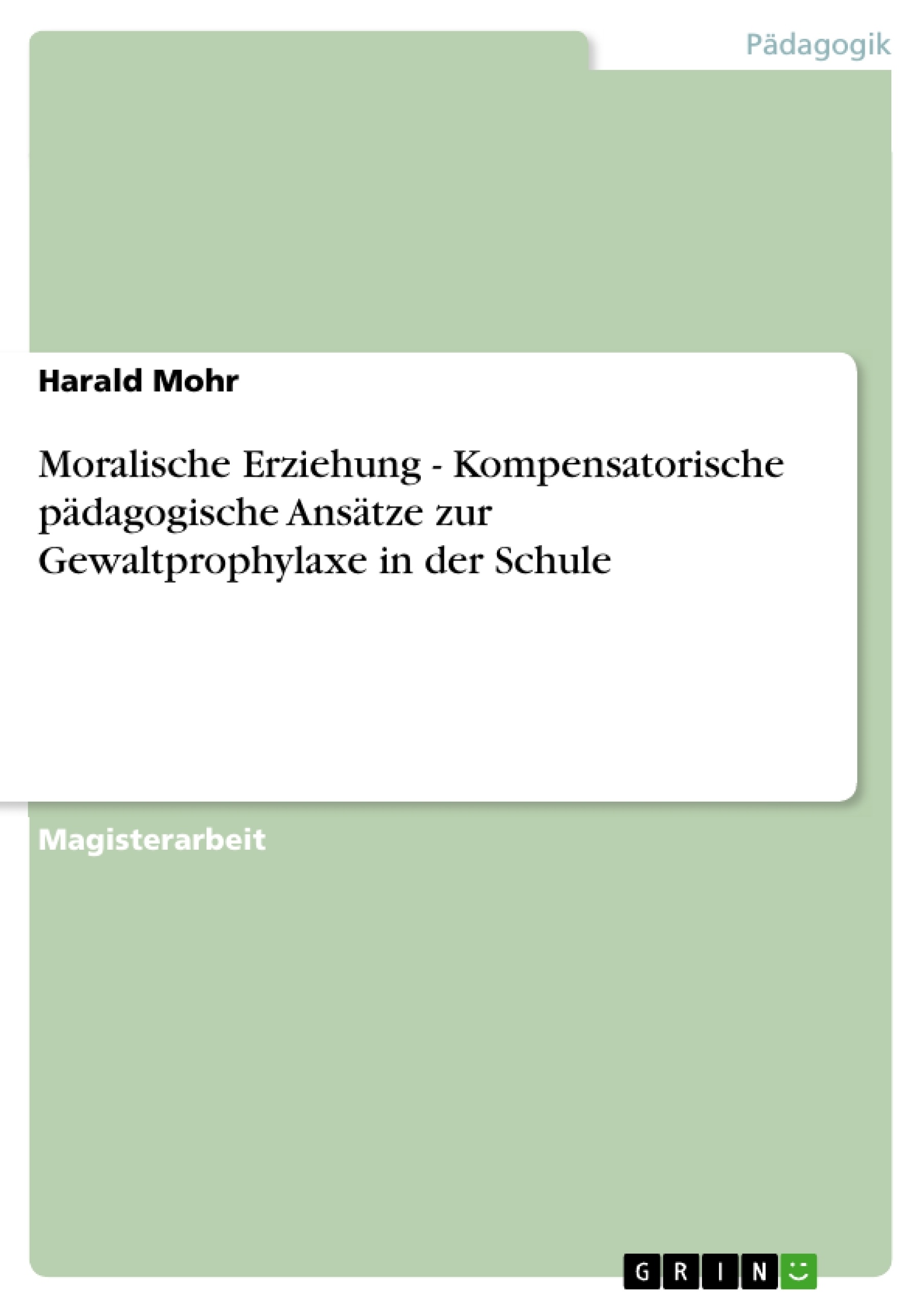Täglich stehen deutsche Schulen vor der Herausforderung, der Gewalt unter Schülern wirksam entgegentreten zu müssen. Denn die Vielfalt der Formen schulischer Gewalt, wie sie im Umgang der Lernenden untereinander zu beobachten ist, beeinträchtigt nicht nur die Ordnung in der Schule in erheblichem Maße, sondern lässt auch ein intaktes soziales Miteinander in der Schule kaum möglich erscheinen, weil ein Teil der Schüler zu Opfern wird, deren Rechte von den gewalttätigen Schülern missachtet werden. In der Regel reagiert der Lehrkörper auf solche Verhaltensweisen mit entsprechenden Sanktionen, wie sie in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer vorgesehen sind. Gemeint sind die in den Länderregelungen fixierten Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, deren Adressaten die gewaltbereiten Schüler sind. Obwohl eine unmittelbare Reaktion in Form von Sanktionen auf Regelverstöße, wie z. B. Gewalthandlungen, unerlässlich ist, um gegenüber den durch Fehlverhalten aufgefallenen Schulkindern zu signalisieren, dass solche Handlungen seitens des Lehrköpers nicht toleriert werden, ist das Problem des in deutschen Schulen auftretenden devianten Verhaltens auf diese Art und Weise jedenfalls längerfristig nicht zu bewältigen. Die gesetzlich festgeschriebenen Sanktionen stellen lediglich eine Gegenwirkung zu der jeweils festgestellten Gewalttat im schulischen Kontext dar. Die Problematik der Gewalt unter Schülern kann perspektivisch nicht mit Hilfe der Sanktionierung gelöst werden. Denn für das Auftreten verschiedener Erscheinungsformen von Gewalt sind jeweils komplexe Ursachenphänomene verantwortlich zu machen, die auch in wesentlichen Teilen mit der sozialen Lage der Menschen in Deutschland in Verbindung gebracht werden müssen. Hier ist die Politik gefordert, für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen in der Gesellschaft zu sorgen. Über die Darstellung der vielschichtigen Ursachenkomplexe schulischer Gewalt soll verdeutlicht werden, dass diese Bildungsinstitution das Problem der Gewalt unter den Heranwachsenden unmittelbar nicht erfolgreich wird bekämpfen können. Die Schule kann weder als gesellschaftspolitischer Reparaturbetrieb fungieren noch versuchen, mit verhaltenstherapeutischen Mitteln dem Gewaltproblem zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systematischer Problemaufriss: Ursachen schulischer Gewalt
- Funktionen der Schule - Bildung und Erziehung in der allgemein bildenden Schule
- Dimensionen moralischer Erziehung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Ursachen für Gewalt in Schulen und untersucht, wie die moralische Erziehung in der Schule dazu beitragen kann, Gewalt vorzubeugen und zu kompensieren. Im Fokus steht die Frage, ob die Schule durch die Vermittlung von Bildung und die Förderung der moralischen Entwicklung einen entscheidenden Beitrag zur Prävention und zur Reduzierung von Gewalt unter Schülern leisten kann.
- Ursachen schulischer Gewalt
- Funktionen der Schule im Kontext von Bildung und Erziehung
- Moralische Erziehung und ihre Bedeutung für Gewaltprävention
- Die Rolle des Fachunterrichts in der moralischen Erziehung
- Kompensatorische Ansätze zur Gewaltprävention in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel legt den Fokus auf das Problem der Gewalt in deutschen Schulen und die Herausforderungen, denen sich Lehrkräfte im Umgang mit Gewalt gegenübersehen. Die Arbeit stellt die Notwendigkeit einer umfassenden Herangehensweise an das Gewaltproblem in der Schule heraus und betont die Rolle der moralischen Erziehung als potentielles Gegenmittel.
- Systematischer Problemaufriss: Ursachen schulischer Gewalt: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für Gewalt in Schulen. Es beleuchtet verschiedene Faktoren, die zum Auftreten von Gewalt in der Schule beitragen, wie z. B. sozioökonomische Bedingungen, familiale Konstellationen, Lebenslagen und das Eltern-Kind-Verhältnis. Der sozialökologische Ansatz innerhalb der Sozialisationstheorie wird expliziert und der auf sozioökonomische Bedingungen zurückführbare Erklärungsansatz zur Entstehung schulischer Gewalt relativiert.
- Funktionen der Schule - Bildung und Erziehung in der allgemein bildenden Schule: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der moralischen Erziehung im Fachunterricht für die Prävention und Kompensation schulischer Gewalt. Es analysiert die Funktionen der Schule aus verschiedenen theoretischen Perspektiven und stellt den Stellenwert der Kulturgutvermittlung im Kontext des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule heraus.
Schlüsselwörter
Schulische Gewalt, Moralische Erziehung, Gewaltprävention, Bildung, Erziehung, Sozialisation, Sozialökologie, Fachunterricht, Kulturgutvermittlung, Kompensatorische Ansätze, Mehrebenenmodell, Sozioökonomische Faktoren.
- Quote paper
- Harald Mohr (Author), 2011, Moralische Erziehung - Kompensatorische pädagogische Ansätze zur Gewaltprophylaxe in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175948