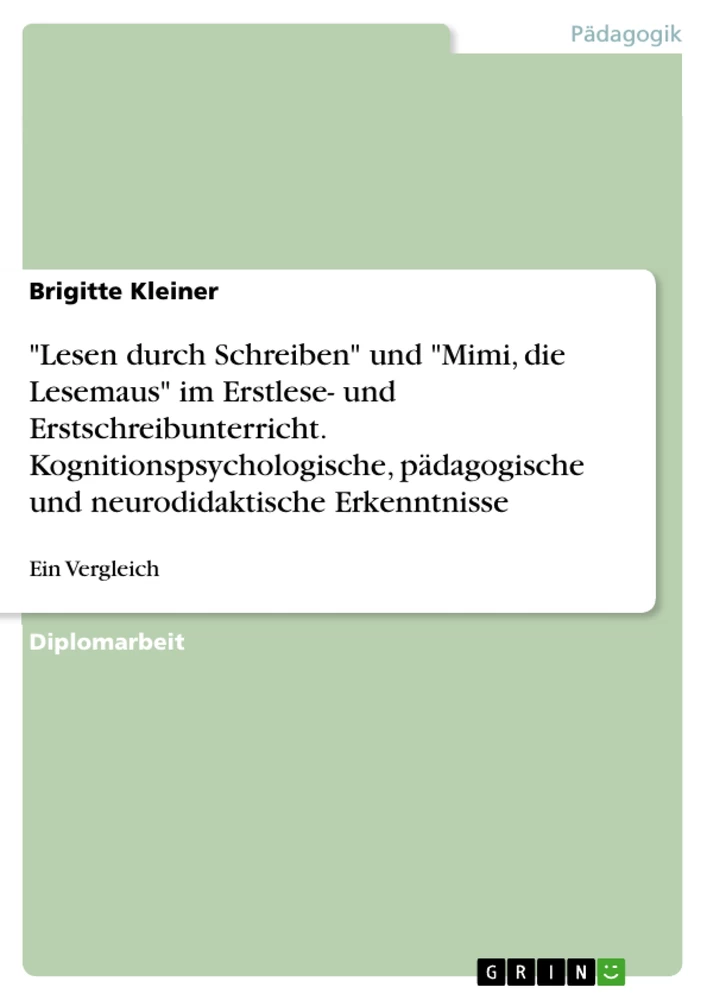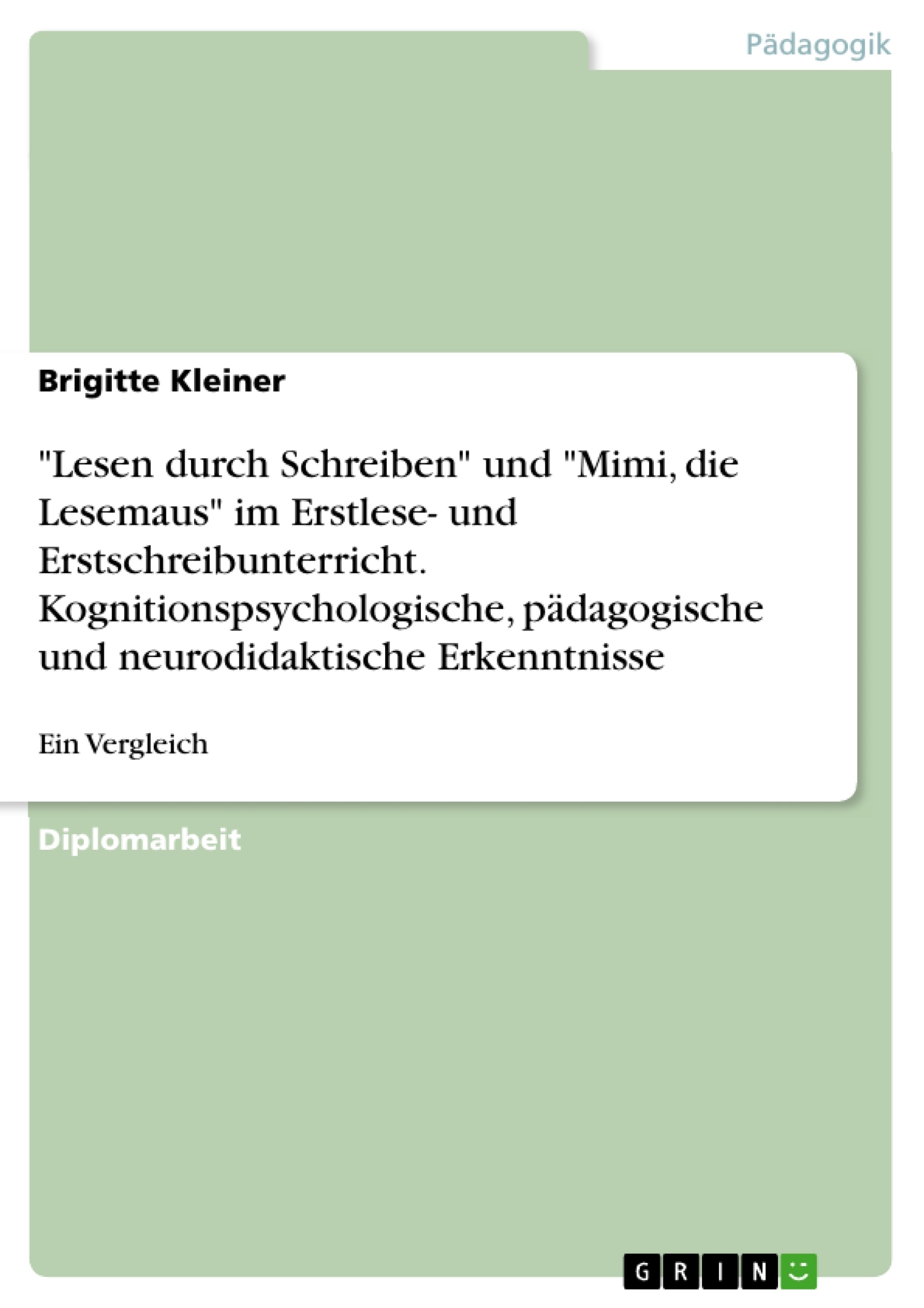Es soll der Frage nach den Anforderungen an Unterricht, insbesondere an Anfangsunterricht, aus heutiger Sicht, nachgegangen werden. Dafür wird ein Vergleich des Erstlese- und Erstschreibunterrichts, wie er in einer in Österreich gängigen Fibel empfohlen wird, mit der Methode „Lesen durch Schreiben“ von Jürgen Reichen angestellt werden. Zu beiden Methoden habe ich persönliche Unterrichtserfahrung, die in die Arbeit mit einfließen.
Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im ersten Teil der Arbeit erklärt sind, ergaben sich für mich aus meinen eigenen Unterrichtsbeobachtungen mit teils dazugehöriger Forschung und aus meinem Pädagogik- und Psychologiestudium. Deshalb sind sie in die Arbeit mit aufgenommen. wissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben am Schluss der Arbeit ein Gesamtbild dessen, wie ich heute, nach über 20 Jahren Unterricht und zwei Forschungsprojekten, Unterricht völlig anders sehe als zu Beginn meines Lehrberufs.
Es soll entlang klarer Fragstellungen dargestellt werden, wie die beiden Methoden den Anforderungen an modernen Unterricht, wie sie von Seiten der Kognitionspsychologie, der modernen Pädagogik, aus Folgeforschungen nach PISA - wie denen der „Zukunftskommission Österreich“ - und der Neurodidaktik heute gestellt werden, entsprechen.
Die theoretischen Grundlagen der Fragestellungen aus den genannten Wissenschaftsbereichen befassen sich auch damit, wie das Schreiben- und das Lesenlernen aus moderner Sicht anders als üblich definiert werden. Der Spracherfahrungsansatz, zu dem auch „Lesen durch Schreiben“ zählt, ist die moderne pädagogische Sicht auf den Schriftspracherwerb und wird ebenso argumentiert wie die Fibelmethode.
Die Bedeutung von lautem und leisem Lesen im Anfangsunterricht wird für das Lernen des, im alltäglichen Leben so wichtigen Sinn entnehmenden Lesens, aus moderner Sicht beleuchtet.
Es werden im ersten Teil der Arbeit daher auch Anforderungen an Schule, Unterricht und an moderne Unterrichtsformen behandelt, aber auch lerntheoretische Grundlagen zum Lesen und Schreiben lernen aus den oben genannten wissenschaftlichen Blickwinkeln beleuchtet.
Argumentiert wird das Verständnis von Lernen hinter den beiden Methoden, da beiden Methoden eine sehr unterschiedliche Auffassung von Lernprozessen zu Grunde liegt. Überwiegt bei der Fibel das passiv–reziptive Lernverständnis, steht beim Spracherfahrungsansatz das handlungsorientierte, vom Kind selbst gesteuerte Lernen, im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- I. Aufgaben und Anforderungen an Schule und Unterricht im Spannungsfeld zwischen Forderung und Förderung – Theoretische Grundlagen der Forschung
- I.1 Aufgaben der Schule und Anforderungen an den Unterricht und den Erstschreib- und Erstleseunterricht
- I.1.1 Schule und ihre Aufgaben – eine Definition
- I.1.2 Unterricht - eine Definition
- I.1.3 Die Wichtigkeit des Anfangsunterrichts
- I.2 Unterrichtsformen
- I.2.1 Der Frontalunterricht oder der „gebundene Unterricht“
- I.2.2 Der „offene Unterricht“ - Versuch einer Definition
- I.2.3 Der „Werkstattunterricht“ nach Reichen und das „Chef–System“
- I.2.4 Die Wochenplanarbeit
- I.2.5 Die in der untersuchten Klasse angewandte Mischung von Unterrichtsformen
- I.3 Lernen und Lesen lernen aus dem Blickwinkel der Kognitionspsychologie
- I.3.1 Kognitionen – eine Definition
- I.3.2 Individuelle kognitive Lernstrategien
- I.4 Konstruktivistischer Unterricht
- I.4.1 Konstruktivismus – eine Definition und ein Exkurs
- I.4.2 Konstruktivistisches Wissen, Lehren und Lernen
- I.5 Anforderungen aus dem Schulorganisationsgesetz, der Zukunftskommission 2005, dem Lehrplan und der modernen Pädagogik und Psychologie (Keine vordefinierten Unterrichtsinhalte)
- I.5.1 Anforderungen an den Leseunterricht aus dem Schulorganisationsgesetz, dem Lehrplan und von der Zukunftskommission
- I.5.2 Anforderungen aus der moderneren Pädagogik und Psychologie
- I.6 Der Erstschreib- und Erstleseunterricht
- I.6.1 Literalisierung ist mehr als Lesen und Schreiben lernen
- I.6.2 Das Lesen lernen – ein Methodenstreit
- I.6.3 Reichens „Lesen durch Schreiben und seine Grundannahmen“ zu Lernen, Lesen und Schreiben im Vergleich mit Folgeüberlegungen aus PISA und IGLU
- I.7 Reichens „Lesen durch Schreiben“ und sein Verständnis von Lernen, Lesen und Schreiben
- I.7.1 Die Prozesse des Schreiben- und Lesenlernens bei Reichen
- I.7.2 Die lernpsychologischen Überlegungen und Grundannahmen sowie die Konzeption des Lehrgangs LdS
- I.7.2.1 Die kognitive Selbststeuerung
- I.7.2.2 Das Prinzip der minimalen Hilfe
- I.7.2.3 Der Präfigurationsprozess
- I.7.2.4 Das soziale Lernen
- I.7.2.5 Orientierung am Transferprozess
- I.7.2.6 Kognitive Aktivierung statt mechanischem Üben
- I.7.2.7 Betrachtungsebenen
- I.7.2.8 Förderung des Anweisungsverständnisses
- I.7.2.9 Die Rechtschreibung
- I.7.2.10 Abschließende Bemerkungen: Ein Vergleich zeitgenössischer Auffassungen des Schriftspracherwerbs mit dem Unterricht durch LdS und der Fibel
- I.7.3 Praktisches aus LdS sowie Ergänzungen aus den untersuchten Klassen
- I.7.3.1 Der Anfangsunterricht in LdS mit Beispielen aus LdS und aus eigenem Material
- I.7.3.2 Die schwächeren und die schnelleren SchülerInnen in LdS
- I.7.3.3 Die Lehrgangsbeispiele: Rahmenthemen „In der Schule“ und „Auf der Straße und zu Hause“
- I.8 Die Fibel
- I.8.1 Die Lehrgangsgebundenheit
- I.8.2 Das Verständnis von Unterrichtsformen in der Fibel
- I.8.3 Individuelle kognitive Strategien und die Fibel
- I.9 Anforderungen an Unterricht aus der Neurodidaktik bzw. aus den Neurowissenschaften und der Kognitionspsychologie
- I.9.1 Neurowissenschaft und Lernen
- I.9.2 Neurowissenschaften, eine Kurzdefinition und Begriffsklärungen
- I.9.3 Die Lernregeln nach Frederic Vester
- I.9.4 Die konkreten Anforderungen
- I.9.4.1 Die positive Hormonlage für das Lernen im Gehirn oder – (Spaß und Lernen)
- I.9.4.2 Wiederholung und Übungen (Lernen passiert nicht in einem Lernschritt und braucht viele Beispiele)
- I.9.4.3 Lesen lernen und neuronale Interferenzen – (Interferenzen neuronaler Netzwerke)
- I.9.4.3 Lesen lernen und neuronale Interferenzen – (Interferenzen neuronaler Netzwerke)
- I.9.5 Die „Low-Level“ Funktionen („Low-Level“ Teilfertigkeiten mittrainieren)
- II. Die Qualitative Forschung, Aktionsforschung und ihre Ergebnisse
- II.1 Die qualitative Forschung
- II.1.1 Die wissenschaftlichen Grundlagen der qualitativen Forschung
- II.1.2 Darstellung der Datensammlung der qualitativen Forschung
- II.1.2.1 Ausgangslage für den Beginn der Forschung
- II.1.2.2 Verlauf der qualitativen Forschung 1991-1994
- II.1.2.3 Aufbau der Forschung
- II.1.2.4 Daten und Datenerhebung
- II.1.2.5 Erkenntnisse aus den Interviews und ihre Auswertung
- II.1.3 Konsequenzen aus den Erkenntnissen für den Unterricht
- II.2 Die Aktionsforschung
- II.2.1 Definition und Charakteristika der Aktionsforschung
- II.2.2 Das Verständnis von Forschung und Wissenschaftlichkeit in der Aktionsforschung
- II.2.3 LehrerInnen als SelbstbeobachterInnen
- II.3 Der Aktionsforschungskreis 1999/00 und 2003/04 – die Forschungsfragen
- II.3.1 Zu den Klassen und zum Unterricht
- II.3.2 Beobachtung und Datensammlung
- II.3.3 Interpretation, Auswertung der Daten und Formulierung einer „Praktischen Theorie“
- II.3.3.1 Schreibübungen von Buchstaben sind nicht nötig
- II.3.3.2 Die „ästhetische Funktion der Schrift“ nach Brockmeier als didaktisches Begleitphänomen von Fibelunterricht
- II.3.3.3 Aktionsforschung als Prüfmethode der Vorannahmen einer ganzen Berufsgruppe
- II.3.4 Ziele und Bewertungskriterien
- II.3.4.1 Die Materialanalyse
- II.3.4.2 Materialkategorien
- II.3.4.3 Zielsetzungen der Materialien zu LdS und deren Einsatz:
- II.3.4.4 Zielsetzungen der Materialien in der Fibel „Mimi, die Lesemaus“:
- II.3.5 Formulieren und Verbreiten der Erfahrungen
- II.3.6 Aktionsideen und das Bild der „Leselernlandschaft“
- II.3.6.1 Aufgabe jedweder Schreibübungen
- II.3.6.2 Die Leistungsbeurteilung
- II.3.6.3 „Die Leselernlandschaft“
- II.3.7 Tabelle zu den Anforderungen aus der Neurodidaktik, der Kognitionspsychologie und den Interpretationen aus PISA und IGLU mit Materialangebot aus der Fibel, LdS und meinen Ergänzungen
- II.3.7.1 Der Anforderungenkatalog
- II.3.7.2 Zusammenfassung und Kommentierung des Anforderungenkatalogs
- II.3.8 Beantwortung der Forschungsfragen
- II.4 Persönliche Schlussbemerkungen und Ausblick auf weitere Aktionen
- Anforderungen an modernen Anfangsunterricht
- Vergleich der Methoden LdS und Fibelunterricht
- Lerntheoretische Grundlagen des Lese- und Schreiblernprozesses
- Kognitionspsychologische und neurodidaktische Aspekte des Schriftspracherwerbs
- Praxisbezogene Evaluation von LdS durch Aktionsforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anforderungen an modernen Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben. Im Fokus steht ein Vergleich zwischen der Methode „Lesen durch Schreiben“ (LdS) von Jürgen Reichen und dem traditionellen Fibelunterricht. Die Arbeit analysiert die methodischen Ansätze, lerntheoretischen Grundlagen und die Übereinstimmung mit aktuellen Erkenntnissen aus Kognitionspsychologie und Neurodidaktik.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Aufgaben und Anforderungen an Schule und Unterricht im Spannungsfeld zwischen Forderung und Förderung – Theoretische Grundlagen der Forschung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die Aufgaben von Schule und Unterricht definiert und die Bedeutung des Anfangsunterrichts hervorhebt. Es werden verschiedene Unterrichtsformen (Frontalunterricht, offener Unterricht, Werkstattunterricht) im Hinblick auf ihre Eignung für einen modernen, schülerzentrierten Ansatz verglichen. Das Kapitel beleuchtet auch lerntheoretische Aspekte aus kognitionspsychologischer Sicht und führt in den konstruktivistischen Ansatz ein. Schließlich werden die Anforderungen des Schulorganisationsgesetzes, der Zukunftskommission und des Lehrplans an den Leseunterricht erläutert, ergänzt durch Erkenntnisse aus der modernen Pädagogik und Psychologie.
II. Die Qualitative Forschung, Aktionsforschung und ihre Ergebnisse: Dieses Kapitel beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit, der sowohl qualitative als auch aktionsforschungsbasierte Methoden kombiniert. Es beschreibt den Verlauf der qualitativen Forschung, die mit narrativen und halbstandardisierten Interviews durchgeführt wurde, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Die Ergebnisse führten zur Gestaltung eines Aktionsforschungskreises, der die Methode „Lesen durch Schreiben“ in der Praxis evaluiert und die gewonnenen Erfahrungen aufzeigt. Das Kapitel beschreibt die angewandten Forschungsmethoden, die Auswertung der Daten und die Herausbildung einer „Praktischen Theorie“.
Schlüsselwörter
Lesen durch Schreiben, Fibelunterricht, Anfangsunterricht, Lesedidaktik, Schriftspracherwerb, Kognitionspsychologie, Neurodidaktik, Aktionsforschung, qualitative Forschung, Lerntheorien, individuelle Lernstrategien, Lesekompetenz, Sinnentnehmendes Lesen, Konstruktivismus, Frontalunterricht, offener Unterricht, Werkstattunterricht, „Low-Level“-Fertigkeiten, neuronale Netzwerke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anforderungen an modernen Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anforderungen an modernen Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich zwischen der Methode „Lesen durch Schreiben“ (LdS) von Jürgen Reichen und dem traditionellen Fibelunterricht. Analysiert werden die methodischen Ansätze, lerntheoretischen Grundlagen und die Übereinstimmung mit aktuellen Erkenntnissen aus Kognitionspsychologie und Neurodidaktik. Die Arbeit evaluiert LdS praxisbezogen mittels Aktionsforschung.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert qualitative und aktionsforschungsbasierte Methoden. Die qualitative Forschung stützt sich auf narrative und halbstandardisierte Interviews. Die Aktionsforschung evaluiert die Methode „Lesen durch Schreiben“ in der Praxis und dokumentiert die gewonnenen Erfahrungen. Es werden Daten gesammelt, ausgewertet und daraus eine „Praktische Theorie“ entwickelt.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Unterrichtsformen (Frontalunterricht, offener Unterricht, Werkstattunterricht) und deren Eignung für einen modernen, schülerzentrierten Ansatz. Es werden lerntheoretische Aspekte aus kognitionspsychologischer Sicht beleuchtet und der konstruktivistische Ansatz eingeführt. Die Anforderungen des Schulorganisationsgesetzes, der Zukunftskommission, des Lehrplans und Erkenntnisse aus der modernen Pädagogik und Psychologie werden erläutert.
Wie werden LdS und Fibelunterricht verglichen?
Die Arbeit vergleicht die methodischen Ansätze von LdS und Fibelunterricht, ihre lerntheoretischen Grundlagen und ihre Übereinstimmung mit Erkenntnissen aus Kognitionspsychologie und Neurodidaktik. Die Aktionsforschung liefert praxisbezogene Erkenntnisse zum Einsatz von LdS.
Welche Rolle spielen Kognitionspsychologie und Neurodidaktik?
Kognitionspsychologische und neurodidaktische Aspekte des Schriftspracherwerbs spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie die Methoden LdS und Fibelunterricht den Erkenntnissen dieser Disziplinen entsprechen. Konzepte wie individuelle kognitive Strategien, neuronale Netzwerke und „Low-Level“-Fertigkeiten werden berücksichtigt.
Welche Ergebnisse liefert die Aktionsforschung?
Die Aktionsforschung evaluiert die Methode „Lesen durch Schreiben“ in der Praxis und liefert Erkenntnisse zur Umsetzung und Wirksamkeit. Die Ergebnisse führen zur Entwicklung einer „Praktischen Theorie“ und zu Aktionsideen zur Gestaltung einer „Leselernlandschaft“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus zwei Hauptkapiteln: Kapitel I behandelt die theoretischen Grundlagen, darunter die Aufgaben von Schule und Unterricht, verschiedene Unterrichtsformen, lerntheoretische und kognitionspsychologische Aspekte sowie Anforderungen aus dem Schulorganisationsgesetz und der modernen Pädagogik. Kapitel II beschreibt die qualitative und aktionsforschungsbasierte Forschung, den Forschungsverlauf, die Datenerhebung und -auswertung, sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse und die daraus abgeleitete „Praktische Theorie“.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Lesen durch Schreiben (LdS), Fibelunterricht, Anfangsunterricht, Lesedidaktik, Schriftspracherwerb, Kognitionspsychologie, Neurodidaktik, Aktionsforschung, qualitative Forschung, Lerntheorien, individuelle Lernstrategien, Lesekompetenz, Sinnentnehmendes Lesen, Konstruktivismus, Frontalunterricht, offener Unterricht, Werkstattunterricht, „Low-Level“-Fertigkeiten, neuronale Netzwerke.
- Quote paper
- Brigitte Kleiner (Author), 2005, "Lesen durch Schreiben" und "Mimi, die Lesemaus" im Erstlese- und Erstschreibunterricht. Kognitionspsychologische, pädagogische und neurodidaktische Erkenntnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175583