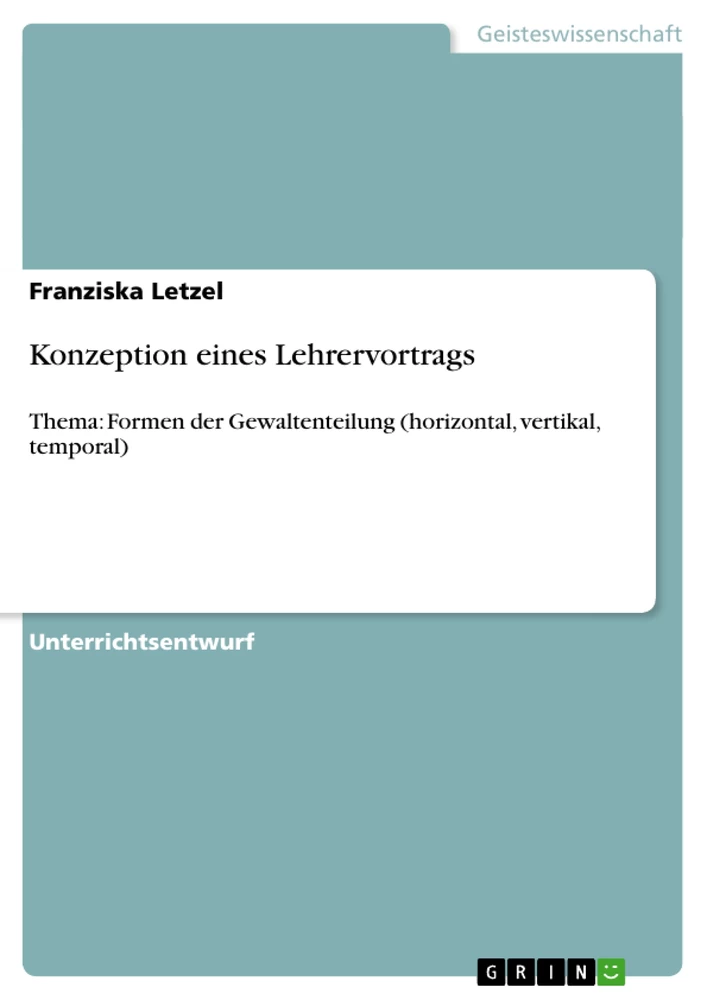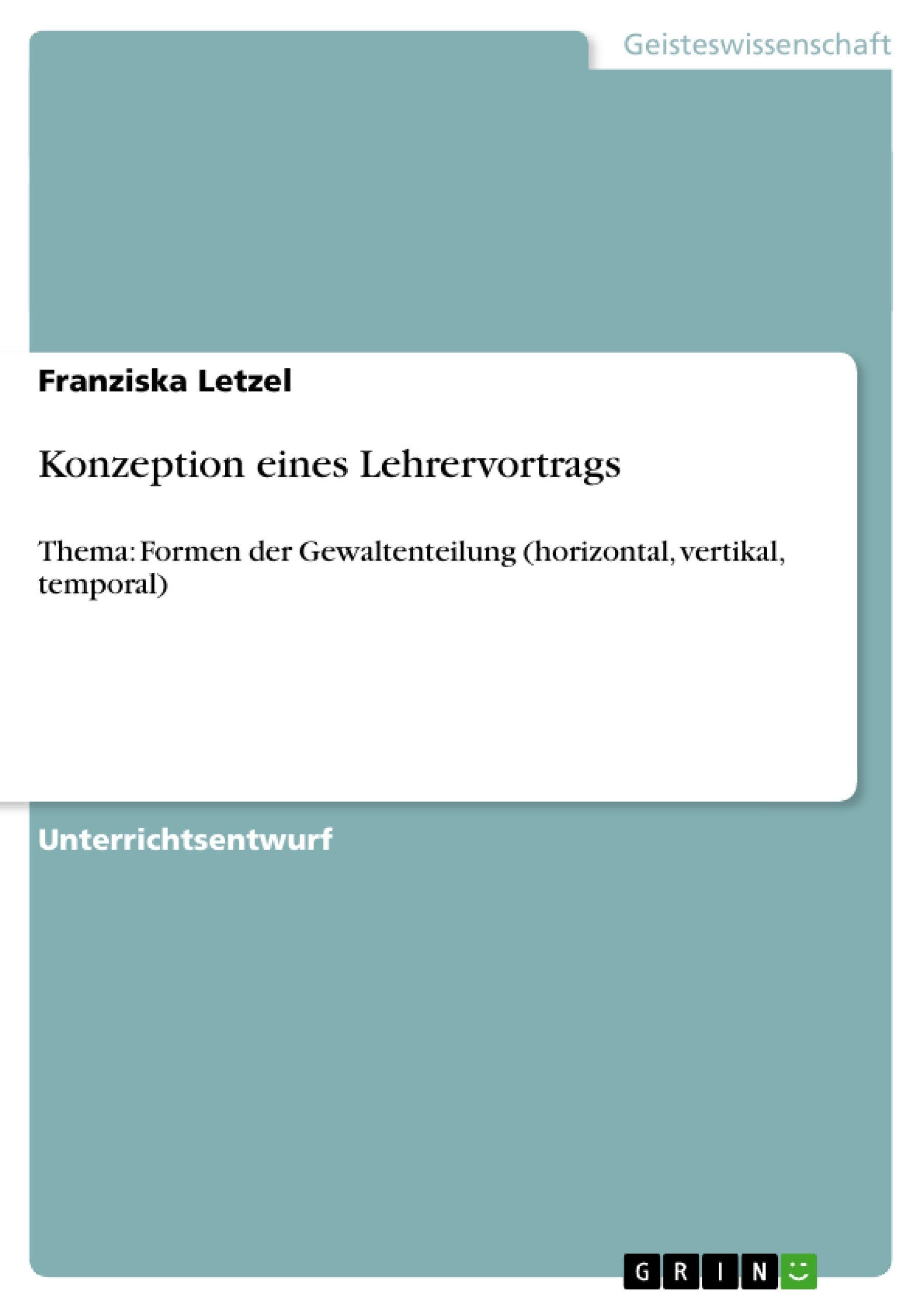Die Unterrichtskonzeption beinhaltet die Ausarbeitung eines Lehrervortrags zum Thema: Formen der Gewaltenteilung (horizontal, vertikal, temporal).
Er wurde konzipiert für das Gymnasium Klasse 9, Lernbereich 1: Partizipation und politische Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland und im Freistaat Sachsen. Der Lerninhalt sind die Strukturprinzipien des demokratischen Verfassungsstaats.
Die Konzeption beinhaltet die schriftliche Ausarbeitung des Lehrervortrags, sowie die Gestaltung des Tafelbilds.
Inhaltsverzeichnis
- Gewaltenteilung (horizontal, vertikal, temporal)
- Horizontale Gewaltenteilung
- Vertikale Gewaltenteilung
- Temporale Gewaltenteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Lehrervortrag zielt darauf ab, das Prinzip der Gewaltenteilung im deutschen politischen System zu erklären und zu veranschaulichen. Die Schüler sollen die verschiedenen Formen der Gewaltenteilung verstehen und deren Bedeutung für die Funktionsweise des demokratischen Staates erfassen.
- Horizontale Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative)
- Vertikale Gewaltenteilung (Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip)
- Temporale Gewaltenteilung (begrenzte Amtszeiten, Legislaturperioden)
- Zusammenspiel und gegenseitige Kontrolle der Gewalten
- Begrenzung von Machtmissbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Gewaltenteilung (horizontal, vertikal, temporal): Der Vortrag führt in das Thema Gewaltenteilung ein und erläutert, dass politische Macht nicht in einer Hand konzentriert sein sollte. Es werden drei Arten der Gewaltenteilung vorgestellt: horizontal, vertikal und temporal. Die Schüler werden angeleitet, während des Vortrags eine Tabelle zu den drei Formen auszufüllen.
Horizontale Gewaltenteilung: Dieser Abschnitt beschreibt die horizontale Gewaltenteilung als Aufteilung der Macht auf verschiedene Institutionen: Legislative (Parlament), Exekutive (Regierung) und Judikative (Gerichte). Es wird betont, dass diese Institutionen, obwohl funktional getrennt, kooperieren und sich gegenseitig kontrollieren. Die Notwendigkeit der Zustimmung aller drei Gewalten bei der Verabschiedung neuer Gesetze wird als Beispiel angeführt. Der gegenseitige Kontrollmechanismus wird als essentiell für die Vermeidung von Machtmissbrauch hervorgehoben.
Vertikale Gewaltenteilung: Hier wird die vertikale Gewaltenteilung im Kontext des deutschen Föderalismus erklärt. Der Vortrag beschreibt die verschiedenen Ebenen (kommunal, Länderebene, Bundesebene, EU) und deren Aufgaben. Das Subsidiaritätsprinzip wird eingeführt als Mechanismus, um Überschneidungen und Konflikte zwischen den Ebenen zu vermeiden. Ein anschauliches Beispiel aus dem Familienalltag (Zimmer aufräumen) veranschaulicht die Bedeutung des Prinzips für effizientes Arbeiten.
Temporale Gewaltenteilung: Dieser Teil befasst sich mit der zeitlichen Begrenzung politischer Ämter (Legislaturperioden). Es wird erklärt, dass diese Begrenzung Machtmissbrauch verhindern und den Wechsel von Verantwortungsträgern ermöglichen soll. Das Beispiel des Klassensprechers veranschaulicht den Gedanken der zeitlich begrenzten Amtszeit. Die unterschiedlichen Legislaturperioden in Deutschland (z.B. Bundestag, Bundespräsident) werden genannt.
Schlüsselwörter
Gewaltenteilung, horizontale Gewaltenteilung, vertikale Gewaltenteilung, temporale Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive, Judikative, Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip, Legislaturperiode, Machtbegrenzung, Machtmissbrauch, demokratischer Verfassungsstaat.
Häufig gestellte Fragen zum Lehrervortrag: Gewaltenteilung im deutschen politischen System
Was ist der Inhalt des Lehrervortrags?
Der Vortrag behandelt das Prinzip der Gewaltenteilung im deutschen politischen System. Er erklärt die horizontale, vertikale und temporale Gewaltenteilung und deren Bedeutung für die Funktionsweise des demokratischen Staates. Der Vortrag beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Arten der Gewaltenteilung werden behandelt?
Der Vortrag beschreibt drei Arten der Gewaltenteilung: die horizontale Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative), die vertikale Gewaltenteilung (Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip) und die temporale Gewaltenteilung (begrenzte Amtszeiten, Legislaturperioden).
Was ist die horizontale Gewaltenteilung?
Die horizontale Gewaltenteilung beschreibt die Aufteilung der Staatsgewalt auf drei unabhängige, aber kooperierende Institutionen: die Legislative (Gesetzgebung, Parlament), die Exekutive (Regierung, Vollziehung) und die Judikative (Rechtsprechung, Gerichte). Die gegenseitige Kontrolle dieser Institutionen dient der Vermeidung von Machtmissbrauch.
Was ist die vertikale Gewaltenteilung?
Die vertikale Gewaltenteilung bezieht sich auf die Aufteilung der Staatsgewalt auf verschiedene staatliche Ebenen im deutschen Föderalismus (Bund, Länder, Kommunen). Das Subsidiaritätsprinzip regelt die Aufgabenverteilung und soll Überschneidungen und Konflikte zwischen den Ebenen vermeiden.
Was ist die temporale Gewaltenteilung?
Die temporale Gewaltenteilung beschreibt die zeitliche Begrenzung von Amtszeiten und Legislaturperioden. Diese Begrenzung soll Machtmissbrauch verhindern und den regelmäßigen Wechsel von Verantwortungsträgern ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Vortrag?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gewaltenteilung, horizontale Gewaltenteilung, vertikale Gewaltenteilung, temporale Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive, Judikative, Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip, Legislaturperiode, Machtbegrenzung, Machtmissbrauch, demokratischer Verfassungsstaat.
Was ist die Zielsetzung des Vortrags?
Der Vortrag zielt darauf ab, den Schülern das Prinzip der Gewaltenteilung zu erklären und deren Bedeutung für die Funktionsweise des demokratischen Staates zu vermitteln. Die Schüler sollen die verschiedenen Formen der Gewaltenteilung verstehen und deren Zusammenspiel erfassen.
Wie werden die Inhalte im Vortrag vermittelt?
Der Vortrag enthält neben der theoretischen Erklärung der Gewaltenteilung auch anschauliche Beispiele aus dem Alltag und fordert die Schüler zur aktiven Mitarbeit auf (z.B. Ausfüllen einer Tabelle).
- Quote paper
- Franziska Letzel (Author), 2010, Konzeption eines Lehrervortrags , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175294