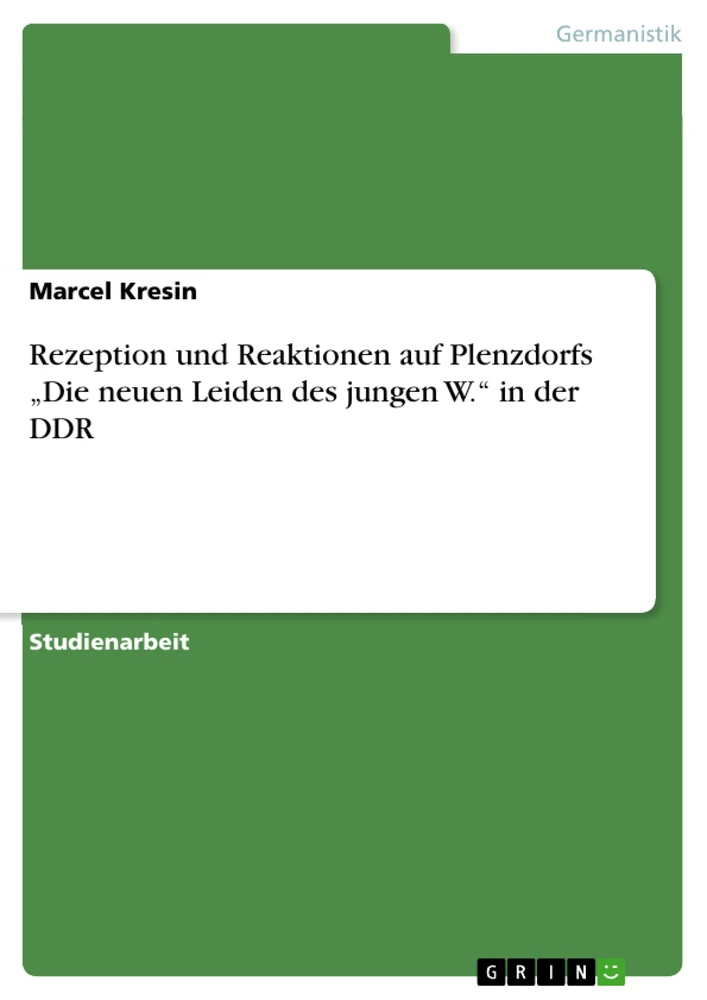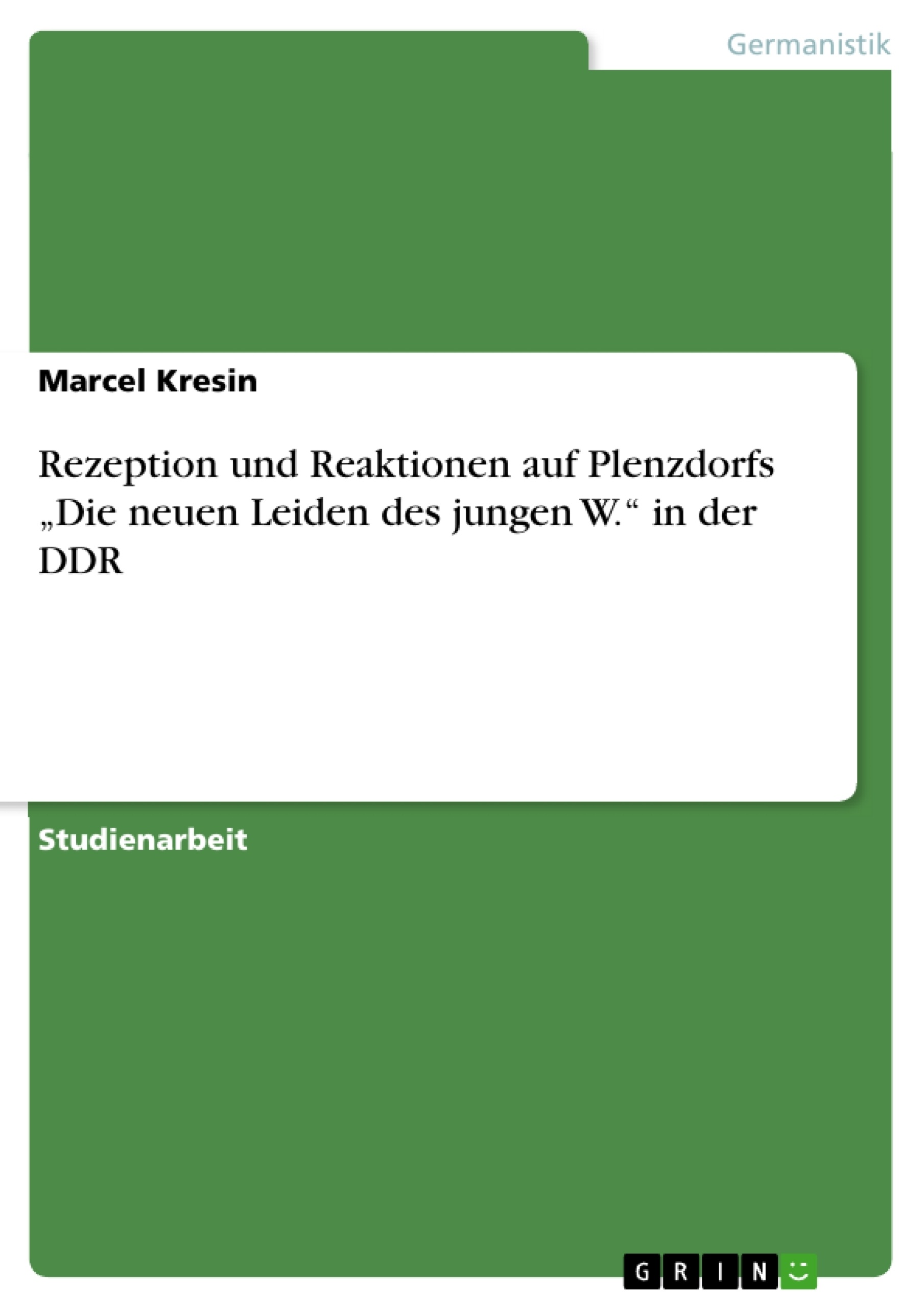Als die Theaterfassung des Werks „Die neuen Leiden des jungen W.“ 1972 in Halle uraufgeführt wird und die Romanfassung im gleichen Jahr in der DDR-Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ erscheint, wird Ulrich Plenzdorf „über Nacht“ berühmt. Dabei hatte er den Stoff schon vor Jahren „für die Schublade“ geschrieben, eine Veröffentlichung hielt er nach mehreren Überarbeitungen und Zurückweisungen der DDR-Zensoren kaum noch für möglich. Das Werk erweckte ein Interesse und löste eine kulturpolitische Debatte aus, wie es in der DDR nur selten der Fall war.
Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, wie die „Neuen Leiden“ in der DDR aufgenommen und interpretiert wurden, sowohl vom breiten Publikum als auch von namhaften Literaturkritikern, Literaturwissenschaftlern, Schauspielern, Regisseuren und Schriftstellern. Dazu wird im ersten Abschnitt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des besonderen kulturpolitischen und literaturhistorischen Hintergrunds in der DDR sowie des sozialistischen Verhältnisses zum klassischen Literaturerbe gegeben. Anschließend soll kurz auf die Biographie des Autors eingegangen werden, um zu erkennen, wo Ulrich Plenzdorf innerhalb der sozialistischen Gesellschaft zu verorten ist. Im Kapitel vier wird die Handlung des Romans dargestellt. Eine bedeutende Rolle spielt dabei auch die außergewöhnliche Erzählperspektive sowie die sprachlichen Mittel, die ebenfalls erläutert werden. Schon im Titel wird der Bezug zu Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ deutlich. Kapitel fünf zeigt die Funktionen und Handlungsebenen dieses Werther-Bezugs auf. Das sechste Kapitel setzt sich ausführlich mit der Rezeption, Interpretation und Reaktion am Beispiel einiger zeitgenössischer Stimmen auseinander. Dabei steht eine von der Zeitschrift „Sinn und Form“ angeregte Diskussion im Vordergrund, die eine rege Beteiligung fand. Schließlich werden im Schlusskapitel die Ergebnisse zusammengefasst und es wird versucht, die Frage zu beantworten, wie die „Neuen Leiden“ in der DDR rezipiert und interpretiert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturpolitischer und literaturhistorischer Kontext
- Der Bitterfelder Weg
- Das 11. Plenum des ZK der SED - das,,Kahlschlagplenum\"
- Der VIII. Parteitag der SED
- Die besondere Rolle des klassischen Erbe in der DDR-Literatur
- Zum Autor
- Handlung und stilistische Mittel der „Neuen Leiden“
- Die Handlung
- Formale Gestaltung
- Bezüge zu Goethes Werther
- Rezeption des Werks in der DDR
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption und Interpretation von Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“ in der DDR. Sie analysiert die Reaktion des breiten Publikums sowie namhafter Literaturkritiker, -wissenschaftler, Schauspieler, Regisseure und Schriftsteller auf das Werk. Darüber hinaus beleuchtet sie den kulturpolitischen und literaturhistorischen Kontext, in dem das Werk entstand, und die besondere Rolle des klassischen Erbes in der DDR-Literatur.
- Kulturpolitische Rahmenbedingungen der DDR
- Rezeption und Interpretation von Plenzdorfs „Die neuen Leiden“
- Bezüge zu Goethes „Die Leiden des jungen Werther“
- Die Rolle des klassischen Erbes in der DDR-Literatur
- Die Entwicklung der DDR-Literatur in den 1960er und 1970er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Rezeption und das kulturpolitische Gewicht von Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“ in der DDR. Das zweite Kapitel beleuchtet den kulturpolitischen und literaturhistorischen Kontext, in dem das Werk entstand. Dabei werden wichtige Ereignisse wie der „Bitterfelder Weg“, das „Kahlschlagplenum“ und der VIII. Parteitag der SED sowie die besondere Rolle des klassischen Erbes in der DDR-Literatur beleuchtet. Das dritte Kapitel bietet einen kurzen Einblick in die Biographie des Autors und seine Position innerhalb der sozialistischen Gesellschaft. Kapitel vier beschreibt die Handlung des Romans und die außergewöhnliche Erzählperspektive sowie die sprachlichen Mittel des Werks. Kapitel fünf untersucht die Funktionen und Handlungsebenen des Bezugs zu Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Das sechste Kapitel widmet sich der Rezeption, Interpretation und Reaktion auf das Werk anhand von zeitgenössischen Stimmen, wobei eine von der Zeitschrift „Sinn und Form“ angeregte Diskussion im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ulrich Plenzdorf, „Die neuen Leiden des jungen W.“, DDR-Literatur, Kulturpolitik, Rezeption, Interpretation, Bitterfelder Weg, „Kahlschlagplenum“, sozialistischer Realismus, Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, Zensur, Literaturkritik.
- Quote paper
- Marcel Kresin (Author), 2011, Rezeption und Reaktionen auf Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“ in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175039