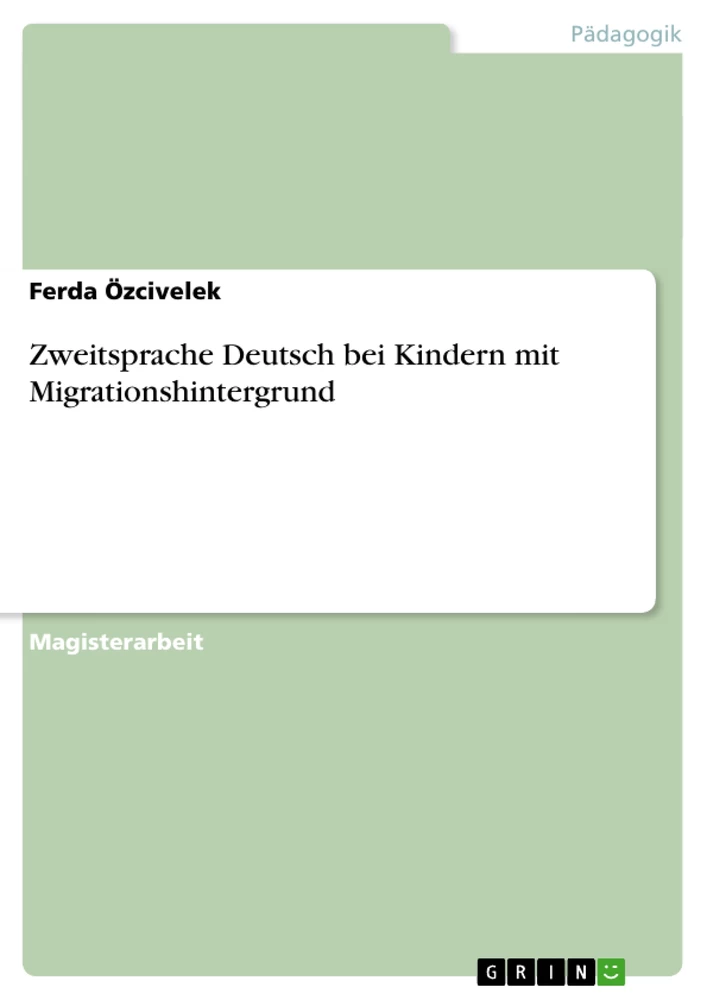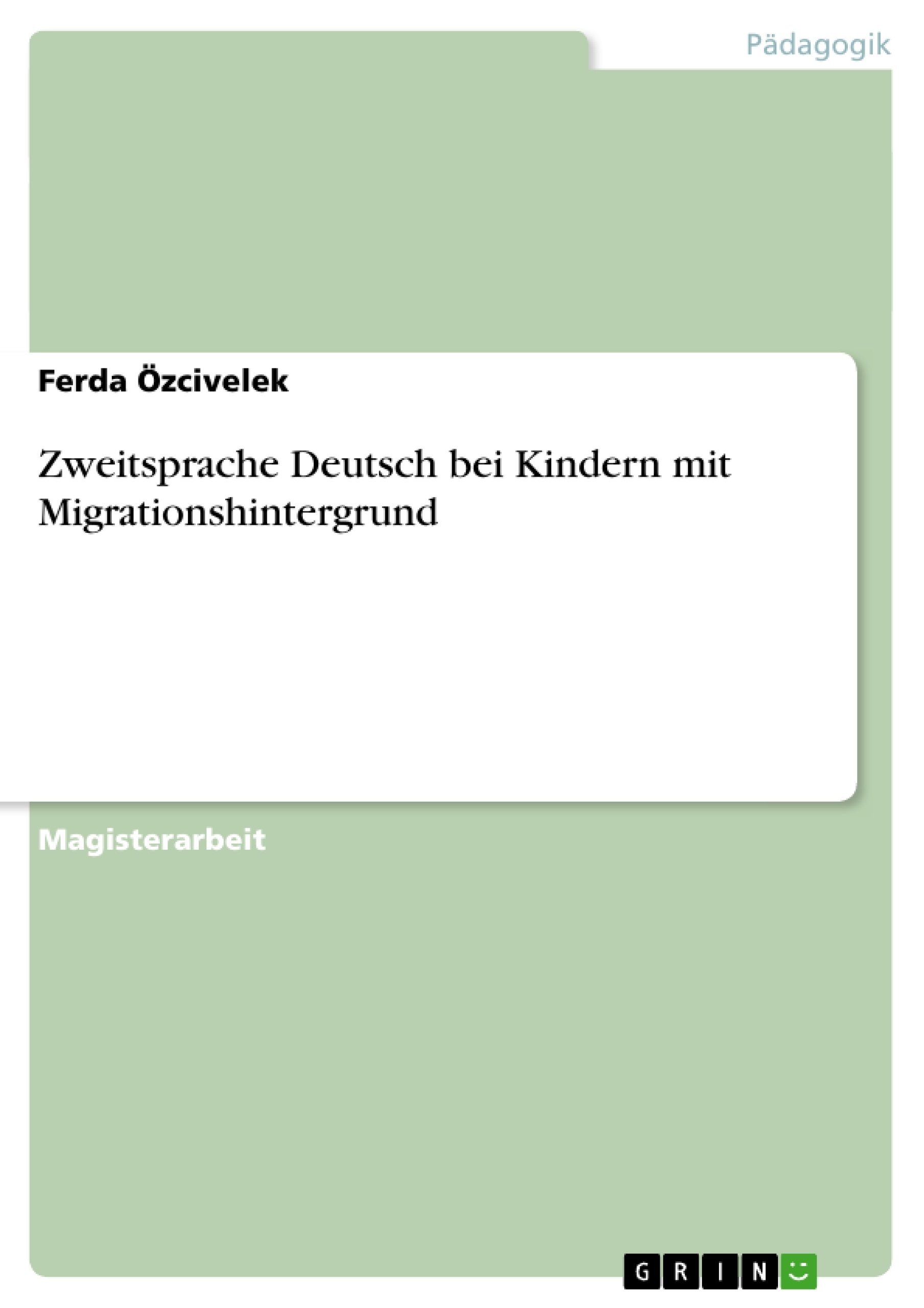In Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, stellt Bilingualismus längst kein Phänomen mehr dar. Einsprachigkeit stellt in der Weltbevölkerung eher eine Ausnahme dar als Zweisprachigkeit. Gerade in Deutschland gibt es eine große Zahl von Menschen, die eine andere Muttersprache sprechen als Deutsch.
Der vorliegenden Arbeit liegt keine eindeutige Fragestellung zugrunde. Sie hat vielmehr Überblickscharakter und verfolgt das Ziel, Grundlagen der pädagogischen Diskussion rund um das Thema Bilingualismus bei Kindern mit Migrationshintergrund zu liefern. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf dem frühen kindlichen Spracherwerb und den Theorien, die sich mit dem Zweitspracherwerb befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Erstsprache
- Muttersprache
- Zweitsprache/Fremdsprache
- Definition des Bilingualismus
- Linguistische Definitionen
- Funktionale Definitionen
- Formen des Bilingualismus
- Typen des bilingualen Spracherwerbs
- Eine Person - eine Sprache
- Nicht-Umgebungssprache zu Hause/Eine Sprache - eine Umgebung
- Eine Sprache zu Hause - die andere Sprache aus der Umgebung
- Zwei Sprachen zu Hause - Eine andere Sprache aus der Umgebung
- Nichtmuttersprachliche Eltern
- Gemischte Sprachen
- Sprachdominanz - Schwache Sprache - Starke Sprache
- Theorien zur Zweisprachigkeit
- Die Schwellenhypothese nach Cummins
- Die Hypothese des doppelten Eisbergs nach Cummins
- Krashens Input-Hypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Kontrastivhypothese
- Die Interlanguage-Hypothese
- Die Pidginisierungstheorie
- Der Zweitspracherwerb - Grundlagen und Voraussetzungen des Zweitspracherwerbs
- Entwicklungsstadien des Zweitspracherwerbs
- Biologische Voraussetzungen
- Relevanz des Lebensalters beim Zweitspracherwerb
- Soziopsychologische Voraussetzungen
- Intern und extern beeinflussende Faktoren
- Relevanz der Muttersprache beim Zweitspracherwerb
- Kognitive Voraussetzungen
- Sprachlernstrategien
- Verarbeitungsprozesse
- Codeswitching
- Vor- und Nachteile des frühen Zweitspracherwerbs
- Vorteile des frühen Zweitspracherwerbs
- Nachteile des frühen Zweitspracherwerbs
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Zweitspracherwerb von Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die relevanten linguistischen Theorien und den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema darzustellen und die biologischen, soziopsychologischen und kognitiven Voraussetzungen des Spracherwerbs zu beleuchten.
- Definition und Typologisierung von Bilingualismus
- Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb (biologisch, soziokulturell, kognitiv)
- Relevanz des Alters beim Spracherwerb
- Theorien zur Zweisprachigkeit (Cummins, Krashen, etc.)
- Codeswitching und seine Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung des Themas Zweitspracherwerb Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund im Kontext der zunehmenden Migration und der damit verbundenen Herausforderungen im Bildungssystem. Es wird die Relevanz der Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit kurz angerissen.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Erstsprache, Muttersprache und Zweitsprache/Fremdsprache. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Definitionen von Bilingualismus (linguistisch und funktional) und beschreibt verschiedene Formen und Typen des bilingualen Spracherwerbs, wie z.B. den Erwerb von zwei Sprachen in unterschiedlichen Umgebungen (Zuhause, Schule) oder den Erwerb einer Zweitsprache durch Kinder mit nicht-muttersprachlichen Eltern. Die verschiedenen Szenarien des Spracherwerbs werden detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert.
Definition des Bilingualismus: Dieses Kapitel beschäftigt sich eingehend mit verschiedenen Definitionen von Bilingualismus, sowohl aus linguistischer als auch aus funktionaler Perspektive. Es werden unterschiedliche Formen und Typen des Bilingualismus vorgestellt und analysiert, inklusive der Aspekte Sprachdominanz und -kompetenz. Die Kapitel untersucht, wie diese Definitionen sich auf den Erwerb und die Entwicklung der Zweitsprache auswirken und inwiefern sie für die pädagogische Praxis relevant sind. Es werden verschiedene Modelle und Theorien vorgestellt, die den Bilingualismus erklären und beschreiben.
Theorien zur Zweisprachigkeit: Dieses Kapitel präsentiert eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen wichtigen Theorien zur Zweisprachigkeit, unter anderem die Schwellenhypothese und die Hypothese des doppelten Eisbergs von Cummins, Krashens Input-Hypothese, die Identitätshypothese, die Kontrastivhypothese, die Interlanguage-Hypothese und die Pidginisierungstheorie. Die Stärken und Schwächen jedes Modells werden im Detail diskutiert und ihre jeweilige Relevanz für den Verständnis des Zweitspracherwerbs wird bewertet. Die Kapitel vergleicht und kontrastiert diese Theorien, um ein umfassendes Verständnis der komplexen Dynamiken des bilingualen Spracherwerbs zu entwickeln.
Der Zweitspracherwerb - Grundlagen und Voraussetzungen des Zweitspracherwerbs: Dieses Kapitel analysiert die biologischen, soziopsychologischen und kognitiven Voraussetzungen des Zweitspracherwerbs. Es behandelt die Bedeutung des Alters beim Spracherwerb, die Rolle der Muttersprache, den Einfluss von internen und externen Faktoren sowie die Relevanz von Sprachlernstrategien und Verarbeitungsprozessen. Der Abschnitt über Codeswitching beleuchtet seine Funktionen und seine Auswirkungen auf den Spracherwerbsprozess. Schließlich werden die Vor- und Nachteile des frühen Zweitspracherwerbs eingehend diskutiert und an Beispielen veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Kinder mit Migrationshintergrund, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Sprachtheorien, Cummins, Krashen, Sprachdominanz, Codeswitching, kognitive Voraussetzungen, soziokulturelle Faktoren, Lebensalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Zweitspracherwerb von Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zweitspracherwerb von Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund. Sie beleuchtet die relevanten linguistischen Theorien, den aktuellen Forschungsstand und die biologischen, soziopsychologischen und kognitiven Voraussetzungen des Spracherwerbs.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Typologisierung von Bilingualismus, Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb (biologisch, soziokulturell, kognitiv), Relevanz des Alters beim Spracherwerb, Theorien zur Zweisprachigkeit (Cummins, Krashen, etc.), Codeswitching und seine Bedeutung.
Welche Definitionen von Bilingualismus werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen linguistischen und funktionalen Definitionen von Bilingualismus. Sie beschreibt verschiedene Formen und Typen des bilingualen Spracherwerbs, einschließlich des Erwerbs von zwei Sprachen in unterschiedlichen Umgebungen und des Erwerbs einer Zweitsprache durch Kinder mit nicht-muttersprachlichen Eltern.
Welche Theorien zur Zweisprachigkeit werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Theorien zur Zweisprachigkeit, darunter die Schwellenhypothese und die Hypothese des doppelten Eisbergs von Cummins, Krashens Input-Hypothese, die Identitätshypothese, die Kontrastivhypothese, die Interlanguage-Hypothese und die Pidginisierungstheorie. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle werden analysiert.
Welche Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die biologischen, soziopsychologischen und kognitiven Voraussetzungen des Zweitspracherwerbs. Dies umfasst die Bedeutung des Alters, die Rolle der Muttersprache, den Einfluss interner und externer Faktoren, Sprachlernstrategien und Verarbeitungsprozesse sowie das Codeswitching.
Welche Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs werden betrachtet?
Die Arbeit diskutiert die Vor- und Nachteile des frühen Zweitspracherwerbs im Detail und veranschaulicht diese mit Beispielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Kinder mit Migrationshintergrund, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Sprachtheorien, Cummins, Krashen, Sprachdominanz, Codeswitching, kognitive Voraussetzungen, soziokulturelle Faktoren, Lebensalter.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die Zielsetzung und Aufbau beschreibt. Es folgen Kapitel zur Begriffsbestimmung, Definition des Bilingualismus, Theorien zur Zweisprachigkeit, den Grundlagen und Voraussetzungen des Zweitspracherwerbs und schließlich ein Fazit/Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zweitspracherwerb von Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund zu untersuchen, relevante linguistische Theorien und den aktuellen Forschungsstand darzustellen und die biologischen, soziopsychologischen und kognitiven Voraussetzungen des Spracherwerbs zu beleuchten.
- Quote paper
- Ferda Özcivelek (Author), 2007, Zweitsprache Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174941