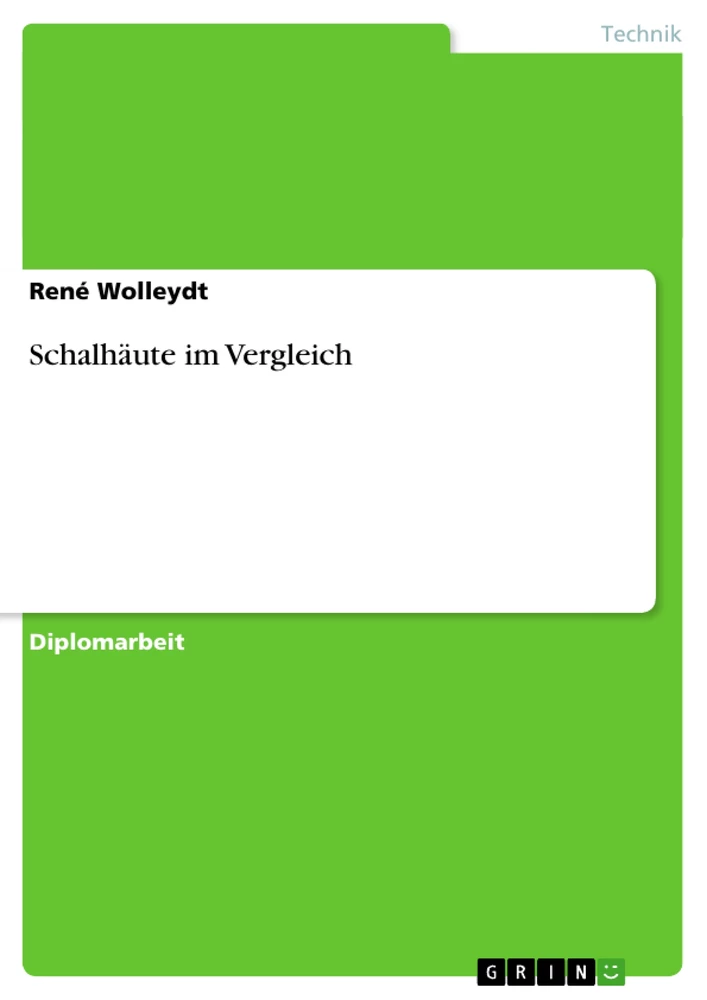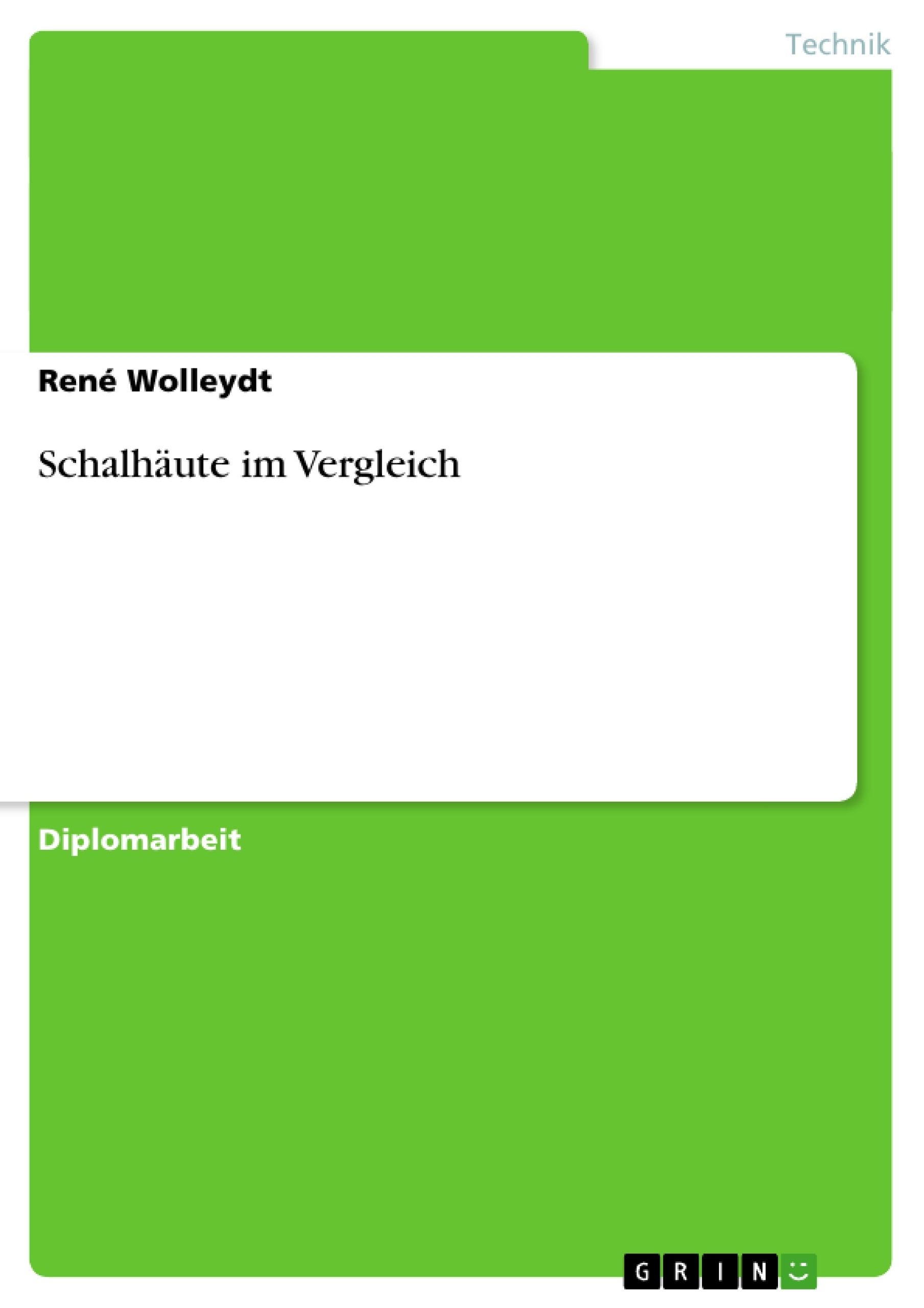Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist ein Vergleich von heute üblichen Schalhautvarianten.
Um ein gewisses Hintergrundwissen des Beton und seiner Entstehung zu erlangen, stellte ich einen geschichtlichen Überblick mit den wichtigsten Etappen zusammen.
Im Anschluss habe ich über die verschiedenen Schalhäute je eine Aufstellung der technischen Daten und dazugehörigen Normen entworfen, welche nur die Schalhäute darstellt, ohne Wertung.
Als nächstes habe ich einen Vergleich der verschiedenen Schalhäuten gemacht, in dem ich die Kriterien, Normen zur Betonoberflächenbeschaffenheit, Betonoberflächen ohne besondere Anforderungen, Betonoberflächen mit Anforderungen an das Aussehen (Sichtbeton), Prüfverfahren von Schalhäuten, Saugverhalten und Volumenänderung, Versuch: Abrieb und Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche, Betonierverhalten und Qualität der Oberfläche (Ebenheit, Farbe), Alterungsverhalten Schalhäute, Trennmitteleinsatz, Wirtschaftlichkeit, Preise im Einkauf, Einsatzzahlen, Reparatur, Reklamationspotential aufgrund der Oberflächenveränderung (Ultraviolette (UV)Strahlung, Alterung), Wiederverwertung oder Entsorgung, beleuchtet habe.
Als dritten Punkt meiner Arbeit habe ich anhand dieser Daten bestimmen können, für welchen Einsatzbereich welche Platte Sinn macht.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Historie der Schalhäute
- 1.1 Geschichtlicher Überblick
- 2 Werkstoffe der Betonschalhaut
- 2.1 Holz
- 2.1.1 Verleimung
- 2.1.2 Oberflächenbehandlung
- 2.1.3 Dreischicht – Platten (3-S-Platte)
- 2.1.4 Furniersperrholzplatten (SFU)
- 2.1.5 Stabsperrholz (SST) oder Stäbchensperrholz (SSTAE) mit Harzbeschichtung
- 2.1.6 Holzspanplatten
- 2.1.7 Verrottung von Holz
- 2.2 Metall
- 2.3 Kunststoff
- 2.3.1 Kunststoffverbundplatte aus PP (alkus)
- 2.3.2 Kunsthoffbeschichtete Furniersperrholzplatte (Primus oder X-life)
- 2.1 Holz
- 3 Vergleich der Schalhäute
- 3.1 Normen zur Betonoberflächenbeschaffenheit
- 3.1.1 Betonoberflächen ohne besondere Anforderungen
- 3.1.2 Betonoberflächen mit Anforderungen an das Aussehen (Sichtbeton)
- 3.2 Prüfverfahren von Schalhäuten
- 3.3 Saugverhalten und Volumenänderung
- 3.4 Versuch: Abrieb und Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche
- 3.4.1 1. Tag (22.03.05)
- 3.4.2 14.Tag (04.04.05)
- 3.4.3 15.Tag (05.04.05)
- 3.4.4 28.Tag (04.04.05)
- 3.4.5 29.Tag (19.04.05)
- 3.4.6 Resümee der Versuchsreihe
- 3.5 Betonierverhalten und Qualität der Oberfläche (Ebenheit, Farbe)
- 3.6 Alterungsverhalten der Schalhäute
- 3.7 Trennmitteleinsatz
- 3.8 Wirtschaftlichkeit
- 3.8.1 Preise im Einkauf
- 3.8.2 Einsatzzahlen
- 3.8.3 Reparatur
- 3.8.4 Reklamationspotential aufgrund der Oberflächenveränderung (UV, Alterung)
- 3.8.5 Wiederverwertung oder Entsorgung
- 3.1 Normen zur Betonoberflächenbeschaffenheit
- 4 Energie-Bilanz
- 4.1 Polypropylen (alkus)
- 4.2 Sperrholzplatten
- 4.3 Gegenüberstellung
- 5 Übersicht der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Vergleich verschiedener Schalhautvarianten im Baubetrieb zu liefern. Die Arbeit untersucht die Eigenschaften der verschiedenen Materialien und deren Auswirkungen auf die Qualität der Betonoberfläche. Die Ergebnisse sollen Bauunternehmen bei der Auswahl der optimalen Schalhaut für jeweilige Projekte unterstützen.
- Vergleich verschiedener Schalhautmaterialien (Holz, Metall, Kunststoff)
- Auswirkungen der Schalhaut auf die Betonoberflächenqualität (Sichtbeton, Ebenheit, Farbe)
- Wirtschaftlichkeitsanalyse der verschiedenen Schalhauttypen (Anschaffungskosten, Einsatzzahlen, Reparatur, Entsorgung)
- Prüfung des Saugverhaltens und der Volumenänderung der Schalhäute
- Energetische Bewertung der Schalhautmaterialien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Historie der Schalhäute: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung von Schalungen, beginnend mit den ersten Formen für Lehmziegel in der Steinzeit bis hin zu modernen System- und Sonderschalungen. Es beleuchtet die Entwicklung des Betons selbst und die damit verbundenen Anforderungen an die Schaltechnik, insbesondere die zunehmende Bedeutung rationeller Schalungskonstruktionen zur Senkung von Lohn- und Materialkosten. Die Entwicklung von systemlosen, zu System- und Sonderschalungen wird detailliert beschrieben und mit Abbildungen veranschaulicht.
2 Werkstoffe der Betonschalhaut: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die verschiedenen Werkstoffe, die für Schalhäute verwendet werden, mit einem Schwerpunkt auf Holz, Metall und Kunststoff. Für Holz werden verschiedene Arten wie Dreischichtplatten, Furniersperrholzplatten, Stabsperrholz und Holzspanplatten detailliert in Bezug auf Aufbau, Eigenschaften, Oberflächenbehandlung, Normen und E-Modul beschrieben. Metallschalungen und Kunststoffplatten (alkus, Primus/X-life) werden ebenfalls hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche behandelt, wobei die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien gegenübergestellt werden. Die Verleimung von Holzplatten und die Problematik der Verrottung von Holz werden eingehend diskutiert.
3 Vergleich der Schalhäute: Dieser Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert einen detaillierten Vergleich verschiedener Schalhautvarianten basierend auf verschiedenen Kriterien. Normen zur Betonoberflächenbeschaffenheit (mit und ohne besondere Anforderungen, Sichtbeton) werden erläutert. Das Kapitel beinhaltet eine umfassende Beschreibung der durchgeführten Versuche zur Bestimmung von Abrieb und Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche an verschiedenen Schalhauttypen an verschiedenen Tagen und deren Auswertung. Zusätzlich werden das Saugverhalten, die Volumenänderung, das Betonierverhalten, die Oberflächenqualität (Ebenheit, Farbe), das Alterungsverhalten, der Trennmitteleinsatz und die Wirtschaftlichkeit (Anschaffungskosten, Einsatzzahlen, Reparatur, Reklamationspotential, Wiederverwertung) der verschiedenen Schalhäute umfassend analysiert und verglichen.
4 Energie-Bilanz: Dieses Kapitel widmet sich der energetischen Bewertung der Herstellung von Polypropylen (alkus) und Sperrholzplatten. Der Energiebedarf für die Herstellung, die Verarbeitung und das Recycling der Materialien wird anhand von Diagrammen und Tabellen detailliert dargestellt und verglichen. Ziel ist es, die ökologischen Aspekte der verschiedenen Schalhautmaterialien aufzuzeigen und die Nachhaltigkeit der einzelnen Schalhauttypen zu bewerten.
5 Übersicht der Ergebnisse: Das Kapitel fasst die Ergebnisse des Vergleichs der verschiedenen Schalhauttypen zusammen. Eine Tabelle und Diagramme präsentieren eine übersichtliche Darstellung der Bewertungen der einzelnen Kriterien (Saugverhalten, Abrieb, Haftzugfestigkeit, Betonierverhalten, Alterungsverhalten, etc.). Anhand dieser Ergebnisse werden Empfehlungen für die Auswahl der optimalen Schalhaut für unterschiedliche Einsatzbereiche und Unternehmensprofile gegeben (z.B. mittelständisches Unternehmen, Mietpark).
Schlüsselwörter
Schalhäute, Betonoberfläche, Sichtbeton, Holz, Metall, Kunststoff, Polypropylen (PP), alkus, Furniersperrholz (SFU), Stabsperrholz (SST), Stäbchensperrholz (SSTAE), Dreischichtplatte (3-S), Abrieb, Haftzugfestigkeit, Saugverhalten, Volumenänderung, Wirtschaftlichkeit, Energiebilanz, Normen (DIN 18215, DIN 18217), Recycling, Oberflächenqualität, Trennmittel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vergleich verschiedener Schalhautvarianten im Baubetrieb
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht und vergleicht verschiedene Schalhautvarianten, die im Baubetrieb verwendet werden. Der Fokus liegt auf den Eigenschaften der Materialien (Holz, Metall, Kunststoff), ihren Auswirkungen auf die Betonoberfläche und der Wirtschaftlichkeit.
Welche Schalhautmaterialien werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Holz (Dreischichtplatten, Furniersperrholz, Stabsperrholz, Holzspanplatten), Metall und Kunststoff (z.B. Polypropylen-Platten wie alkus, kunstharzbeschichtete Furniersperrholzplatten wie Primus oder X-life).
Welche Kriterien werden zum Vergleich der Schalhäute herangezogen?
Der Vergleich basiert auf verschiedenen Kriterien, darunter die Betonoberflächenqualität (Sichtbeton, Ebenheit, Farbe), das Saugverhalten und die Volumenänderung der Schalhäute, der Abrieb und die Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche, das Betonierverhalten, das Alterungsverhalten, der Einsatz von Trennmitteln, die Wirtschaftlichkeit (Anschaffungskosten, Einsatzhäufigkeit, Reparatur, Entsorgung und Recycling) und die Energiebilanz der Herstellung.
Welche Versuche wurden durchgeführt?
Es wurden Versuche zur Bestimmung des Abriebs und der Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche an verschiedenen Schalhauttypen über einen Zeitraum von mehreren Tagen durchgeführt und ausgewertet (an den Tagen 1, 14, 15, 28 und 29).
Wie wird die Wirtschaftlichkeit der Schalhäute bewertet?
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse umfasst die Anschaffungskosten, die Anzahl der Einsätze, die Reparaturkosten, das Reklamationspotential aufgrund von Oberflächenveränderungen (UV-Strahlung, Alterung) und die Möglichkeiten der Wiederverwertung oder Entsorgung.
Wie wird die Energiebilanz der Schalhäute betrachtet?
Die energetische Bewertung konzentriert sich auf den Energiebedarf für die Herstellung, Verarbeitung und das Recycling von Polypropylen (alkus) und Sperrholzplatten. Die Ergebnisse werden verglichen, um die ökologischen Aspekte der verschiedenen Materialien aufzuzeigen.
Welche Normen spielen eine Rolle?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Normen zur Betonoberflächenbeschaffenheit (z.B. DIN 18215, DIN 18217).
Welche Kapitel umfasst die Diplomarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Historie der Schalhäute, den Werkstoffen der Betonschalhaut, einem Vergleich der Schalhäute, der Energiebilanz und einer Übersicht der Ergebnisse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Ergebnisse der Arbeit sollen Bauunternehmen bei der Auswahl der optimalen Schalhaut für ihre Projekte unterstützen, indem sie einen umfassenden Vergleich verschiedener Varianten bieten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schalhäute, Betonoberfläche, Sichtbeton, Holz, Metall, Kunststoff, Polypropylen (PP), alkus, Furniersperrholz (SFU), Stabsperrholz (SST), Stäbchensperrholz (SSTAE), Dreischichtplatte (3-S), Abrieb, Haftzugfestigkeit, Saugverhalten, Volumenänderung, Wirtschaftlichkeit, Energiebilanz, Normen (DIN 18215, DIN 18217), Recycling, Oberflächenqualität, Trennmittel.
- Quote paper
- René Wolleydt (Author), 2005, Schalhäute im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174735