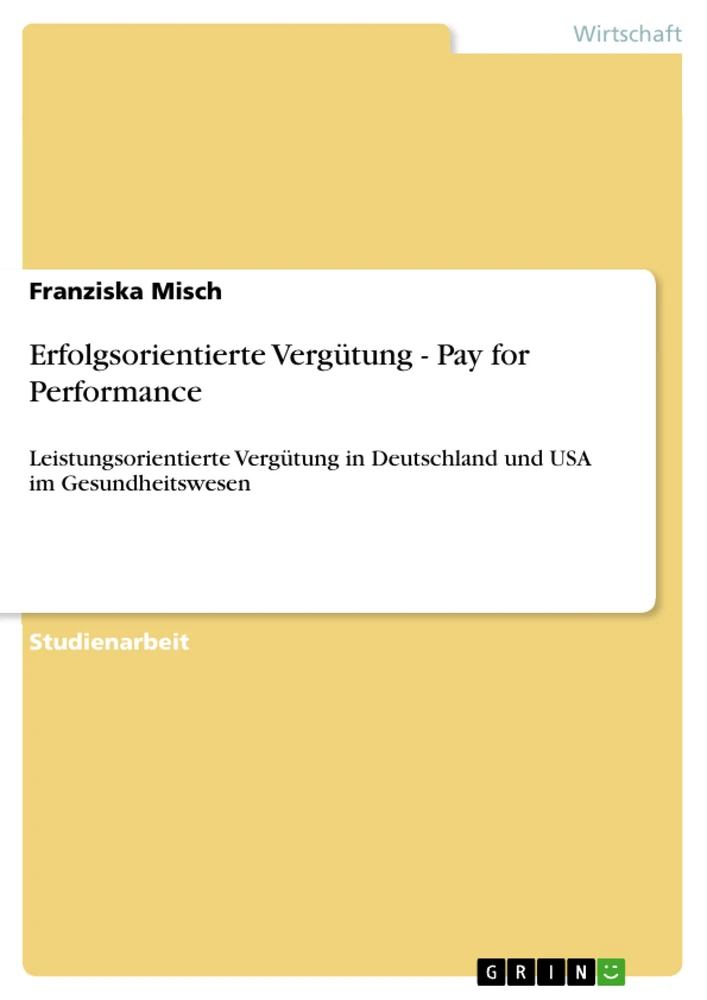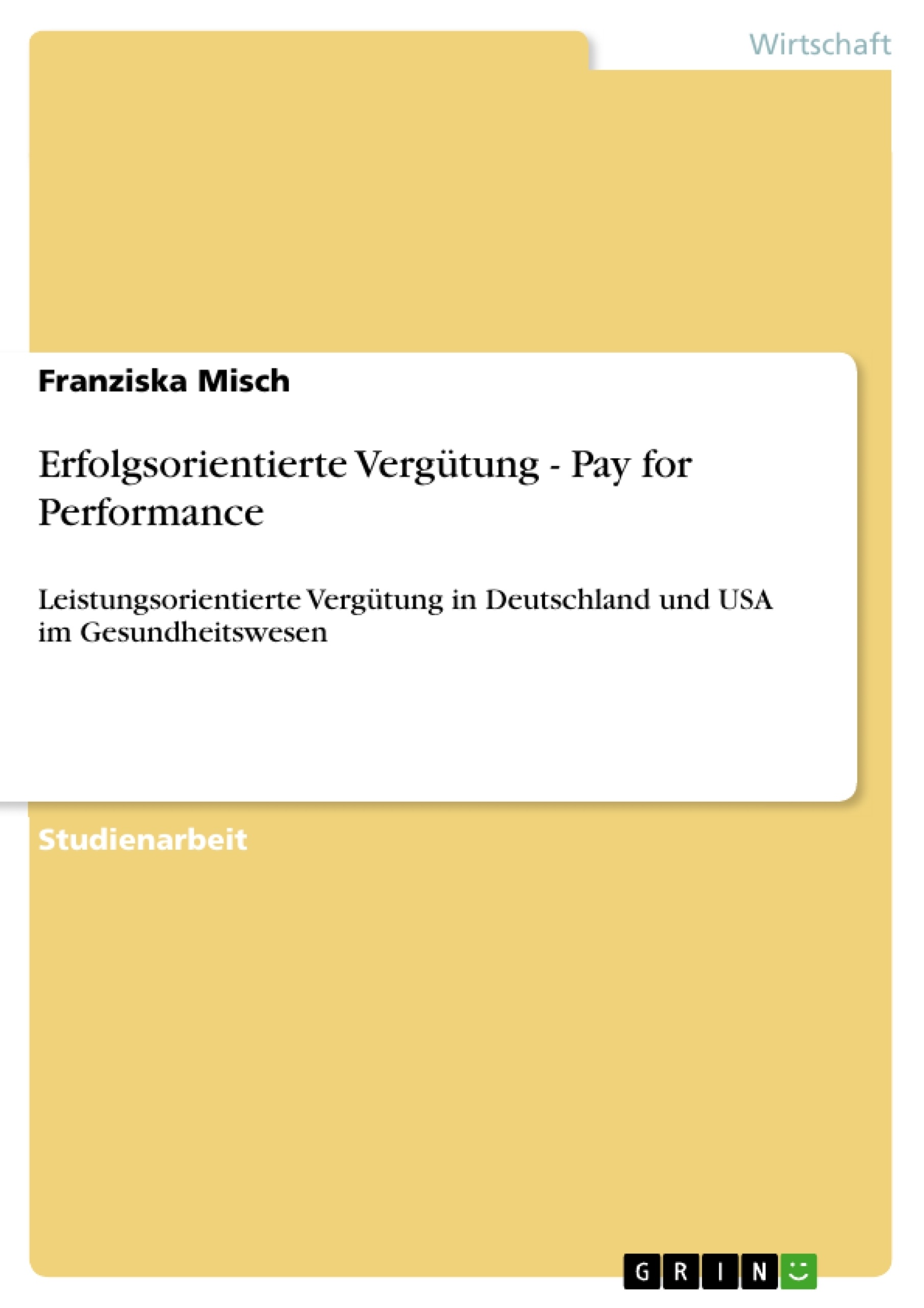1. Einleitung
Vor Einführung des DRG Systems lag im Sinne der Ertragsoptimierung der Gedanke nahe, die Aufenthaltsdauer von Patienten zu verlängern und gleichzeitig die Leistungen möglichst gering zu halten (vgl. Gerdes et al. 2009). Mit Einführung der DRGs erfolgte eine Regulierung der Aufenthaltsdauer, Leistungsträger waren gezwungen, die Aufenthaltsdauer zu verkürzen. Sowohl die vorgenommene Reduzierung der Leistungen, als auch die Verkürzung der Aufenthaltsdauer können sich hinsichtlich der Versorgungsqualität des Patienten problematisch auswirken (vgl. Gerdes et al. 2009/ Zehnder 2007). Es war notwendig geworden, neue Strategien zu entwickeln, um die Qualität der erbrachten Leistungen aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern (ebd.). Ein weiteres Problem zeigte sich mit der Feststellung, dass Kliniken mit geringer Qualität genauso belegt und vergütet werden wie die mit hoher Qualität (vgl. Zehnder 2007). Das führt dazu, dass Einrichtungen, die in Qualität investieren, tendenziell eher in ihrer Existenz bedroht sind als jene, die weniger in Innovationen investieren (ebd.). Aus diesen und anderen Fragen ergab sich die Idee zur Entwicklung eines Vergütungssystems, das für die Leistungsträger finanzielle Anreize bei der Erbringung einer möglichst guten Versorgungsqualität setzt, bekannt unter dem Begriff erfolgsorientierte Vergütung (vgl. Gerdes et al. 2009). Ansätze zur Implementierung einer erfolgsorientierte Vergütungsform können derzeit nur über Modellprojekte oder Vorhaben der integrierten Versorgung realisiert werden, da eine flächendeckende Umsetzung an der aktuellen Gesetzeslage scheitert (vgl. Lüngen, Lauterbach 2002). In den USA werden ähnliche Ansätze, unter dem Begriff Pay for Performance (P4P) verfolgt (Gerdes et al. 2009). Hier hatten Experten festgestellt, dass schwerwiegende Defizite in der Qualität der gesundheit¬lichen Versorgung herrschten (ebd.).
In der vorliegenden Arbeit wird herausgestellt, wie in verschiedenen P4P-Systemen die Behandlungsqualität der Leistungserbringer gemessen und als Basis für eine erfolgsorientierte Vergütung herangezogen wird. Dabei werden die Ziele und Funktionsweisen von P4P-Systemen in Deutschland, jeweils an einem Beispiel aus der Pflege, der Rehabilitation und der medizinischen Versorgung, sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitswesen aufgezeigt. Außerdem werden die Erfahrungen in den USA und Großbritannien hinsichtlich der Vor- und Nachteile von P4P Systemen herausgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe
- P4P-Systeme in Deutschland
- Diskussion - P4P Systeme in Deutschland
- P4P-Systeme in England und den USA
- Diskussion P4P-Systeme in England und den USA
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der erfolgsorientierten Vergütung im Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext von Pay for Performance (P4P)-Systemen. Sie analysiert die Funktionsweise und Ziele solcher Systeme, sowohl in Deutschland als auch in England und den USA. Ziel ist es, die Auswirkungen von P4P auf die Qualität der medizinischen Versorgung und das Verhalten von Leistungserbringern zu beleuchten.
- Definition und Bedeutung von erfolgsorientierter Vergütung im Gesundheitswesen
- Analyse der Funktionsweise und Ziele von P4P-Systemen
- Bewertung der Vor- und Nachteile von P4P-Systemen in Deutschland, England und den USA
- Untersuchung des Einflusses von P4P auf die Qualität der medizinischen Versorgung
- Diskussion der ethischen und rechtlichen Aspekte von P4P
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert die Problematik der traditionellen Vergütungsmodelle im Gesundheitswesen und die Notwendigkeit neuer Ansätze, um die Qualität der Versorgung zu verbessern. Sie führt den Begriff der erfolgsorientierten Vergütung ein und stellt den Zusammenhang zwischen P4P-Systemen und der Optimierung von Behandlungsergebnissen dar.
Begriffe
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "leistungsorientierte Vergütung" und "Qualität" im Gesundheitswesen. Es beleuchtet die Komplexität der Qualitätsmessung und diskutiert die unterschiedlichen Ebenen der Qualitätsbeurteilung (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) nach Avedis Donabedian. Darüber hinaus werden die Herausforderungen bei der Festlegung von Bonus- und Maluszahlungen im Kontext von Qualitätsmessungen analysiert.
P4P-Systeme in Deutschland
Dieses Kapitel stellt verschiedene Projekte zur erfolgsorientierten Vergütung in Deutschland vor und untersucht die Herausforderungen bei der Implementierung von P4P-Systemen im deutschen Gesundheitswesen. Es beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen und analysiert die Erfahrungen mit P4P-Modellen in der Pflege, der Rehabilitation und der medizinischen Versorgung.
Schlüsselwörter
Erfolgsorientierte Vergütung, Pay for Performance, Qualitätsmessung, Strukturqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität, Gesundheitswesen, Medizinische Versorgung, P4P-Systeme, Gesetzeslage, Deutschland, England, USA.
- Quote paper
- Franziska Misch (Author), 2011, Erfolgsorientierte Vergütung - Pay for Performance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174629