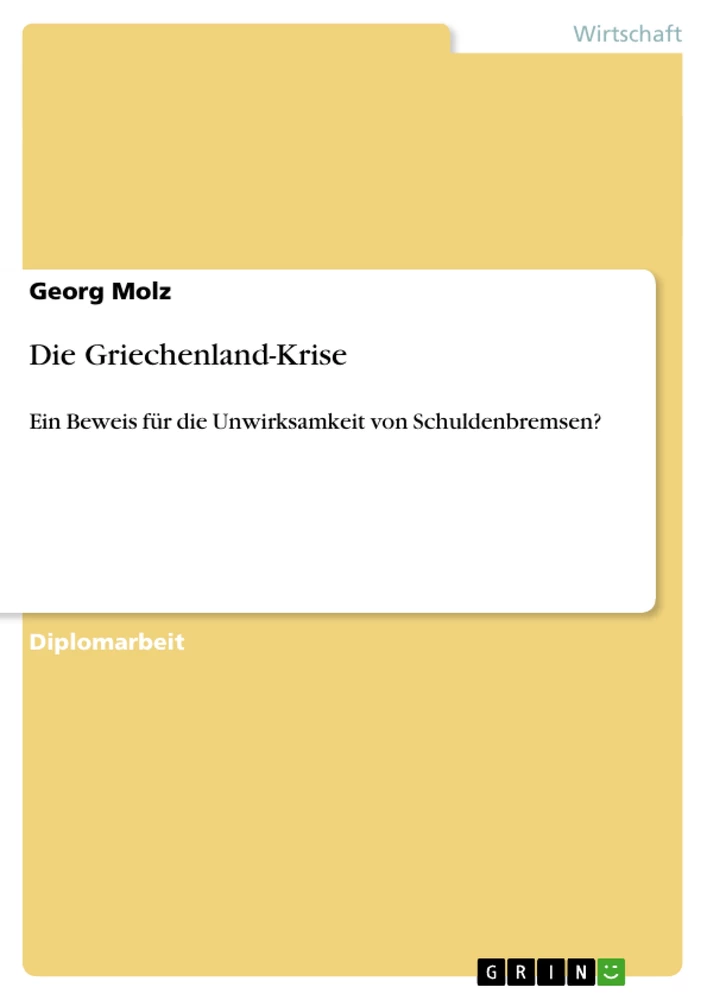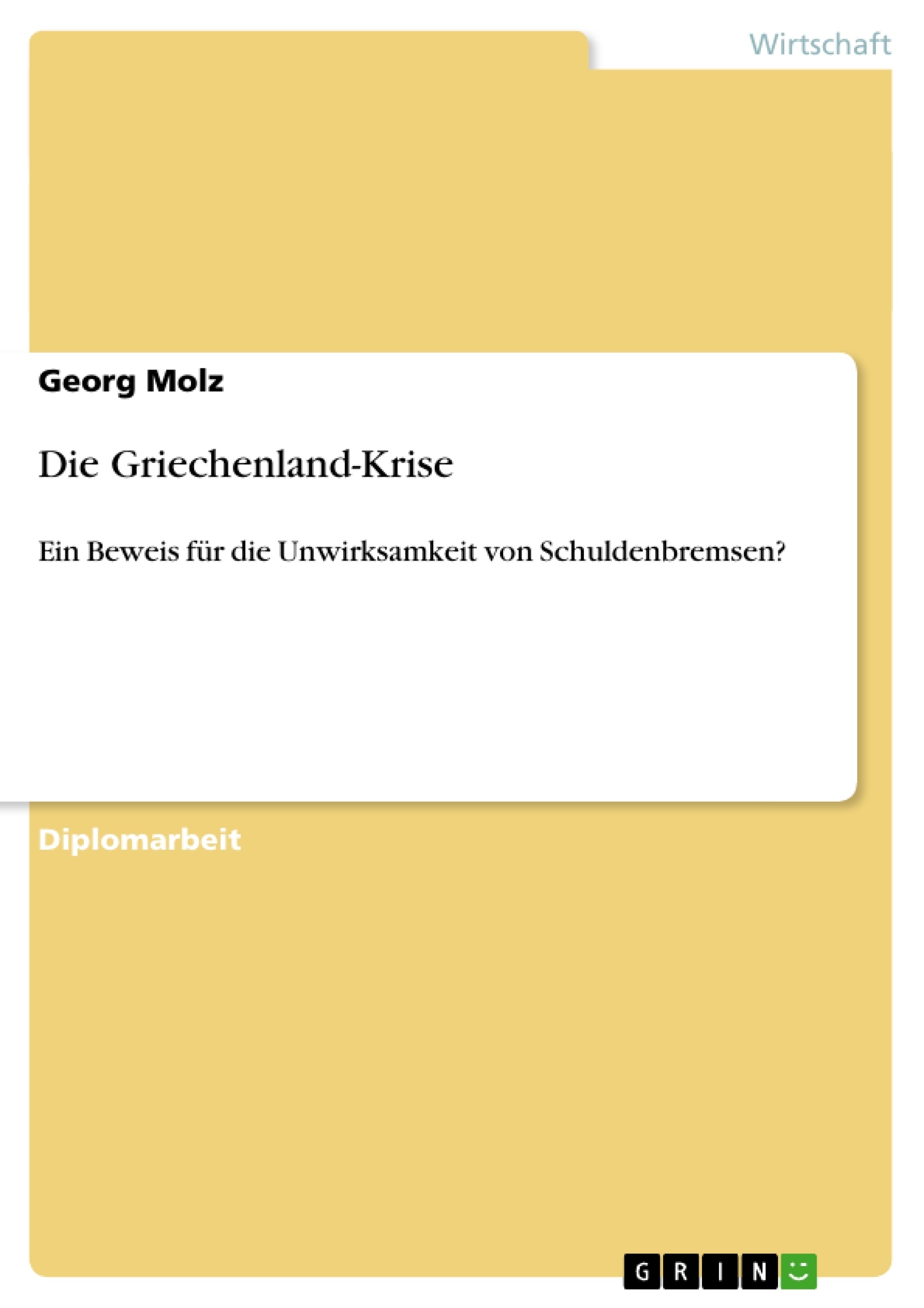In Art. 125 VAEU ist eindeutig determiniert, dass weder ein Mitgliedsstaat noch die Europäische Union für Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedsstaates haftet oder für diese eintritt. Im Mai 2010 gewährten die Euro-Länder, ungeachtet des ausdrücklichen Verbots von Schuldenübernahmen, Griechenland finanziellen Beistand von 500 Mrd. EUR, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Die erste Stufe der Hilfe bestand aus einem Notfallfonds, der bis zu 60 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt umfasste, die zweite Stufe sah die Gründung einer Zweckgesellschaft vor, die in der Lage war, 440 Mrd. EUR in Form von verzinslichen Krediten bereitzustellen. Die größten Anteile am „europäischen Rettungsschirm“ trugen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Zusätzlich zu den von den Euro-Ländern bereitgestellten Krediten, beteiligte sich der IMF mit 250 Mrd. EUR. Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone, die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank begründeten ihr Vorgehen mit dem Hinweis auf die Gefahr einer systematischen Krise, die den Euro und das Euro-Währungsgebiet in seiner Stabilität, Einheit und Integrität negativ beeinträchtigen würde.
Der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ging über Jahre hinweg ein Haushaltsdefizit voraus, welches nicht mehr tragbar war. Trotz des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, den die Gründungsväter der Europäischen Währungsunion als Schuldenbremse installierten,
akkumulierten verschiedene Regierungen Griechenlands immer mehr Schulden. Ursprünglich bestand der Zweck des Paktes darin, haushaltspolitisches Fehlverhalten zu vermeiden. Mittels
eines Sanktionsmechanismus, dessen Funktionsweise von der Glaubwürdigkeit der Sanktionsverhängung abhing, sollte diese Aufgabe erfüllt werden.
Neben der institutionellen Vorkehrung sollte außerdem die Marktdisziplin die Funktion einer Schuldenbremse erfüllen. Ein höherer Zinssatz oder eine steigende Risikoprämie sollte die
Mitgliedsstaaten von weiterer Verschuldung abhalten und das Anwachsen des Haushaltsdefizites auf ein nicht mehr tragbares Niveau verhindern. In diesem Fall ist die Glaubwürdigkeit, dass kein „bail-out“ stattfindet, die zentrale Bedingung dafür, dass die
Marktdisziplin als Schuldenbremse ohne Beeinträchtigung funktionieren kann. Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung, ob von den genannten Schuldenbremsen eine disziplinierende Wirkung auf das haushaltspolitische Verhalten Griechenlands ausging.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Die Notwendigkeit von Schuldenbremsen
- 2.1 Exzessive Schuldenaufnahmen - reale Gefahr oder Irrtum?
- 2.2 Risiken für die Europäische Währungsunion
- 3 Die Ausgestaltung von Schuldenbremsen in der Realität
- 3.1 Bundesrepublik Deutschland
- 3.2 Schweizerische Eidgenossenschaft
- 3.3 Europäische Union
- 4 Funktionsfähigkeit von Schuldenbremsen: Die Politiklösung
- 4.1 Die Anreizproblematik
- 4.2 Ein spieltheoretisches Modell
- 4.3.1 Zeitinkonsistenz
- 4.3.2 Die Glaubwürdigkeit von Sanktionen
- 4.4 Das stabilitätswidrige Verhalten Griechenlands
- 4.4.1 Die Defizitverfahren
- 4.4.2 Versagen der Politiklösung
- 5 Funktionsfähigkeit von Schuldenbremsen: Die Marktlösung
- 5.1 Der Grundgedanke einer Marktdisziplinierung
- 5.2 Vier Voraussetzungen für eine funktionsfähige Marktdisziplinierung
- 5.2.1 Beschränkungen des Kapitalverkehrs
- 5.2.2 Ausreichende Informationen
- 5.2.3 Reaktion auf Marktsignale
- 5.2.4 Glaubwürdigkeit eines „no bail-out“
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Griechenland-Krise und untersucht, ob diese als Beweis für die Unwirksamkeit von Schuldenbremsen interpretiert werden kann. Sie analysiert die Notwendigkeit von Schuldenbremsen, ihre Ausgestaltung in verschiedenen Ländern und die Funktionsfähigkeit sowohl der Politiklösung als auch der Marktlösung.
- Die Notwendigkeit von Schuldenbremsen im Kontext exzessiver Schuldenaufnahme und der Risiken für die Europäische Währungsunion
- Die Ausgestaltung von Schuldenbremsen in Deutschland, der Schweiz und der Europäischen Union
- Die Anreizproblematik und das Glaubwürdigkeitsproblem bei der Durchsetzung von Schuldenbremsen
- Die Funktionsfähigkeit von Schuldenbremsen anhand eines spieltheoretischen Modells und der Analyse des Verhaltens Griechenlands
- Die Rolle von Marktmechanismen und die Voraussetzungen für eine funktionsfähige Marktdisziplinierung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Das zweite Kapitel widmet sich der Notwendigkeit von Schuldenbremsen, wobei die Gefahren exzessiver Schuldenaufnahme und die Risiken für die Europäische Währungsunion beleuchtet werden. Das dritte Kapitel analysiert die Ausgestaltung von Schuldenbremsen in verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, die Schweiz und die Europäische Union. Das vierte Kapitel untersucht die Funktionsfähigkeit von Schuldenbremsen aus Sicht der Politik. Es analysiert die Anreizproblematik, das Glaubwürdigkeitsproblem und das stabilitätswidrige Verhalten Griechenlands. Das fünfte Kapitel erörtert die Funktionsfähigkeit von Schuldenbremsen aus Sicht des Marktes und beschreibt die Voraussetzungen für eine funktionierende Marktdisziplinierung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Diplomarbeit sind Schuldenbremsen, Griechenland-Krise, Europäische Währungsunion, Anreizproblematik, Glaubwürdigkeit, Marktdisziplinierung, „no bail-out“, Zeitinkonsistenz, Spieltheorie und Stabilitätswidriges Verhalten.
- Quote paper
- Georg Molz (Author), 2010, Die Griechenland-Krise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174294