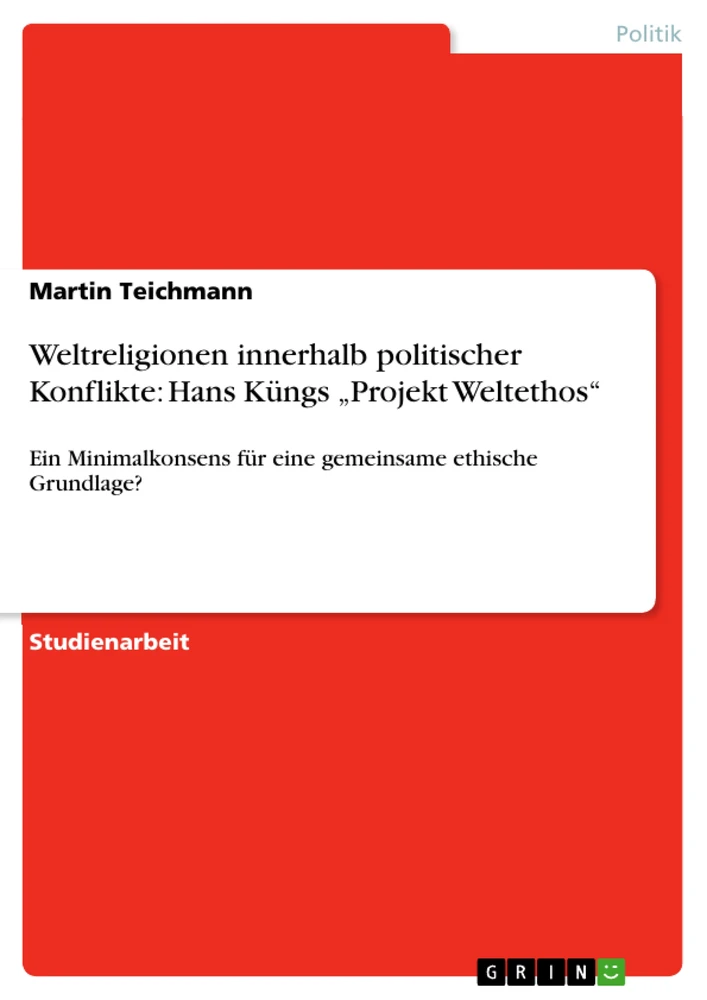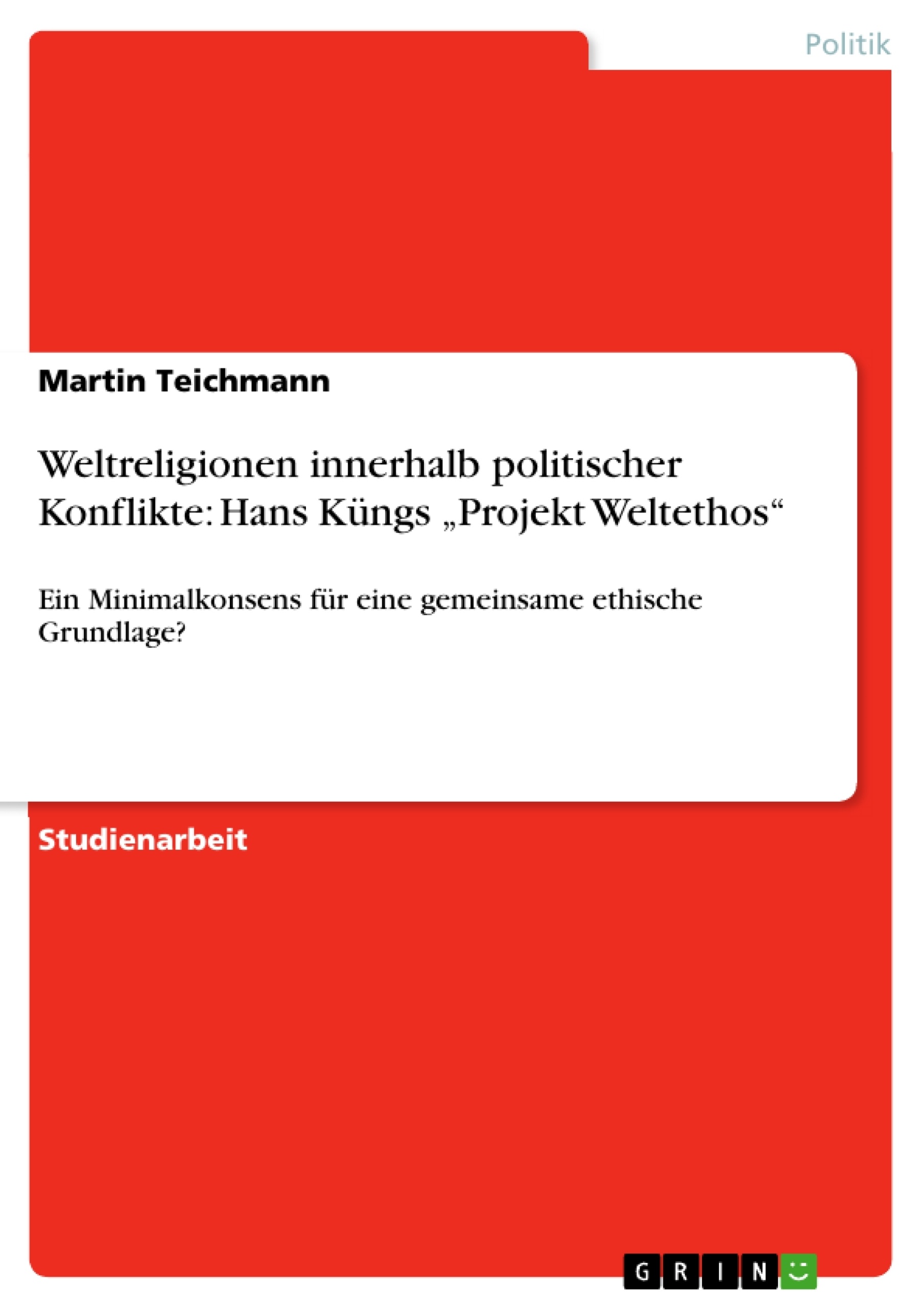„Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein Religionsfriede ohne Religionsdialog.“
Mit diesen Worten beginnt Hans Küngs vielbeachtetes Werk aus dem Jahr 2000. Das Projekt Weltethos scheint, gerade angesichts der aktuellen weltweiten politischen Situation, nichts an Aktualität oder Brisanz verloren zu haben. Eher im Gegenteil: Weist es doch einen möglichen Weg zu mehr Verständnis und Toleranz innerhalb der Menschheit auf.
Hans Küng hat das Projekt Weltethos bewusst als ein „Projekt“ bezeichnet, um dies als einen vorläufigen Versuch zu versinnbildlichen.
Der Weg dorthin könne, so Küng, nur über einen Dialog der Weltreligionen führen. Innerhalb dieses Dialogs müssen die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen herausgearbeitet werden, bieten sie doch – wie später noch präzisiert wird – die Basis für einen Minimalkonsens an humanen und ethischen Grundforderungen: Ein Kanon an Forderungen, der von den Menschen aller Religionen mitgetragen werden kann und somit die Basis für eine gemeinsame ethische Norm bietet.
Doch kann das Projekt Weltethos überhaupt nur ansatzweise das leisten, was es zu leisten proklamiert?
Kann ein gemeinsames Weltethos sowohl Menschen als einzelne Individuen als auch Völkergemeinschaften zum Zweck des Friedens dienen?
Spielt in der heutigen politischen und sozialen Weltordnung, in der immer weitere Bereiche von der Globalisierung erfasst werden, die Religion überhaupt noch eine prägende, gar tragende Rolle? Eine Rolle, der sie nach Küng zuvorderst gerecht werden muss, um den Religionsfrieden - und dem darin übergeordneten Weltfrieden – überhaupt erst zu ermöglichen?
Oder ist die Religion, gerade in den westlichen laizistischen Staatssystemen lediglich zu einer rein persönlichen, individuellen Angelegenheit verkümmert, ohne als Ganzes noch prägenden Einfluss auf Politik und Gesellschaft auszuüben? Konträr dazu steht der von den liberalen Medien hochstilisierte, Rückfall der Entwicklungs- und Schwellenländer in religiösen Traditionalismus und Fundamentalismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fortschreitende Säkularisierung sowie globale Rückkehr der Religion
- Globalisierung als neue Herausforderung für die Religionen
- Religion als historischer und politischer Faktor
- Das Gewalt- und Friedenspotential von Religionen
- Weltreligionen in Weltpolitik und Konflikten
- Primordialismus
- Instrumentalismus
- Konstruktivismus
- Christlicher und islamischer Fundamentalismus
- Die Erklärung zum Weltethos und das Parlament der Weltreligionen
- Hans Küngs Projekt Weltethos und die Stiftung Weltethos
- Menschenrechte und Menschenpflichten
- Zweifel, Kritik und Zuspruch am Weltethos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit Hans Küngs Projekt „Weltethos“ auseinander und beleuchtet dessen Bedeutung angesichts der aktuellen globalen politischen Situation. Sie untersucht, ob ein gemeinsames Weltethos einen Beitrag zur Förderung von Frieden und Verständnis innerhalb der Menschheit leisten kann. Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Religion in der heutigen Gesellschaft und insbesondere mit der Frage, ob sie im Kontext der Globalisierung eine prägende Rolle spielt.
- Das Projekt „Weltethos“ von Hans Küng als Versuch, einen Minimalkonsens für eine gemeinsame ethische Grundlage zu finden.
- Die Bedeutung von Religionsdialog und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten zwischen den Weltreligionen.
- Die Rolle der Religion in der heutigen Welt, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der Säkularisierung.
- Das Potential von Religion als Faktor für Frieden und Gewalt.
- Die Kritik und den Zuspruch, den das Projekt „Weltethos“ erfährt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Projekt „Weltethos“ von Hans Küng vor und thematisiert dessen Aktualität und Brisanz. Sie stellt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, wie die Rolle der Religion in der heutigen Gesellschaft und das Potential eines gemeinsamen Weltethos für Frieden und Verständnis.
- Fortschreitende Säkularisierung sowie globale Rückkehr der Religion: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Säkularisierung und Religiosität in der heutigen Welt. Es zeigt auf, wie der religiöse Fanatismus, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Weiterhin werden die Herausforderungen für die Kirchen im Kontext der Globalisierung und die veränderte Rolle der Religion in modernen Gesellschaften analysiert.
- Globalisierung als neue Herausforderung für die Religionen: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Globalisierung auf die Religionen und stellt die These von André Malraux in den Vordergrund, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Religion sein wird. Es geht der Frage nach, ob die Religion in der globalisierten Welt eine prägende Rolle spielt und welche Herausforderungen sie dabei zu bewältigen hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: Weltethos, Religionsdialog, Globalisierung, Säkularisierung, Religion, Frieden, Gewalt, Fundamentalismus, Menschenrechte, Menschenpflichten, Kritik, Zuspruch.
- Quote paper
- Martin Teichmann (Author), 2011, Weltreligionen innerhalb politischer Konflikte: Hans Küngs „Projekt Weltethos“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174247