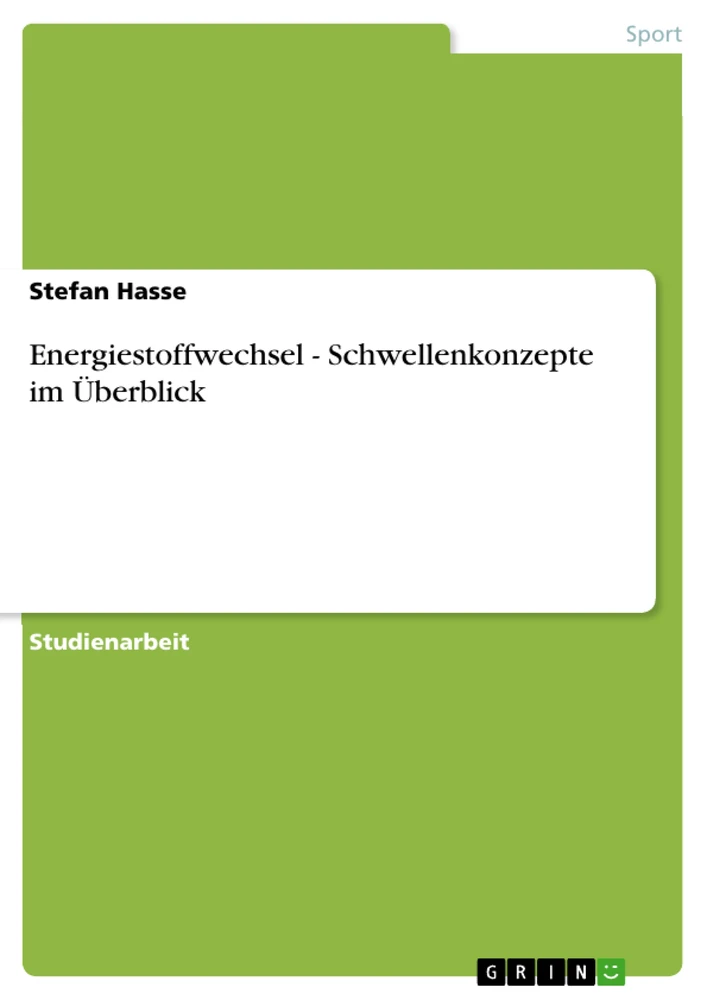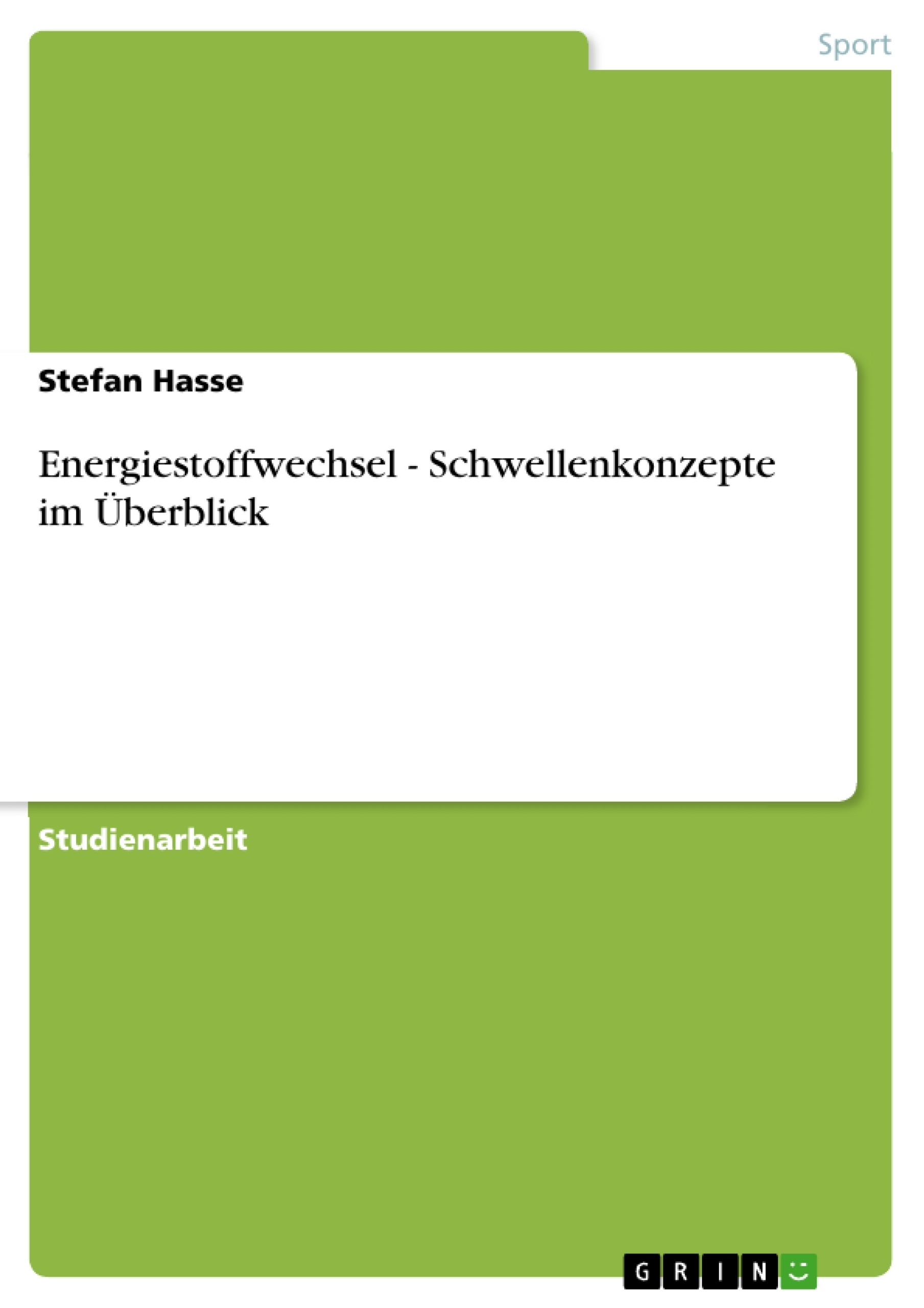Vor einer Auseinandersetzung mit der Thematik „Energiestoffwechsel – Aspekte unterschiedlicher Schwellenkonzepte“ soll der Aufbau dieser Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Entwicklungsgemäßes Training“ dargelegt werden. Die Ausführungen beginnen in Kapitel 2 mit den Grundlagen des Energiestoffwechsels und den unterschiedlichen Energiebereitstellungs- bzw. Resynthesewegen, da diese grundlegend für jede sportliche Aktivität sind. Somit beinhaltet der Punkt 2.1 die anaerob-alaktazide ATP-Resynthese über das Kreatinphosphat. Im Anschluss folgen unter Abschnitt 2.2 der anaerobe und der aerobe Weg der Glykolyse. Die Ausführungen zu der aerob-alaktaziden Lipolyse unter Punkt 2.3 schließen die Grundlagen des Energiestoffwechsels.
Im Übergang zu der Thematik der Schwellenkonzepte wird unter Kapitel 3.1 zunächst die Allgemeine Definition der Schwelle dargelegt, um im Folgenden drei Schwellenkonzepte auf der Basis der Laktatmessung darzustellen (Kapitel 3.2). Die chronologische Reihenfolge beibehaltend widmet sich der Unterpunkt 3.2.1 der aerob-anaeroben Schwelle nach Mader (1976), Abschnitt 3.2.2 dem Schwellenkonzept nach Keul (1979) und Punkt 3.2.3 dem Schwellenkonzept nach Stegmann (1981).
Unter Kapitel 4 schließen zusammenfassende Aspekte sowie Auswirkungen der Schwellenkonzepte auf die Trainingssteuerung die Ausführungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Energiebereitstellung
- 2.1 Anaerob-alaktazide ATP-Resynthese (Kreatinphosphat)
- 2.2 ATP-Resynthese über die Glykolyse
- 2.2.1 Anaerob-laktazide ATP-Resynthese (Anaerobe Glykolyse)
- 2.2.2 Aerob-alaktazide ATP-Resynthese (Aerobe Glykolyse)
- 2.3 Aerob-alaktazide ATP-Resynthese (Lipolyse)
- 2.4 Vergleich der Energiebereitstellungswege
- 3 Schwellenkonzepte
- 3.1 Allgemeine Definition der Schwelle
- 3.2 Schwellenkonzepte auf der Basis der Laktatmessung
- 3.2.1 Aerob-anaerobe Schwelle nach Mader (1976)
- 3.2.2 Schwellenkonzept nach Keul (1979)
- 3.2.3 Schwellenkonzept nach Stegmann (1981)
- 4 Aspekte und Auswirkungen der Schwellenkonzepte auf die Trainingssteuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Grundlagen des Energiestoffwechsels und verschiedenen Schwellenkonzepten, um deren Bedeutung für die Trainingssteuerung zu beleuchten. Dabei wird die Funktionsweise der ATP-Resynthese und deren unterschiedliche Wege, darunter die anaerobe und aerobe Glykolyse sowie die Lipolyse, erläutert.
- Energiebereitstellung im menschlichen Körper
- Anaerobe und aerobe Energiegewinnung
- Verschiedene Schwellenkonzepte und ihre Bedeutung
- Einfluss der Schwellenkonzepte auf die Trainingssteuerung
- Optimale Trainingssteuerung durch gezielte Belastungssteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der Energiebereitstellung im menschlichen Körper. Es wird die Bedeutung von ATP als Energielieferant für Muskelkontraktionen dargestellt und die verschiedenen Resynthesewege, wie die anaerob-alaktazide ATP-Resynthese über das Kreatinphosphat, die anaerobe und aerobe Glykolyse sowie die Lipolyse, detailliert beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit Schwellenkonzepten und definiert den Begriff der Schwelle. Im Folgenden werden drei verschiedene Schwellenkonzepte auf der Basis der Laktatmessung vorgestellt: die aerob-anaerobe Schwelle nach Mader (1976), das Schwellenkonzept nach Keul (1979) und das Schwellenkonzept nach Stegmann (1981).
Schlüsselwörter
ATP-Resynthese, anaerob, aerob, Kreatinphosphat, Glykolyse, Lipolyse, Laktat, Laktatmessung, Schwellenkonzepte, Mader, Keul, Stegmann, Trainingssteuerung, Belastungssteuerung.
- Citar trabajo
- Stefan Hasse (Autor), 2010, Energiestoffwechsel - Schwellenkonzepte im Überblick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174233