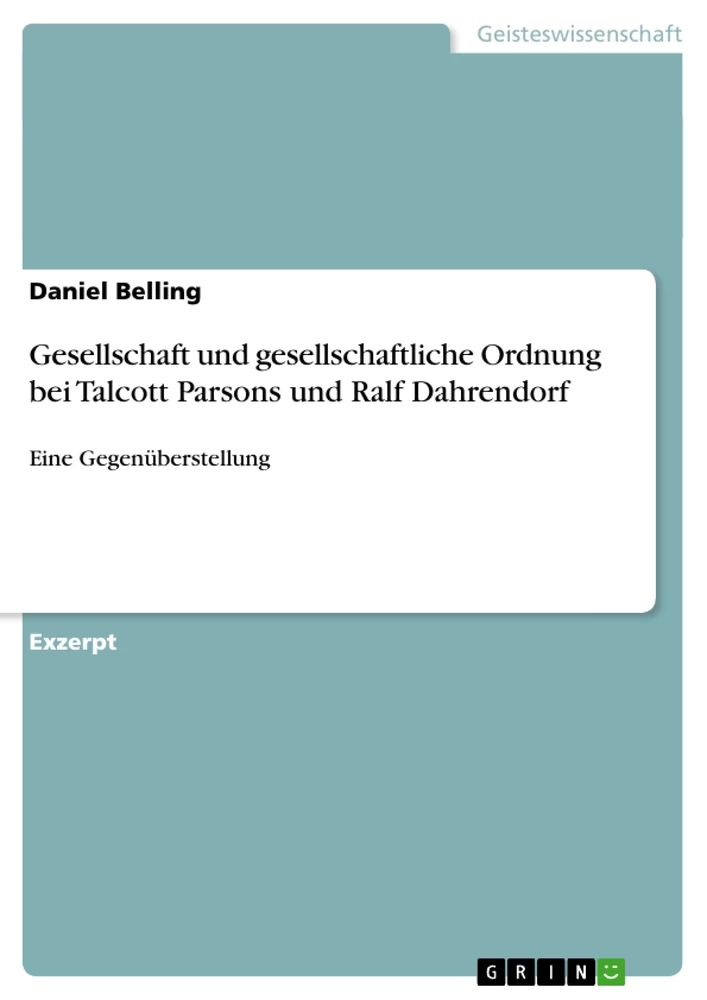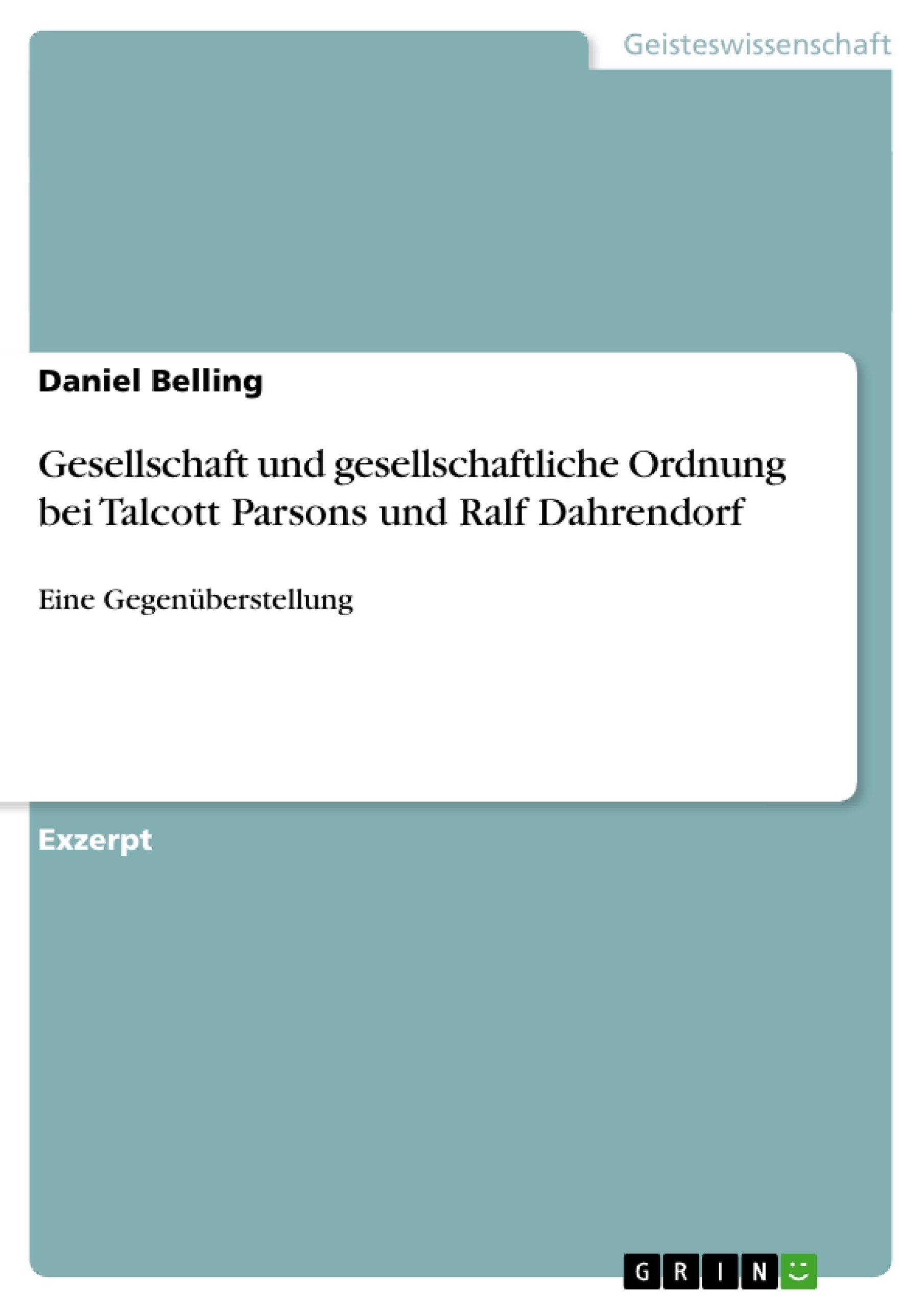Auf der Grundlage zweier Texte der beiden Autoren werden die theoretischen Annahmen über gesellschaftlichen Wandel und die Rolle von sozialen Konflikten verglichen.
Daniel Belling
Gesellschaft und gesellschaftliche Ordnung bei Talcott Parsons und Ralf Dahrendorf
Talcott Parsons gilt als Begründer der strukturfunktionalistischen Theorie - für ihn ist Gesellschaft ein System, welches seinen Zweck in seiner Selbsterhaltung wahmimmt. Dahrendorf untersucht die implizierten Postulate der Parsons'schen Theorie, entwickelt dazu einen diametralen Entwurf und bemüht sich anschließend um ein synthetisches Modell, indem die Bedeutung des sozialen Konflikts in angemessener Weise zum Tragen kommt.
Auf der Grundlage der am Ende aufgeführten Literatur möchte ich im vorliegenden Text die beiden Gesellschaftsauffassungen beschreiben und die Bedeutung des sozialen Wandels und der sozialen Konflikte heraussteilen.
Das soziale System bei In seiner morphologischen Analyse der Systemstrukturen definiert
Talcott Parsons Parsons das soziale System in seinem Außenverhältnis als „offenes“
System, welches mit den Systemen die es umgeben (darunter ebenso andere soziale Systeme) in mehr oder weniger stark ausgeprägten Austauschprozessen steht. Die innere Gliederung des sozialen Systems ist "sowohl funktional als auch hinsichtlich des Grades der Spezifizierung und Segmentierung [in ihre] Einheiten differenziert“ (Parsons 1969, S. 36). Nach seiner Aussage ist dies für die Erhaltung der Struktur des Systems auch dringend erforderlich:
Wie oben bereits erwähnt, besteht die oberste Maxime in der Aufrechterhaltung des Systems - als „funktional“ werden somit all jene Aspekte bezeichnet, die diesem Zweck dienlich sind. Den vier grundlegenden und zur Existenz benötigten Funktionen, die Parsons ausmacht, nehmen sich innerhalb des sozialen Systems vier Subsysteme an: das Kultursystem dient der Erhaltung der Institutionen, indem es Systemwerte kreiert und implementiert; das soziale System wirkt durch die Vermittlung allgemeiner Normen integrativ auf den Einzelnen ein; die Zielverfolgung basiert auf individuellen Motivationen, welche ihren Ursprung in den Persönlichkeitssystemen haben; und schließlich muss das System - als eine Art Organismus - seine Fähigkeiten zur Adaption an geänderte Umweltbedingungen einsetzen.
Gleichgewicht und In Parsons „dynamischer“ Analyse der Systemprozesse unterscheidet er Strukturwandel die Perspektive der Gleichgewichtsanalyse von der Perspektive des Strukturwandels. „Die erstere nimmt bestimmte Strukturen als gegeben an; die letztere versucht den Wandel solcher Strukturen selbst zu erklären“ (ebd.). Kommt es innerhalb eines Subsystems zu einem Konflikt, wirken die vier funktionalen Aspekte in der Weise, dass sie den ursprünglichen Zustand wieder hersteilen wollen - Parsons weist hierbei Kontroll- mechanismen (wie Geld und Macht), sowie gesellschaftlichen Ressourcen (wie z.B. die Kontrolle über Güter- und Informationsflüsse) eine besondere Rolle zu, da durch sie die Struktur erhaltenden Prozesse zusätzlich verstärkt werden.
Es können allerdings nicht alle Störfaktoren durch die regulierende Wirkung der Systemfunktionen eliminiert werden. An dieser Stelle nimmt Parsons die Perspektive des Strukturwandels ein und erläutert: „Strukturwandel kann man als das Gegenteil der Ausgleichs- und Gleichgewichtsprozesse ansehen; diese Unterscheidung bestimmt sich danach, ob die „Grenzen“ des Systems aufrecht erhalten werden oder nicht.“ (ebd.) Diese Grenzen sind also jener wunde Punkt eines Systems, an dem seine innere Struktur den Störfaktor weder isolieren noch abfangen kann, sodass dieser daraufhin seine ganze Wirkungskraft entfaltet. Das System ist dann zu einer Transformation seiner Struktur genötigt. Es gilt festzuhalten, dass sich bei Parsons exogene Einflüsse in gleicher Weise im sozialen System als Störfaktoren bemerkbar machen können.
Doch auf die zentrale Frage, die sich im Anschluss an diese Erklärung stellt, bleibt Parsons Modell unbefriedigend: Wie kann es überhaupt zu solchen Störfaktoren kommen, wo es doch so scheint, als würden sich alle Elemente des Systems zu einem harmonischen Ganzen fügen[I] ? Viele Kritiken des Parsons'schen Modells setzen an eben dieser Stelle an.
Der britisch-deutsche Soziologe Ralf Dahrendorf beklagt: „Der strukturell-funktionale Ansatz hat für solche Fälle ein bequemes Etikett: sie sind „dysfunktionale“ Organisationen, Institutionen oder Prozesse. Aber diese Bezeichnung sagt uns weniger als nichts.“ (Dahrendorf 1969, S. 112) Und dennoch testiert Dahrendorf, dass „die Kritik an der Unbrauchbarkeit der strukturell-funktionalen Theorie für die Analyse von Konflikt und Wandel sich nur gegen den Allgemeinanspruch dieser Theorie wenden kann (...)“ (ebd., S.113).
Ein erklärtes Ziel muss es sein, die scheinbaren Antagonismen von Stabilität und Wandel, von Integration und Konflikt durch die Einführung neuer Modelle zu überbrücken. Der Ansatz Talcott Parsons betrachtet vorrangig das Problem der Stabilität, vernachlässigt jedoch die Rolle der sozialen Konflikte. So entwirft Dahrendorf ein antithetisches Modell des sozialen Wandels, indem er sich an Parsons implizierten Postulaten orientiert (vgl. Dahrendorf 1969, S. 112):
1. Die Gesellschaft ist nun nicht mehr länger ein stabiles Gefüge, sondern zujedem Zeitpunkt im Wandel begriffen;
2. Dies impliziert, dass der Konflikt als Motor des Wandels in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden ist;
3. Daraus folgt, dass die Elemente des Systems nun nicht mehr zum Funktionieren, sondern zur Veränderung der Gesellschaft beitragen;
4. Statt eines Konsenses beruht die Gesellschaft auf Zwängen, welche zwischen den Mitgliedern vorherrschen.
Es ist leicht einzusehen, dass auch dieses Modell für sich allein genommen ebenso unvollkommen ist. Der Unterschied ist, dass sich hier keine stabilen und integrativen Momente, sondern Situationen der Unsicherheit reproduzieren. Die gesellschaftliche Wirklichkeit - soviel ist sicher - beinhaltet gewisse Aspekte beider Modelle. Hierin zeigt sich das Doppelgesicht der Gesellschaft. Dennoch ist es „unmöglich, mit den Mitteln der empirischen Forschung zu entscheiden, welches der beiden Modelle richtiger ist; die Postulate sind keine Hypothesen (...)“ (ebd., S.113).
Weiter heißt es: „Möglicherweise ist eine allgemeine Theorie denkbar, die die Koexistenz des Unvereinbaren, die Gleich-Gültigkeit der beiden Modelle auf höherer Ebene aufhebt“ (ebd.). Bevor esjedoch soweit kommen kann, muss sich primär eine wissenschaftliche Theorie des sozialen Konflikts etablieren. Basierend auf den oben umrissenen Postulaten und unter Verwendung ähnlicher Kategorien wie bei der Integrationstheorie, muss sie dem Wissenschaftler operationalisierbare Anhaltspunkte geben können, damit dieser anhand empirischen Materials soziale Phänomene auf strukturelle Bedingungen zurückführen kann.
Dahrendorf weist auf die besondere Bedeutung hierarchischer Strukturen hin. Im Gegensatz zu Parsons, der in der Ausübung von Macht einen stabilisierenden Kontrollmechanismus sieht, nimmt Dahrendorf Max Webers Definition von „Herrschaft“ auf und erläutert, dass (trotz des hinzukommenden Aspektes der Legitimation) im Herrschaftsverband eine wesentliche Quelle sozialer Konflikte angesiedelt ist.
„Die Dichotomie sozialer Rollen in Herrschaftsverbänden, ihre Teilung in positive und negative Herrschaftsrollen, ist eine soziale Strukturtatsache. Wenn und insofern soziale Konflikte sich auf diesen Tatbestand zurückführen lassen, sind sie strukturell erklärt“ (ebd., S.116) So bilden sich nach Dahrendorf zwei Quasigruppen mit vorerst latenten, voneinander unterscheidbaren Interessen. In einem zweiten Schritt bewirken bestimmte soziale, technische und politische Bedingungen eine Interessenartikulation. Folglich organisieren sie sich zu Interessengruppen.
In einer Gesellschaft muss ein großes Maß an sozialer Mobilität und effektive Regulierungsmechanismen vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, so führen die divergierenden Interessen der beiden Gruppen zu einem Konflikt, in dem die „Systemfrage“ gestellt wird. Daraus folgt der wahrscheinlich interessanteste Aspekt in Dahrendorfs Modell: Während es den einen um die Erhaltung des Status quo geht, möchten die anderen diesen überwinden.
Kommt es zu einem Strukturwandel, so deshalb, weil die beherrschte Gruppe ein ausreichend großes Druckpotential aufgebaut hat, während die herrschende Gruppe diesem nicht mehr länger beharren kann. Nun haben sich die Herrschaftsverhältnisse umgekehrt und der soziale Wandel wurde auf theoretisch angemessene Weise beschrieben.
Literaturhinweise
Parsons, Talcott (1969): Das Problem des Strukturwandels: Eine theoretische Skizze. In: Zapf, Wolfgang [Hrsg.]: Theorien des sozialen Wandels. 4969. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch. S.35-54
Dahrendorf, Ra]lf (1969): Zu einer Theorie des sozialen Konflikts. In: Zapf, Wolfgang [Hrsg.]: Theorien des sozialen Wandels. 4969. Köln/Berlin: Kiepenheuer& Witsch. S.108-123
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Gesellschaft und gesellschaftliche Ordnung bei Talcott Parsons und Ralf Dahrendorf"?
Der Text vergleicht und kontrastiert die Gesellschaftstheorien von Talcott Parsons und Ralf Dahrendorf. Parsons wird als Begründer der strukturfunktionalistischen Theorie betrachtet, bei der die Gesellschaft als ein System zur Selbsterhaltung gesehen wird. Dahrendorf kritisiert Parsons' Theorie und entwickelt einen eigenen Ansatz, der die Bedeutung des sozialen Konflikts hervorhebt. Ziel ist es, die beiden Gesellschaftsauffassungen zu beschreiben und die Bedeutung des sozialen Wandels und der sozialen Konflikte herauszustellen.
Wie definiert Parsons das soziale System?
Parsons definiert das soziale System als "offenes" System, das mit seiner Umwelt in Austausch steht. Es ist funktional und hinsichtlich seiner Einheiten differenziert. Die oberste Maxime ist die Aufrechterhaltung des Systems. Vier Subsysteme dienen der Erhaltung der Institutionen (Kultursystem), der Integration des Einzelnen (soziales System), der Zielverfolgung (Persönlichkeitssysteme) und der Anpassung an Umweltbedingungen.
Was sind Gleichgewicht und Strukturwandel nach Parsons?
Parsons unterscheidet zwischen der Gleichgewichtsanalyse, die Strukturen als gegeben annimmt, und der Perspektive des Strukturwandels, die den Wandel selbst zu erklären versucht. Konflikte innerhalb eines Subsystems werden durch Kontrollmechanismen und gesellschaftliche Ressourcen zu beseitigen versucht, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Wenn Störfaktoren nicht eliminiert werden können, ist das System zu einem Strukturwandel gezwungen.
Welche Kritik übt Dahrendorf an Parsons' Theorie?
Dahrendorf kritisiert, dass Parsons' Theorie die Rolle sozialer Konflikte vernachlässigt und "dysfunktionale" Organisationen oder Prozesse nur etikettiert, ohne sie zu erklären. Er betont, dass die Kritik sich gegen den Allgemeinanspruch der Theorie richtet.
Wie lautet Dahrendorfs antithetisches Modell des sozialen Wandels?
Dahrendorfs Modell basiert auf folgenden Postulaten: Die Gesellschaft ist ständig im Wandel; Konflikt ist der Motor des Wandels; die Elemente des Systems tragen zur Veränderung der Gesellschaft bei; und die Gesellschaft beruht auf Zwängen, nicht auf Konsens. Dieses Modell allein ist jedoch auch unvollkommen, da es stabile und integrative Momente vernachlässigt.
Was ist die Bedeutung hierarchischer Strukturen nach Dahrendorf?
Dahrendorf betont die Bedeutung hierarchischer Strukturen als Quelle sozialer Konflikte. Er nimmt Max Webers Definition von "Herrschaft" auf und erläutert, dass Herrschaftsverbände eine wesentliche Quelle sozialer Konflikte sind.
Wie kommt es zu einem Strukturwandel nach Dahrendorf?
Ein Strukturwandel kommt zustande, wenn die beherrschte Gruppe ein ausreichend großes Druckpotential aufgebaut hat und die herrschende Gruppe diesem nicht mehr standhalten kann. Dadurch kehren sich die Herrschaftsverhältnisse um.
- Quote paper
- Daniel Belling (Author), 2008, Gesellschaft und gesellschaftliche Ordnung bei Talcott Parsons und Ralf Dahrendorf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173862