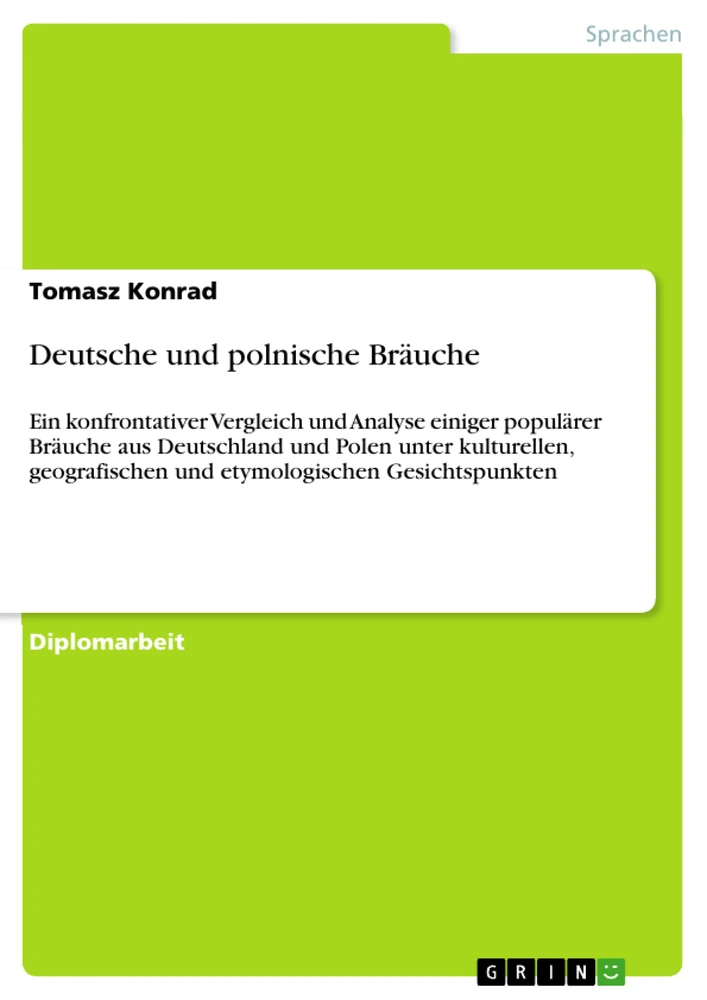Eine Analyse duetscher und polnischer Bräuche in Bezug auf die Kultur, Umsetzung, aktuelle Praxis und im Vergleich mit dem jeweils anderem Land. Die Bedeutung von Traditionen und Bräuchen im Alltag in beiden Ländern. Wozu braucht eine Gesellschaft Traditionen? Welche Rolle spielt der Aberglaube? Ist die Religion ein wichtiger Bestandteil von Traditionen? Wenn ja, warum? All diese Fragen und noch viele andere werden in dieser Diplomarbeit analysiert und ausführlich erläutert. Den Praxisbezug bilden zahlreiche Beispiele des Alltags aus Polen und Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Untersuchungsgegenstand und Zielsetzung
- Quellenwahl
- Begriffsdefinitionen
- Deutsche Begriffe
- Tradition [Poln.: tradycja]
- Usus [Poln.: uzus]
- Brauch [Poln.: obrzęd]
- Ritual/ Ritus [Poln.: rytuał]
- Feiertag [Poln.: święto]
- Polnische Begriffe
- tradycja [Dt.: Tradition]
- obrzęd [Dt.: Brauch]
- święto [Dt.: Feiertag]
- zwyczaj -> obyczaj [Dt.: Gewohnheit -> Brauch/ Sitte]
- usus [Dt.: Usus]
- Kurze Zusammenfassung
- Populäre Bräuche in Deutschland
- Das Oktoberfest
- Über die Tradition
- Vergleich mit Polen
- Reformationstag
- Über die Tradition
- Vergleich mit Polen
- Martinstag
- Über die Tradition
- Vergleich mit Polen
- Spruchweisheiten zum Martinstag
- Populäre Bräuche in Polen
- Imieniny [Dt.: Namenstag]
- Über die Tradition
- Vergleich mit Deutschland
- Andrzejki [Dt.: Andreastag]
- Studniówka
- Über die Tradition
- Vergleich mit Deutschland
- Gemeinsame Bräuche in Polen und Deutschland
- Aprilscherz
- Über die Tradition
- Ostern
- Über die Tradition
- Die Symbole des Osterfestes
- Sorbische/ wendische Osterbräuche in Deutschland
- Śmigus-dyngus in Polen [Dt.: „,nasser Montag”]
- Sommersonnenwende und Johannestag [Poln.: letnie przesilenie i Noc Świętojańska]
- Importiertes Brauchtum
- Valentinstag
- Halloween
- Aberglaube
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit einem konfrontativen Vergleich und einer Analyse beliebter Bräuche in Deutschland und Polen unter kulturellen, geografischen und etymologischen Gesichtspunkten. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Bräuchen beider Länder aufzuzeigen und die Gründe für diese Unterschiede zu analysieren.
- Vergleich von Bräuchen in Deutschland und Polen
- Kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Einfluss von Geschichte und Religion auf Bräuche
- Etymologie von Bräuchen und Traditionen
- Die Bedeutung von Traditionen in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation für die Arbeit sowie den Untersuchungsgegenstand und die Zielsetzung erläutert. Es folgt ein Kapitel, das die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Bräuchen und Traditionen definiert, sowohl im Deutschen als auch im Polnischen.
Anschließend werden die populären Bräuche in Deutschland und Polen vorgestellt, wobei die Traditionen, die Geschichte und der Vergleich mit dem anderen Land im Vordergrund stehen.
Das Kapitel über gemeinsame Bräuche beleuchtet Traditionen, die in beiden Ländern gefeiert werden, wie Ostern und der Aprilscherz, und stellt regionale Unterschiede und Besonderheiten heraus.
Ein Kapitel über Aberglaube rundet die Analyse der Bräuche ab.
Schlüsselwörter
Deutsche und polnische Bräuche, Tradition, Kultur, Vergleich, Analyse, Etymologie, Geschichte, Religion, Moderne Gesellschaft, Aberglaube, Oktoberfest, Reformationstag, Martinstag, Imieniny, Studniówka, Ostern, Aprilscherz, Sommersonnenwende, Johannestag, Valentinstag, Halloween.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die bekanntesten deutschen Bräuche?
Die Arbeit behandelt populäre Bräuche wie das Oktoberfest, den Reformationstag und den Martinstag und vergleicht diese mit polnischen Traditionen.
Welche Bräuche sind in Polen besonders wichtig?
Hervorgehoben werden der Namenstag (Imieniny), der Andreastag (Andrzejki) und die "Studniówka", ein traditioneller Ball hundert Tage vor dem Abitur.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es beim Osterfest?
Beide Länder feiern Ostern mit Symbolen wie dem Ei. Ein spezifisch polnischer Brauch ist der "Śmigus-dyngus" (nasser Montag), während in Deutschland sorbische Osterbräuche erwähnt werden.
Was ist der Unterschied zwischen "Brauch" und "Tradition"?
Die Arbeit liefert Begriffsdefinitionen für beide Sprachen und erläutert die Nuancen zwischen Tradition, Usus, Ritual und Brauch.
Welche Rolle spielt der Aberglaube in beiden Kulturen?
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Aberglauben und wie dieser Bräuche und den Alltag in Deutschland und Polen bis heute beeinflusst.
Wie wirken sich importierte Bräuche wie Halloween aus?
Die Arbeit analysiert, wie moderne Einflüsse wie Valentinstag oder Halloween in die traditionelle Kultur beider Länder aufgenommen werden.
- Quote paper
- Tomasz Konrad (Author), 2011, Deutsche und polnische Bräuche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173847