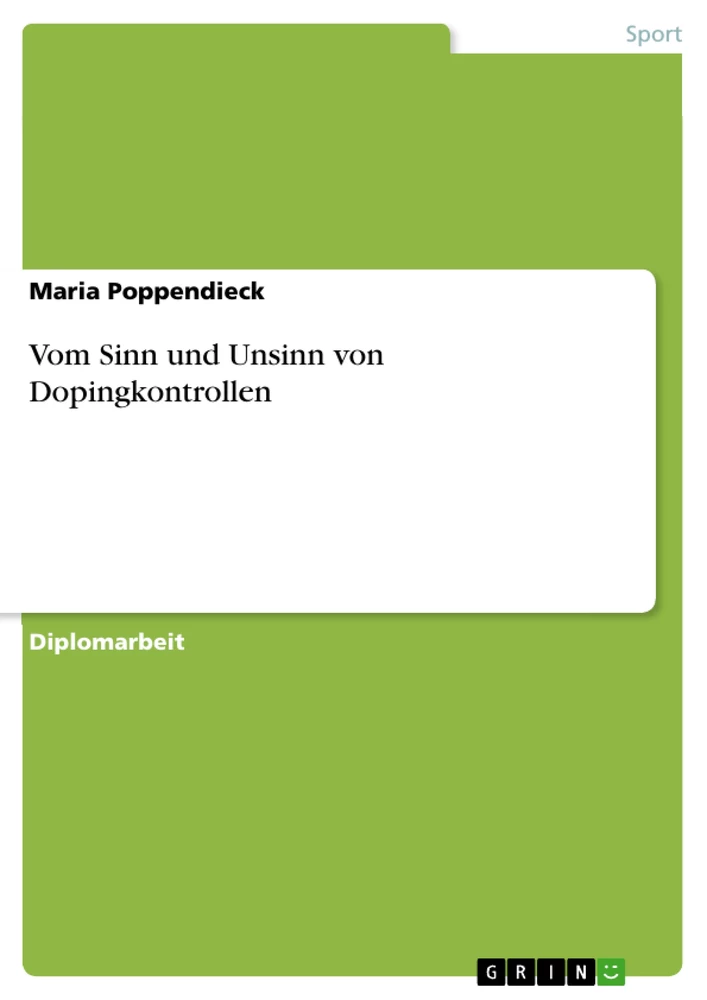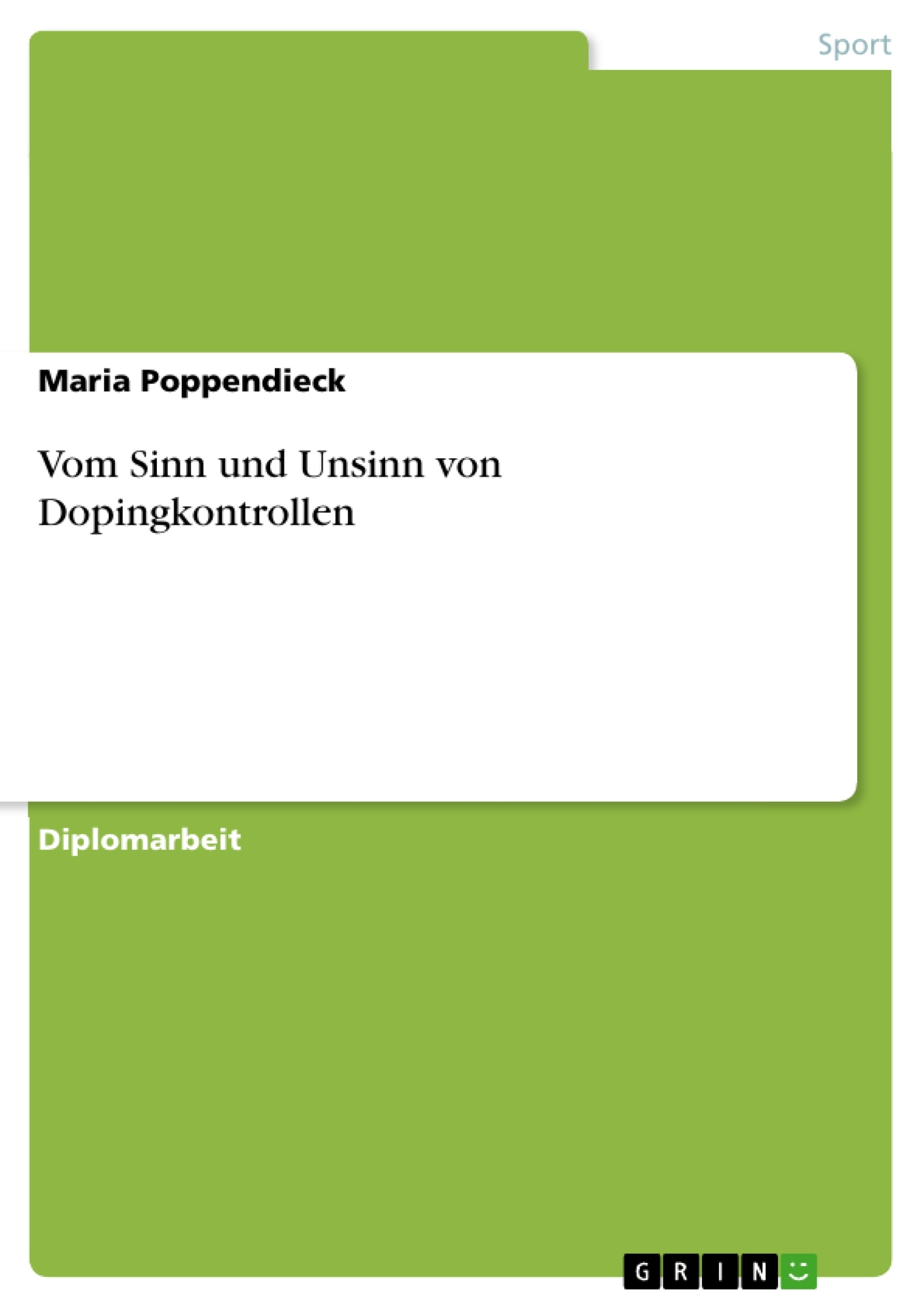Zu Beginn der Arbeit wird der Begriff «Doping» in seinen Ursprüngen und Bedeutungen betrachtet. Zudem werden, über die aktuell gültige Definition hinaus mehrere Definitionsansätze von Doping vorgestellt.
Im folgenden Kapitel findet sich ein Überblick über die grundlegenden Bestandteile des Dopingkontrollsystems.Mit dem Abschnitt 3.4 folgt ein eingeschobener Exkurs in die Geschichte von Doping und Dopingkontrollen. Kapitel 4 thematisiert das Phänomen Doping als einen Struktureffekt des Leistungssports. Es greift die in der Einleitung vorgestellte These der Soziologen Bette und Schimank auf und bildet damit die Grundlage für die Beantwortung der Frage nach dem Sinn von Dopingkontrollen. Entsprechend der These wird hier davon ausgegangen, dass Doping nicht aus einer individuellen Fehlentscheidung, nämlich der des Sportlers hervorgeht, sondern in der Eigenlogik des heutigen Spitzensports und seinen Beziehungen zur gesellschaftlichen Umwelt angelegt ist. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht folglich nicht nur der dopende Athlet, sondern auch das ihn umgebende System mit seinen strukturellen Bedingungen und seinen Verstrickungen mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel aufgezeigt, wie sich diese teilsystemischen Strukturen und Umweltbezüge in der Biografie eines einzelnen Athleten niederschlagen.
Abschnitt 5 beschäftigt sich mit dem eigentlichen Schwerpunkt dieser Arbeit: dem Sinn bzw. Unsinn von Dopingkontrollen. Während zunächst einmal geklärt wird, welchen Zielsetzungen die derzeitige Dopingbekämpfung folgt, werden nachstehend die Probleme des Kontrollsystems dargelegt. Dabei geht es aller-dings nicht darum, die Defizite des Kontrollsystems herauszuarbeiten, die etwa aufgrund einer eingeschränkten Analytik oder aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen entstehen. Vielmehr geht es diesem Kapitel darum, die zuvor gewonnenen Erkenntnisse auf die Kontrollproblematik zu übertragen. Es soll folglich herausgestellt werden, inwiefern sich der Umstand, dass Doping als Konstellationsprodukt zu werten ist, auf die Effektivität von Dopingkontrollen auswirkt. Dabei richtet sich das Hauptaugenmerk auf diejenigen Akteure, die für eine wirksame Dopingbekämpfung verantwortlich sind: die Sportverbände und Dopingkontrolleure.
Das abschließende Kapitel stellt eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit dar und beantwortet schließlich die Frage nach dem Sinn von Dopingkontrollen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- PROBLEMAUFRISS
- STRUKTURELLER ÜBERBLICK
- DOPING
- BEGRIFFSBESTIMMUNG
- DEFINITION
- DAS DOPINGKONTROLLSYSTEM
- WETTKAMPFKONTROLLEN
- TRAININGSKONTROLLEN
- VORWETTKAMPFKONTROLLEN
- SANKTIONEN
- DOPING UND DOPINGBEKÄMPFUNG: EIN HISTORISCHER EXKURS
- DOPING: EIN STRUKTUREFFEKT DES LEISTUNGSSPORTS
- SIEGESCODE, KONKURRENZKAMPF UND KÖRPERABHÄNGIGKEIT
- DOPINGDRUCK DURCH SPORTLICHE UMFELDAKTEURE
- DOPINGDRUCK DURCH ANDERE GESELLSCHAFTLICHE TEILBEREICHE
- Publikum
- Massenmedien
- Wirtschaft und Politik
- DIE BIOGRAPHISCHE FIXIERUNG DER SPORTLERKARRIERE
- DOPING AUS PERSÖNLICHEN GRÜNDEN
- DOPING ALS STRUKTUREFFEKT
- VOM SINN UND UNSINN VON DOPINGKONTROLLEN
- ZIELE DER DOPINGBEKÄMPFUNG
- PROBLEME DES DOPINGKONTROLLSYSTEMS
- Desinteresse an der Aufklärung von Dopingfällen
- Kontrollspiel zwischen Athleten und Kontrolleuren
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Dopings im Leistungssport und analysiert die Sinnhaftigkeit von Dopingkontrollen. Die Arbeit untersucht die Ursachen für den verbreiteten Dopingmissbrauch im Kontext von Strukturdynamiken des Leistungssports. Im Mittelpunkt stehen die Frage nach den Beweggründen für Doping und die Herausforderungen des Dopingkontrollsystems.
- Die Strukturdynamiken des Leistungssports und ihre Auswirkungen auf Dopingpraktiken
- Der Druck auf Sportler durch verschiedene Akteure wie Medien, Wirtschaft und Politik
- Die Rolle der Biographischen Fixierung in der Sportlerkarriere und ihr Zusammenhang mit Doping
- Die Ziele und Probleme des Dopingkontrollsystems
- Die Debatte um die Sinnhaftigkeit von Dopingkontrollen im Kontext des Leistungssports
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Problemhintergrund der Arbeit dar und beleuchtet den Slogan der Olympischen Spiele „One World – One Dream" im Kontext von Doping und Sport. Es wird die wachsende Professionalität, Kommerzialisierung und Medialisierung des Spitzensports sowie die Bedeutung der Dopingproblematik im modernen Sport hervorgehoben.
- Doping: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Doping und dem Dopingkontrollsystem. Es erläutert verschiedene Formen von Dopingkontrollen und die damit verbundenen Sanktionen.
- Doping: Ein Struktureffekt des Leistungssports: Das Kapitel beleuchtet die strukturellen Ursachen für Doping im Leistungssport. Es analysiert den Siegescode, die Rolle des Konkurrenzkampfes und die Abhängigkeit vom Körper als zentrale Elemente der Sportkultur.
- Vom Sinn und Unsinn von Dopingkontrollen: Dieses Kapitel diskutiert die Ziele der Dopingbekämpfung und die Herausforderungen des Dopingkontrollsystems. Es betrachtet die Probleme des Desinteresses an der Aufklärung von Dopingfällen sowie das Kontrollspiel zwischen Athleten und Kontrolleuren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Doping und Dopingkontrolle im Kontext des Leistungssports. Schlüsselbegriffe sind: Doping, Leistungssteigerung, Dopingkontrollsystem, Sportkultur, Strukturdynamiken, Siegescode, Konkurrenz, medialer Druck, Biographische Fixierung, Kontrollspiel, Athletenethik, Dopingskandale.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Doping als „Struktureffekt des Leistungssports“ bezeichnet?
Die These besagt, dass Doping nicht nur eine individuelle Fehlentscheidung ist, sondern durch das System (Siegescode, Konkurrenzdruck, Kommerzialisierung) provoziert wird.
Welche Arten von Dopingkontrollen gibt es?
Es wird zwischen Wettkampfkontrollen, Trainingskontrollen und Vorwettkampfkontrollen unterschieden, um eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten.
Welche Akteure üben Druck auf die Athleten aus?
Neben Trainern und Verbänden tragen auch das Publikum, Massenmedien sowie Wirtschaft und Politik durch ihre Erwartungshaltung an den Erfolg zum Dopingdruck bei.
Was sind die Hauptprobleme des aktuellen Dopingkontrollsystems?
Ein zentrales Problem ist das „Kontrollspiel“ zwischen Athleten und Kontrolleuren sowie ein teilweise mangelndes Interesse der Sportverbände an der vollständigen Aufklärung von Fällen.
Was bedeutet „biographische Fixierung“ bei Sportlern?
Spitzensportler setzen oft alles auf eine Karte. Da ihre Karriere kurz und körperabhängig ist, steigt die Bereitschaft zu riskanten Mitteln wie Doping, um den Erfolg abzusichern.
Sind Dopingkontrollen sinnvoll oder unsinnig?
Die Arbeit diskutiert, ob Kontrollen die Ursachen (die Strukturen) bekämpfen können oder lediglich die Symptome verwalten, ohne das grundlegende System zu ändern.
- Arbeit zitieren
- Maria Poppendieck (Autor:in), 2009, Vom Sinn und Unsinn von Dopingkontrollen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173750