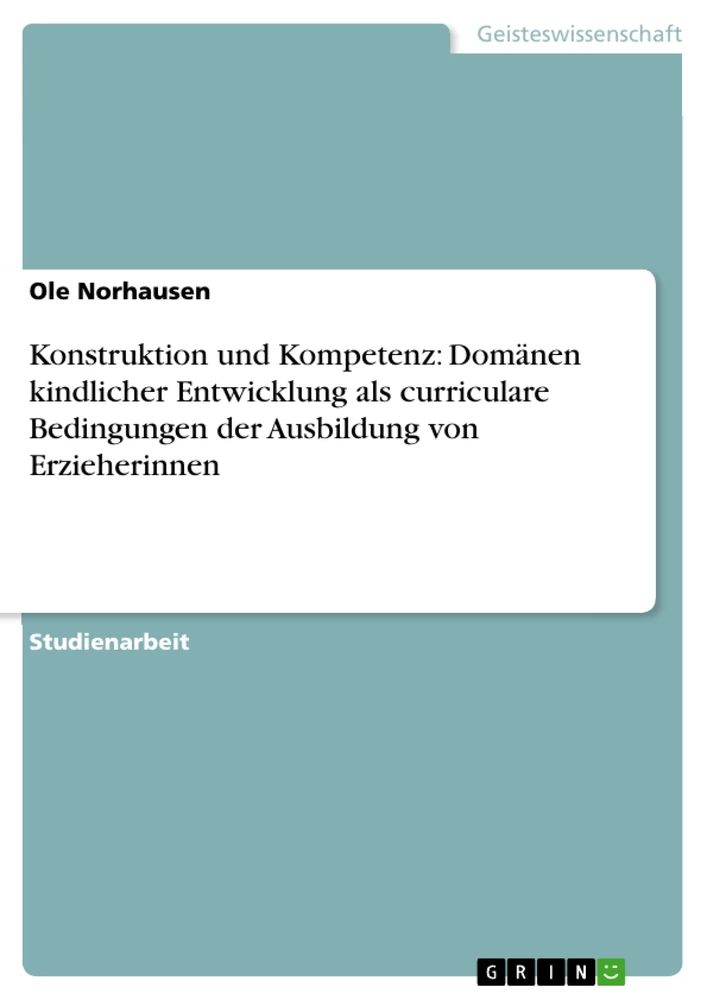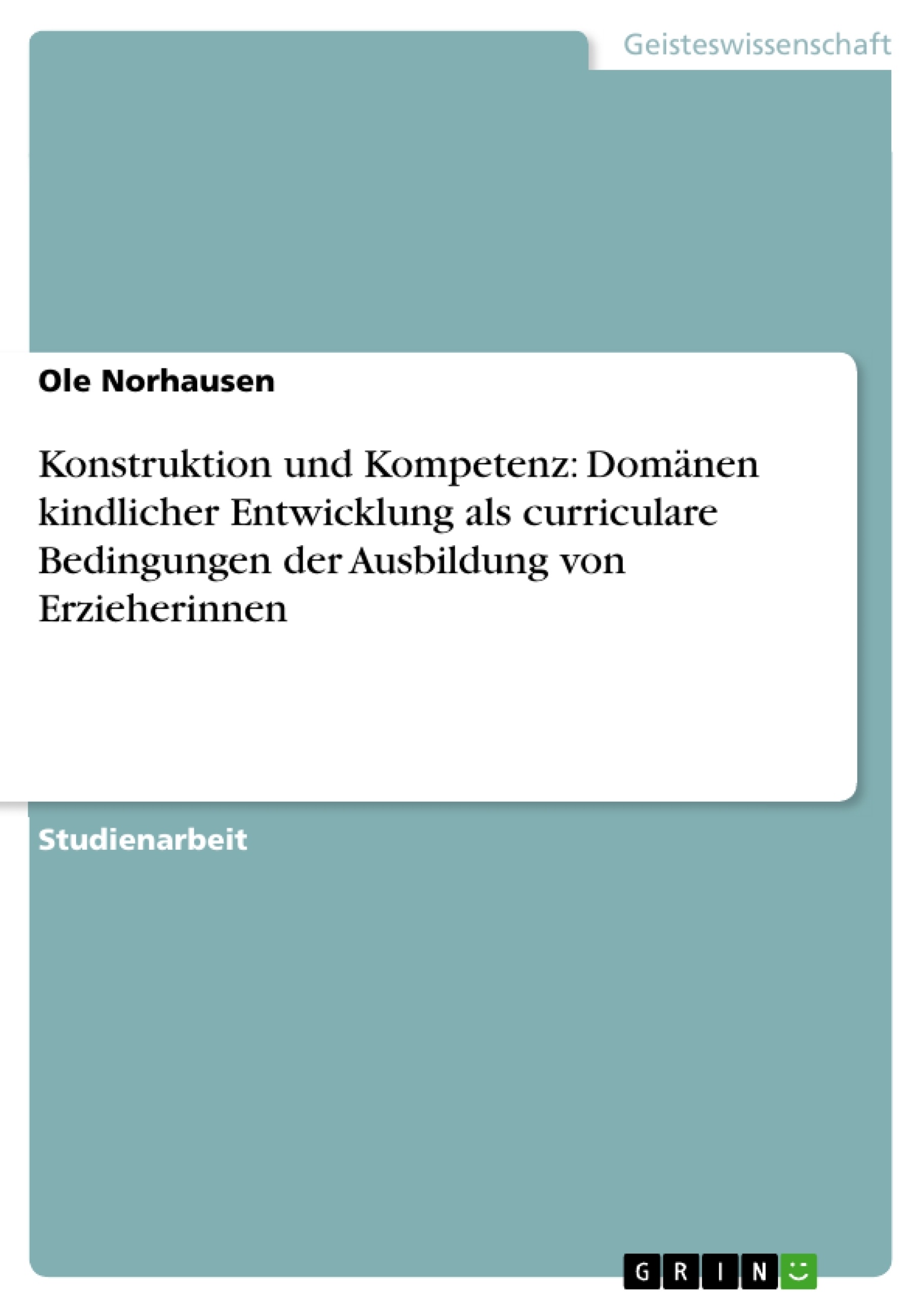Neuere hirnphysiologische und kognitionspsychologische Forschungen weisen nach, dass das Gehirn von Geburt an „domänenspezifisch“ „vorbereitet“ ist, auf das Erlernen z. B. des aufrechten Gangs, das Erkennen von Mustern, das Erfassen von Mengen, das Kommunizieren mittels Sprache. Mädchen und Jungen lernen in diesen Bereichen schneller als Erwachsene. In einer (sozial-) pädagogischen Betrachtung kindlicher Lernstrategien sind zwei Begriffe herausstechend, die sich als spezifisch für kindliche Entwicklung darstellen und sich im deutschen Gebrauch des lateinischen Wortes Dominium als „Herrschaftsgebiete“, also Domänen kindlicher Entwicklung, bezeichnen lassen und damit den frühkindlichen Bildungsprozess, als das „Werk des Kindes, das sich selbst schafft“, in besonderer Weise beschreiben und kennzeichnen.
Dies ist zum einen der Begriff der Konstruktion als konstruktivistisch geprägte begriffliche Verdichtung der selbsttätigen „Aneignung von Welt“ durch Mädchen und Jungen.
Des Weiteren geht es um den Begriff der Kompetenz als begriffliche Verdichtung des Paradigmas von sozialkompetenten Mädchen und Jungen, die diese von Geburt an besitzen.
Daraus erwachsen Forderungen und Konsequenzen für Erzieherinnen in der täglichen Arbeit mit den Adressatinnen. Diese werden bislang im Rahmen eines Professionalisierungsdiskurses vor allen Dingen die Ausbildung der Fachkräfte betreffend verhandelt.
Daraus erwachsen Forderungen und Konsequenzen für Erzieherinnen in der täglichen Arbeit mit den Adressatinnen. Diese werden bislang im Rahmen eines Professionalisierungsdiskurses vor allen Dingen die Ausbildung der Fachkräfte betreffend verhandelt. Diese Diskussion muss in den Kontext von curricularen Rahmenbedingungen transferiert werden. Lehrende befinden sich an den Ausbildungs- und Lernorten, den Fachschulen und Berufsfachschulen für Sozialpädagogik in diesen Rahmenbedingungen und haben diese formal und konzeptionell, sowie konkret im Unterricht auszugestalten. Wie ein Rückbezug aus den Lehrplänen der Fachschulen hin zu den für die erzieherische Praxis als prozessualer, struktureller und normativ-philosophischer Orientierungsrahmen gedachten Bildungsplänen für die Arbeit im Elementarbereich gestaltet werden soll, wird bislang nicht hinreichend diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. „Konstruktion“ als Begriff kindlicher Entwicklung
- 3. „Kompetenz\" als pädagogische Perspektive
- 4. Die Bildungspläne
- 4.1 Der Sächsische Bildungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippen und Kindergärten
- 4.2 Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (bayrBEP)
- 5. Die Lehrpläne
- 5.1 Die „Lehrpläne für die Fachschule Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik\" in Sachsen
- 5.2. Der „Lehrplan für die Fachakademie für Sozialpädagogik“ in Bayern
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Begriffen Konstruktion und Kompetenz im Kontext frühkindlicher Bildung. Sie untersucht, ob und wie sich diese als Paradigma einer veränderten Sicht auf kindliche Entwicklung in Bildungsplänen und Lehrplänen wiederfinden. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Paradigmen für die Ausgestaltung des Erzieherberufs zu beleuchten und die Notwendigkeit der Beschäftigung mit einer konstruktivistischen Sicht auf kindliche Entwicklung zu unterstreichen.
- Konstruktion als Konzept kindlicher Entwicklung im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes
- Kompetenz als pädagogische Perspektive auf Kinder als Subjekte ihrer eigenen Bildung
- Die curriculare Verankerung dieser Paradigmen in Bildungsplänen für den Elementarbereich
- Die Bedeutung dieser Konzepte für die Ausbildung von Erzieherinnen
- Der Einfluss auf die Formulierung eines frühkindlichen Bildungsbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die beiden zentralen Begriffe Konstruktion und Kompetenz als spezifische Aspekte kindlicher Entwicklung vor. Kapitel 2 erläutert das Konzept der Konstruktion anhand von Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und unterstreicht die Bedeutung von Selbsttätigkeit und „Aneignung von Welt“ durch Kinder. Kapitel 3 beleuchtet das Kompetenzparadigma und die Notwendigkeit, Kinder als hochkompetent wahrzunehmen. Die Kapitel 4 und 5 untersuchen die curriculare Verankerung dieser Paradigmen in Bildungsplänen und Lehrplänen für den Elementarbereich und die Ausbildung von Erzieherinnen. Der Fokus liegt dabei auf den Bildungsplänen Sachsens und Bayerns sowie den entsprechenden Lehrplänen für die Ausbildung von Erzieherinnen in diesen Bundesländern.
Schlüsselwörter (Keywords)
Konstruktion, Kompetenz, kindliche Entwicklung, Bildungsplan, Lehrplan, Elementarpädagogik, Erzieherinnenausbildung, konstruktivistisches Paradigma, frühkindliche Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Konstruktion" in der frühkindlichen Bildung?
Konstruktion bezieht sich auf den konstruktivistischen Ansatz, nach dem Kinder sich die Welt aktiv und selbstständig aneignen und ihr Wissen selbst "konstruieren".
Wie wird "Kompetenz" bei Kindern heute gesehen?
Das moderne Paradigma sieht Kinder von Geburt an als kompetente Wesen an, die über soziale und kognitive Fähigkeiten verfügen und Subjekte ihrer eigenen Bildung sind.
Welche Rolle spielen Bildungspläne (z.B. in Sachsen oder Bayern)?
Bildungspläne dienen als Orientierungsrahmen für pädagogische Fachkräfte und verankern Konzepte wie Selbsttätigkeit und Partizipation im Elementarbereich.
Wie wirkt sich das konstruktivistische Paradigma auf die Erzieherausbildung aus?
Die Ausbildung muss angehende Erzieher befähigen, die Lernstrategien der Kinder zu begleiten, anstatt nur Wissen vorzugeben, was eine neue pädagogische Haltung erfordert.
Was versteht man unter "Domänen kindlicher Entwicklung"?
Domänen sind spezifische Bereiche (wie Sprache, Mengenverständnis oder Motorik), für die das Gehirn von Geburt an biologisch vorbereitet ist.
Werden diese Konzepte ausreichend in den Lehrplänen der Fachschulen berücksichtigt?
Die Arbeit kritisiert, dass der Rückbezug zwischen den Bildungsplänen der Praxis und den Lehrplänen der Ausbildung bisher oft nicht hinreichend diskutiert wird.
- Quote paper
- Ole Norhausen (Author), 2011, Konstruktion und Kompetenz: Domänen kindlicher Entwicklung als curriculare Bedingungen der Ausbildung von Erzieherinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173728