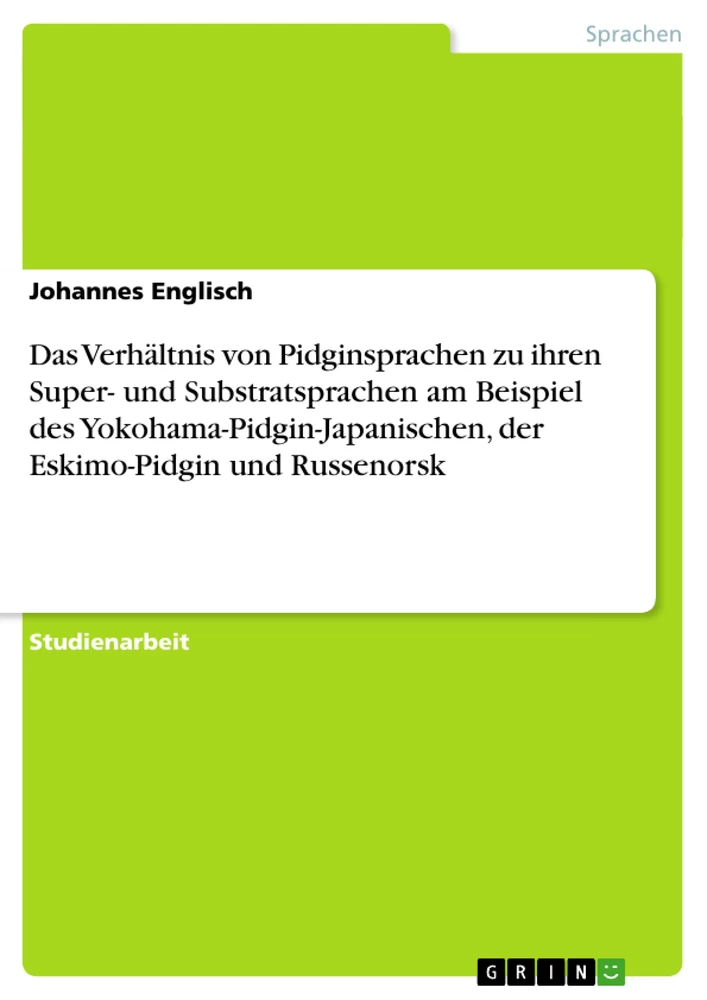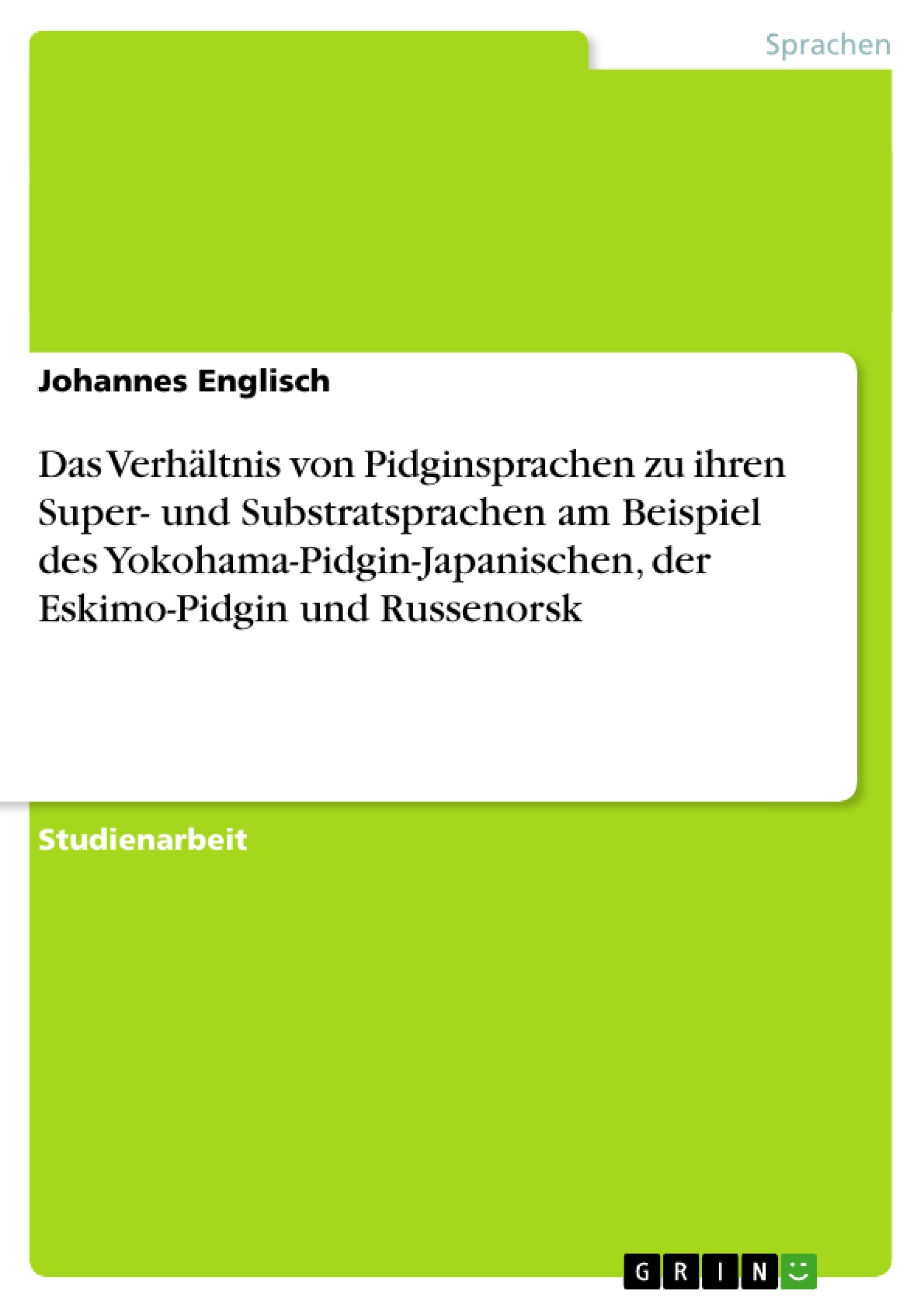Pidginsprachen sind Kontaktsprachen, die entstehen, wenn Menschen kommunizieren müssen, die keine gemeinsame Sprache sprechen. Diese Arbeit untersucht die strukturellen Tendenzen, die man in solchen Sprachen findet, anhand von drei herausgegriffenen Sprachen: dem Yokohama-Pidgin-Japanischen, der Eskimo-Pidgin und von Russenorsk.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Strukturelle Tendenzen in Pidginsprachen
3 Yokohama-Pidgin-Japanisch
3.1 Phonologie und Notation
3.2 Lexikon
3.3 Morphologie
3.4 Wortfolge
3.5 Das Verhältnis zum Japanischen
4 Eskimo-Pidgin in Westgrönland
4.1 Lautbestand im Vergleich zum Grönländischen
4.2 Lexikon
4.3 Morphologie
4.4 Syntax
4.5 Die Eskimo-Pidgin und Grönländisch
5 Russenorsk
5.1 Phoneminventar
5.2 Vokabular
5.3 Morphologie
5.4 Syntax
5.5 Der Einfluß von Russisch und Norwegisch
6 Schlußwort
1 Einleitung
Diese Arbeit dient dazu, strukturelle Aufälligkeiten, wie sie in Pidginsprachen feststellbar sind, an einigen drei Beispielsprachen zu untersuchen. Dabei werde ich mein Augenmerk auf den Einfluß der Sprachen, die an dem Sprachkontakt beteiligt sind, richten. Im Abschnitt 2 gebe ich einen Überblick über Pidginsprachen allgemein und das Verhältnis zu den Sprachen in Kontakt nach Holm (2000). Dann gehe ich zu den Pidginsprachen über, die ich untersuchen möchte. Meine Wahl fällt zum ersten auf zwei Sprachen, bei denen sich Super- und Substratsprachen strukturell sehr stark unterscheiden: Einmal das auf dem Japanischen basierende Yokohama-Pidgin-Japanisch im Abschnitt 3 und danach im Abschnitt 4 eine in Grönland auf Grundlage des Westgrönländischen entstandene Eskimo-Pidgin. Als dritte Sprache wähle ich Russenorsk (Abschnitt 5), das aufgrund der sozialen Gleichheit der Menschen in Kontakt eine Sonderrolle einnimmt und dessen Verhältnis zu den beteiligten Sprachen einige Besonderheiten ausweist. Ich werde jede Sprache in bezug auf Phonologie, Lexikon, Morpho- logie und Syntax betrachten. Dann, im Abschnitt 6 fasse ich die Erkenntnisse aus den Pidginsprachen zusammen und setze sie in Beziehung zueinander.
2 Strukturelle Tendenzen in Pidginsprachen
Im Folgenden stelle ich kurz Pidginsprachen vor und gehe auf strukturelle Besonderheiten ein, die man in Pidginsprachen oft findet. Ich beziehe mich dabei in diesem Abschnitt, sofern nichts anderes angegeben, auf Holm (2000).
Pidginsprachen sind im allgemeinen Sprachen, die entstehen, wenn Menschen mit einander Kontakt haben und kommunizieren müssen, ohne eine gemeinsame Sprache zu besitzen oder die Sprachen der Kontaktpartner zu kennen (z. B. im Handel oder durch Sklaverei). Diese Sprachen sind von den Muttersprachen der Sprecher beeinflußt. Dieser Einfluß hängt vom sozialen Status des Sprechers gegenüber dem anderen ab. So spricht man bei der Sprache der Sprecher mit der höheren Macht von der Superstratsprache und bei der Sprache der Sprecher mit niedrigerem sozialen Status von der Substratsprache. Pidginsprachen werden oftmals als »reduziert« betrachtet, weil ihre Struktur im Vergleich mit den Super- und Substratsprachen vereinfacht wirkt.
Pidginsprachen können sich zu sogenannten Kreolsprachen entwickeln. Kreolsprachen werden von einer ganzen Sprechergemeinschaft gesprochen und haben sich stabilisiert und neue Konstruktionen entwickelt. Im Grunde sind sie kaum bis gar nicht von »natürlichen« Sprachen zu unterscheiden. Der Begriff »Kreolsprache« bezieht sich also weniger die Struktur der Sprachen als vielmehr auf deren Entstehungsgeschichte.
Lexikon
Pidginsprachen besitzen oft nur ein eingeschränktes Vokabular, das auf den Anwendungsbereich der Sprache beschränkt ist. Die Quelle der Wörter ist in Pidginsprachen oft zum großen Teil die Super- stratsprache, wobei aber die Substratsprache die genaue Bedeutung und die Verwendung beeinflußt.
Um die Quantität der Wörter in Pidginsprachen auszugleichen, zeigen sie eine Tendenz zu vielen Polysemien und neigen dazu, Begriffe zu umschreiben. So bedeutet das Wort für »Leuchtturm« im Yokohama-Pidgin-Japanischen wörtlich übersetzt in etwa »Schiff-schaut-und-zerbricht-nicht-Kerze«:
(1) Yokohama-Pidgin-Japanisch (Inoue, 2006: 60):
fooney high.kin serampan nigh rosoko
ship look break NEG candle
‘lighthouse’
Phonologie
Bei vielen Pidginsprachen ist es schwer, die Phonologie und den Einfluß der Muttersprachen auf sie zu beschreiben, weil es nur wenig Aufzeichnungen a) über die Pidginsprachen selbst und b) über die Phonologie der Super- und Substratsprachen in den betreffenden Regionen zur betreffenden Zeit gibt. Dennoch kann man Tendenzen feststellen, daß häufigere Phoneme wie /d/ oder /m/ eher in Pidginsprachen übernommen werden als seltenere wie /T/ oder /D/. Es scheint aber einen starken Einfluß von den Substratsprachen auszugehen. So wurden in atlantischen Kreolsprachen phonologi- sche Merkmale afrikanischer Substratsprachen festgestellt (z. B. koartikulierte Plosive wie /kp/).
Morphologie
Grammatische Informationen werden in Pidginsprachen oft mehr mit freien als mit gebundenen Mor- phemen kodiert. Deswegen werden seltener morphologische Markierungen aus den beteiligten Spra- chen entlehnt. Die Flexionsaffixe, die übernommen werden, werden oftmals derivierend verwendet und ihre Bedeutung uminterpretiert. Zum Teil entstehen in Pidginsprachen auch neue Markierungen. Zum Beispiel hat sich das englische Wort side im Chinesischen Pidgin-Englisch zu einer Art Loka- tivmarker herausgebildet:
(2) Chinesisches Pidgin-Englisch (Hall, 1944: 97):
a. ófis-sajd
office-LOC
‘At the office’
b. ju háws-sajd
2 house-LOC
‘At your house’
Syntax
Über die Wortfolge von Pidginsprachen im allgemeinen zu sprechen, gestaltet sich schwierig, weil in den meisten dokumentierten Fällen sowohl Super- als auch Substratsprachen vom Grundtyp »Subjekt
(S) - Verb (V) - Objekt (O)« sind.1 Darüber hinaus läßt sich der Einfluß von Substratsprachen auf die
Syntax einer Pidginsprache schwer nachweisen, insbesondere wenn es Substratsprachensprecher mit sehr vielen verschiedenen Muttersprachen gibt. Deswegen kann man auch keine direkte Generalisierung über ihren Einfuß auf eine Pidginsprache treffen.
3 Yokohama-Pidgin-Japanisch
Das Yokohama-Pidgin-Japanische (YPJ) ist eine Pidginsprache, die von der Mitte bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts im Hafen von Yokohama gesprochen wurde. Westliche Händler (meistens Briten oder Amerikaner) trieben zu der Zeit Handel mit Japan. Da Japan sehr verschlossen im Um- gang mit Ausländern war, durften die Händler nur in einer abgegrenzten Siedlung, der sogenannten Gaikokujin-Kyoryuuchi »Fremdländersiedlung«, leben und handeln (Inoue, 2006: 56). Durch diese Machtposition der Japanischsprecher gegenüber den Sprechern anderer Sprachen kann man das Japa- nische als Superstratsprache von Yokohama-Pidgin-Japanisch einordnen. Substratsprache war wegen des relativ hohen Anteils an Briten in der Gaikokujin-Kyoryuuchi in den meisten Fällen Englisch.
Die Daten über die Sprache entstammen der Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialekt (Atkinson, 1879), einer Wortliste mit Beispielsätzen für Sprachenlerner. Es ist davon auszugehen, daß diese Daten das Yokohama-Pidgin-Japanische nicht erschöpfend wiedergeben und nur einen kleinen Einblick in die Sprache erlauben.
3.1 Phonologie und Notation
Die phonologische Struktur ist heutzutage schwer festzustellen, weil die Wörter in Form von engli- schen Wörtern oder Pseudowörtern geschrieben worden.2 Wahrscheinlich wurden sie auch mit engli- scher Phonologie ausgesprochen. Jedoch weist Inoue auf eine phonologische Eigenheit von Yokohama- Pidgin-Japanisch hin: Dort, wo sich im Standard-Japanischen ein /h/ befindet, wird im Yokohama- Pidgin-Japanischen, wie auch im Tokio-Dialekt des Japanischen, oft ein /s/ gesprochen (2006: 58):
(3) YPJ Jap.
sto/shto hito »Mensch«
stoats hitotsu »eins«
3.2 Lexikon
Das Yokohama-Pidgin verfügt über ein stark reduziertes Vokabular. Das setzt sich zum größten Teil aus japanischen Wörtern zusammen. Es gibt aber auch Wörter aus anderen Sprachen, z. B. boto »Boot« vom Englischen boat oder chobber.chobber »Essen« aus einem von Chinesen gesproche- nem Pidgin-Englisch (Inoue, 2006: 58f.). Die geringe Anzahl an Wörtern wird wie schon angedeutet durch Umschreibungen wie in (1) oder durch Polysemien ausgeglichen. Ein Beipiel für solch eine
Polysemie ist das yokohama-pidgin-japanische Wort aboorah. Es kommt vom japanischen Wort abura »Öl«, wird aber auch auf andere »ölartige« Substanzen angewandt: »Butter«, »Öl«, »Petroleum«, »Pomade« und »Fett« (Inoue, 2006: 59).
Das Yokohama-Pidgin-Japanische verfügt nur über drei Pronomen, die nicht für Numerus oder Genus spezifiziert sind (Atkinson, 1879: 15):
(4) Person YPJ
1 Watarkshee/Watakoosh’
2 Oh.my
3 acheera.sto
Es gibt eine Kopula arimas, die einen sehr allgemeinen und sehr reichen Verwendungsbereich hat:
»This far reaching verb, “arimas,” translates all the idioms of, to have, esse, possess, habere, manere, sein, haben, avoir, etre, ser, estar haber, tener, and “have got.” Beyond this it has a general colloquialism, a close analogy to the “altro” of the Italians.« (Atkinson, 1879: 16)
Dabei ist aber anzumerken, daß in Atkinsons Übersetzungen offenbar oftmals sehr viel Kontext einfließt. So übersetzt er z. B. einmal arimasen ‘COP.NEG’ mit »Unfortunately they were purchased on Tuesday by a party of tourists from San Francisco« (1879: 22).
3.3 Morphologie
Das Yokohama-Pidgin-Japanische ist morphologisch recht arm. Es gibt vereinzelt reduplizierte For- men wie chobber.chobber »Essen« oder sick.sick »Krankheit«, allerdings sind das feststehende Be- griffe. Reduplikation ist, anders als im Japanischen, kein produktives Mittel zur morphologischen Markierung. Ebenso verwendet das Yokohama-Pidgin-Japanische im Unteschied zum Japanischen keine Markierungen für Tempus, Aspekt, Modus oder grammatische Relationen (Inoue, 2006: 60f.):
(5) Jap.: Kuruma-ni abura-o ire-ro.
car-DAT oil-ACC put-IMP
‘Put some oil into the car.’
YPJ: Kooromar aboorah sinjoe.
car oil give
‘Oil the carriage wheels.’
Tempus wird wie schon angedeutet nicht am Verb direkt markiert sondern über den Kontext oder mittels Temporaladverbien wie meonitchi »morgen« bzw. bynebai »später« (Inoue, 2006: 61f.). Ver- ben können negiert werden, indem man ein nigh hinter dem Verb anfügt.3 Atkinson führt an, daß man Verben auf -mas mit -en oder -ing negieren kann (1879: 18), nur findet man das laut Inoue nur auf zwei Wörter angewendet: walk.arimasen »nicht verstehen« und die negierte Kopula arimasen (2006: 62).
[...]
1 In dieser Arbeit verwende ich das Wort Subjekt für den aktiven Teilnehmer einer Handlung und Objekt für den Undergo- er. Da die Kasusalinierung nicht im Fokus dieser Arbeit steht, werde ich diese Terminologie zur besseren Vergleich- barkeit der Sprachen im Abschnitt 4 auch auf das Grönländische so anwenden, obwohl es eine Ergativ-Absolutiv Alinierung aufweist.
2 Vereinzelt verbindet Atkinson (1879) zusammengehörige Wörter mit Bindestrichen. Inoue (2006) wendet diese No- tation auf alle Beipiele an (z. B.: high kin→high-kin ‘look’). Da ich in Glossen Bindestriche bereits zur Markierung von Morphemgrenzen verwende, werde ich stattdessen auf Punkte zurückgreifen, um Ambiguitäten in den Glossen zu vermeiden, also: high.kin.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht strukturelle Auffälligkeiten in Pidginsprachen anhand von drei Beispielsprachen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Sprachen, die an dem Sprachkontakt beteiligt sind.
Welche Pidginsprachen werden in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht das Yokohama-Pidgin-Japanisch, eine Eskimo-Pidgin in Westgrönland und Russenorsk.
Was sind Pidginsprachen?
Pidginsprachen entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Sprachen kommunizieren müssen, ohne eine gemeinsame Sprache zu haben. Sie werden oft von den Muttersprachen der Sprecher beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen Pidgin- und Kreolsprachen?
Pidginsprachen sind vereinfachte Sprachen, die für die Kommunikation zwischen Sprechern verschiedener Sprachen verwendet werden. Kreolsprachen entstehen, wenn eine Pidginsprache von einer Sprechergemeinschaft übernommen, stabilisiert und weiterentwickelt wird.
Was sind Superstratsprache und Substratsprache?
Die Superstratsprache ist die Sprache der Sprecher mit höherem sozialen Status, während die Substratsprache die Sprache der Sprecher mit niedrigerem sozialen Status ist. Die Superstratsprache beeinflusst oft das Lexikon, während die Substratsprache die Bedeutung und Verwendung beeinflussen kann.
Was sind die strukturellen Tendenzen in Pidginsprachen bezüglich des Lexikons?
Pidginsprachen haben oft ein eingeschränktes Vokabular und tendieren zu Polysemien und Umschreibungen, um die Quantität der Wörter auszugleichen.
Was sind die phonologischen Tendenzen in Pidginsprachen?
Häufigere Phoneme werden eher in Pidginsprachen übernommen als seltenere. Es gibt oft einen starken Einfluss von den Substratsprachen.
Wie sieht es mit der Morphologie in Pidginsprachen aus?
Grammatikalische Informationen werden oft mit freien Morphemen kodiert. Flexionsaffixe werden seltener entlehnt und oft derivierend verwendet.
Wie sieht es mit der Syntax in Pidginsprachen aus?
Der Einfluss von Substratsprachen auf die Syntax ist schwer nachzuweisen, insbesondere wenn es viele Substratsprachensprecher mit verschiedenen Muttersprachen gibt.
Was ist Yokohama-Pidgin-Japanisch?
Yokohama-Pidgin-Japanisch (YPJ) ist eine Pidginsprache, die im 19. Jahrhundert im Hafen von Yokohama gesprochen wurde. Das Japanische war die Superstratsprache, Englisch die Substratsprache.
Woher stammen die Daten über Yokohama-Pidgin-Japanisch?
Die Daten stammen aus der Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialekt (Atkinson, 1879), einer Wortliste mit Beispielsätzen.
Wie ist die Phonologie des Yokohama-Pidgin-Japanisch?
Die phonologische Struktur ist schwer festzustellen, aber im YPJ wird oft ein /s/ anstelle von /h/ im Standard-Japanischen gesprochen.
Wie sieht das Lexikon im Yokohama-Pidgin-Japanisch aus?
Das Vokabular ist stark reduziert und besteht hauptsächlich aus japanischen Wörtern, aber es gibt auch Wörter aus anderen Sprachen. Es gibt nur drei Pronomen, die nicht für Numerus oder Genus spezifiziert sind.
Wie sieht die Morphologie im Yokohama-Pidgin-Japanisch aus?
Das Yokohama-Pidgin-Japanisch ist morphologisch arm. Es gibt keine Markierungen für Tempus, Aspekt, Modus oder grammatische Relationen.
- Quote paper
- Johannes Englisch (Author), 2010, Das Verhältnis von Pidginsprachen zu ihren Super- und Substratsprachen am Beispiel des Yokohama-Pidgin-Japanischen, der Eskimo-Pidgin und Russenorsk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173721