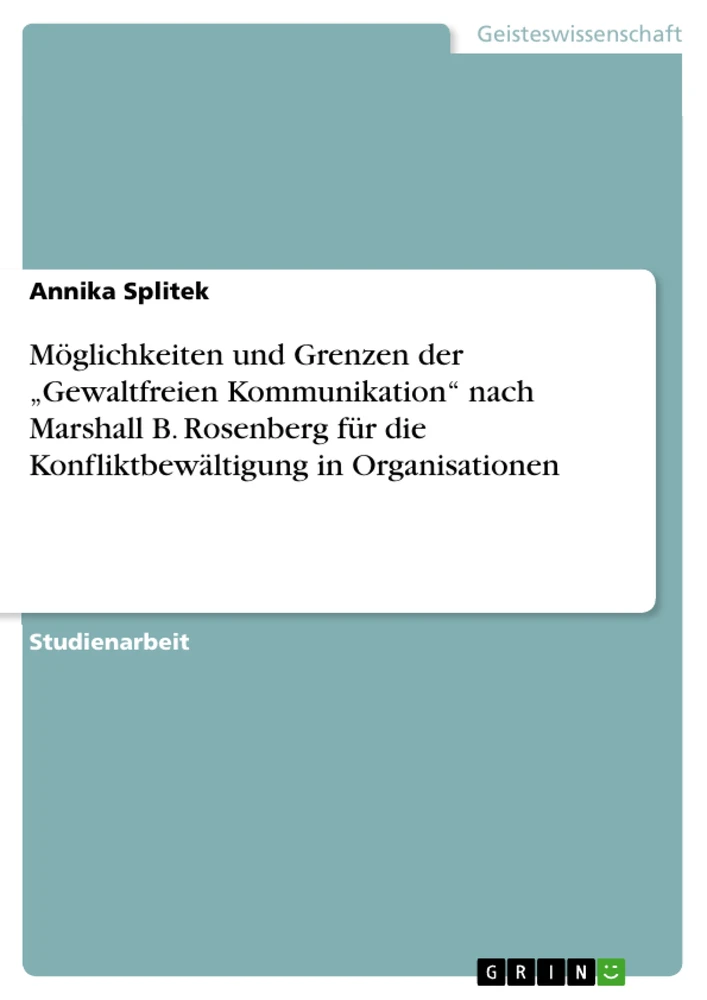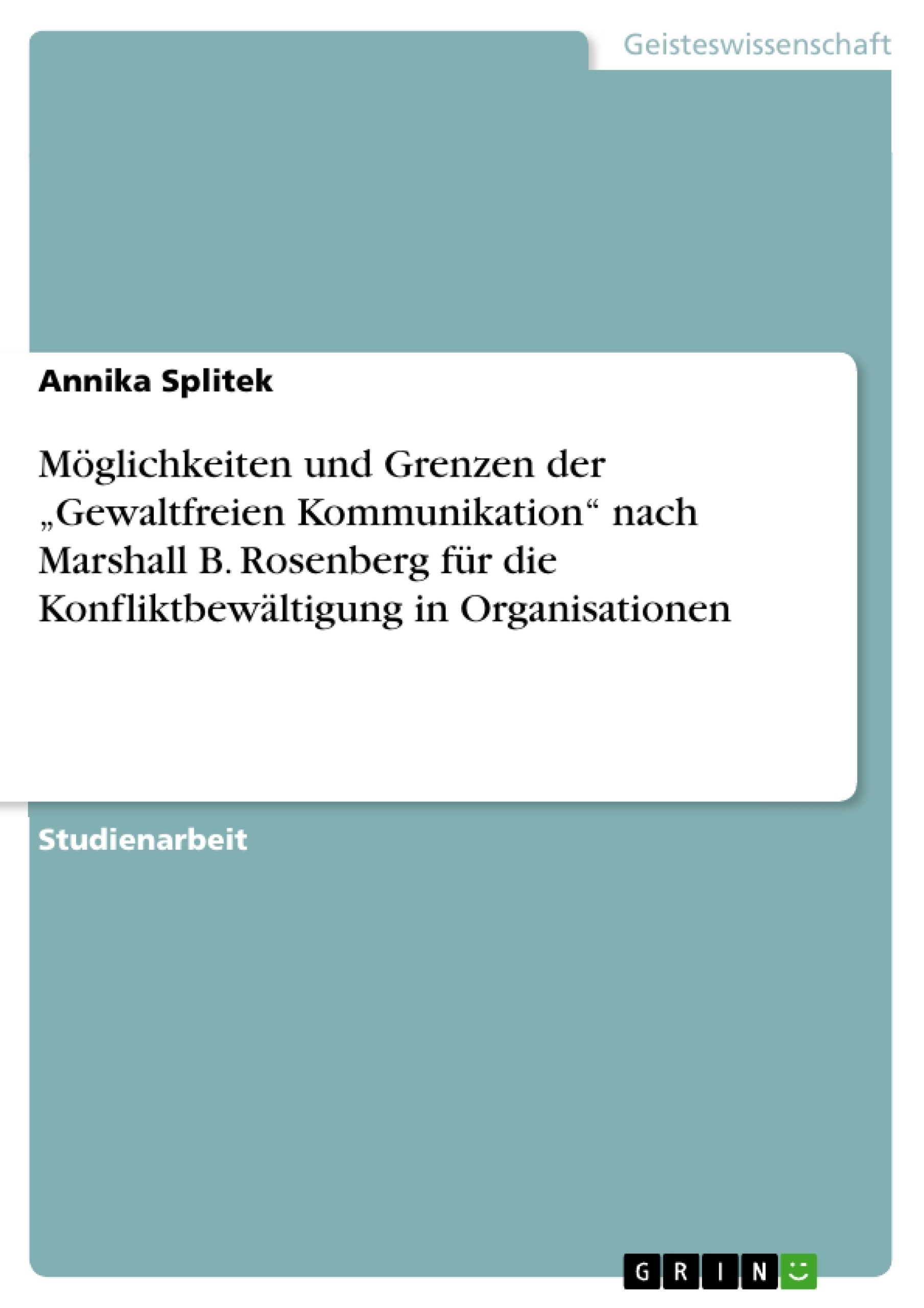Konflikte zwischen einzelnen Personen oder zwischen Gruppen sind in der Organisationspsychologie ein sehr praxisrelevantes Thema. Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Frage, ob und wieweit das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg zur Bewältigung von Konflikten in Organisationen geeignet ist.
Die Autorin dieser Studienarbeit ist der Auffassung, dass die Qualität der Kommunikation von zentraler Bedeutung für die konstruktive Bewältigung von Konflikten ist. Unabhängig von der sozialen Dimension in der ein Konflikt stattfindet, ist das direkte Gespräch letztlich der Kern einer jeden Konfliktbearbeitung. Das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“, im Folgenden kurz als GfK bezeichnet, verspricht einen Rahmen für die Entwicklung von Fähigkeiten zu liefern, die innerhalb eines solchen direkten Gesprächs eine konstruktive Konfliktbewältigung ermöglichen.
Die GfK beinhaltet eine bedürfnisorientierte Sprache, in der der Ausdruck der eigenen Gefühle und Bedürfnisse und das Wahrnehmen der Gefühle und Bedürfnisse anderer eine wesentliche Komponente darstellen.
Doch ist eine Methodik, die ihre Aufmerksamkeit auf die Gefühle und Bedürfnisse richtet, innerhalb einer eher sachlich orientierten Kommunikation in Organisationen realisierbar? Wenn sie umsetzbar ist, welche Möglichkeiten bietet sie zur Erreichung einer konstruktiven Konfliktbewältigung an?
In Kapitel zwei werden zunächst der Relevanz für die Themenbearbeitung entsprechend einige theoretische Grundlagen sowie Forschungsergebnisse aus der Konfliktforschung dargestellt. Der Studienarbeit liegt dabei die organisationspsychologische Sichtweise Berkels zugrunde. Bei den Forschungsergebnissen wurde weitestgehend auf die Studie Regnets zurückgegriffen, deren Grundlage ebenfalls der Ansatz Berkels darstellt. In Kapitel drei wird die Methodik der GfK beschrieben und Kapitel vier stellt einen Versuch dar, die GfK in die bisherigen Erkenntnisse der Konfliktforschung einzubetten und ihren möglichen Nutzen und ihre Grenzen für die Konfliktbewältigung herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konflikte in Organisationen
- Die organisationspsychologische Betrachtungsweise Berkels
- Das Konfliktpotential
- Ursachenattribuierung und Handlungsstrategien
- Konfliktverlauf
- Das Konzept der GfK nach M. B. Rosenberg
- Theoretische Einordnung
- Die Formen lebensentfremdender Kommunikation
- Die vier Komponenten der Gewaltfreien Kommunikation
- Der Begriff der Empathie in der GfK
- Der Nutzen der GfK für die Konfliktbewältigung in Organisationen
- Gefühle und Bedürfnisse im betrieblichen Kontext
- Der Weg der GfK in die Organisation
- Die GfK als Basis einer Bedürfnis wahrnehmenden Unternehmenskultur
- Die Vereinbarkeit der GfK mit dem Ansatz Berkels
- Die Bedürfnisse hinter den Ursachenattribuierungen
- Möglichkeiten der GfK zur Verkleinerung des „blinden Flecks“
- Die GfK innerhalb der Phasen kooperativer Konfliktbewältigung
- Grenzen und Möglichkeiten der GfK – ein Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit analysiert die Eignung des Konzepts der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg für die Bewältigung von Konflikten in Organisationen. Dabei wird untersucht, ob und inwiefern die GfK einen Rahmen für die Entwicklung von Fähigkeiten bietet, die eine konstruktive Konfliktbearbeitung im direkten Gespräch ermöglichen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Anwendung der GfK im Kontext der Organisationspsychologie, insbesondere unter Berücksichtigung der Theorie Berkels.
- Relevanz der Kommunikation für die Konfliktbewältigung in Organisationen
- Theoretische Grundlagen der GfK und ihre Einordnung in die Konfliktforschung
- Mögliche Vorteile der GfK für die Konfliktbewältigung in Organisationen
- Potenzielle Grenzen und Herausforderungen der GfK in der Organisationspraxis
- Die Vereinbarkeit der GfK mit dem Ansatz Berkels
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Konflikte in Organisationen
Dieses Kapitel behandelt die organisationspsychologische Sichtweise Berkels auf Konflikte und legt den Fokus auf die subjektive Wahrnehmung und das Erleben von Konflikten als Ausgangspunkt für erfolgreiche Konfliktbewältigung. Es werden das Konfliktpotential, die Ursachenattribuierung und der Konfliktverlauf unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse Regnets beleuchtet.
Kapitel 3: Das Konzept der GfK nach M. B. Rosenberg
Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der GfK. Es erläutert die theoretischen Grundlagen des Konzepts, die Formen lebensentfremdender Kommunikation, die vier Komponenten der Gewaltfreien Kommunikation und den Begriff der Empathie in der GfK.
Kapitel 4: Der Nutzen der GfK für die Konfliktbewältigung in Organisationen
In diesem Kapitel wird versucht, die GfK in die bisherigen Erkenntnisse der Konfliktforschung einzubetten. Es werden die möglichen Vorteile der GfK für die Konfliktbewältigung in Organisationen beleuchtet, z.B. die Förderung von Gefühls- und Bedürfnissensitivität, die Entwicklung einer Bedürfnis wahrnehmenden Unternehmenskultur und die Möglichkeit, den „blinden Fleck“ zu verkleinern.
Kapitel 5: Grenzen und Möglichkeiten der GfK – ein Resümee
Das letzte Kapitel fasst die Erkenntnisse der Studienarbeit zusammen und diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten der GfK für die Konfliktbewältigung in Organisationen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „Gewaltfreie Kommunikation“ (GfK) nach M. B. Rosenberg, ihre Anwendung in Organisationen, insbesondere im Kontext der Konfliktbewältigung. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Konfliktpotenzial, Konfliktursachen, subjektive Wahrnehmung, Bedürfnisse, Gefühle, Empathie, Organisationspsychologie, Unternehmenskultur, „blinder Fleck“, Perspektivenwechsel, Handlungsstrategien, kooperative Konfliktbewältigung.
- Citar trabajo
- Annika Splitek (Autor), 2011, Möglichkeiten und Grenzen der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg für die Konfliktbewältigung in Organisationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173677