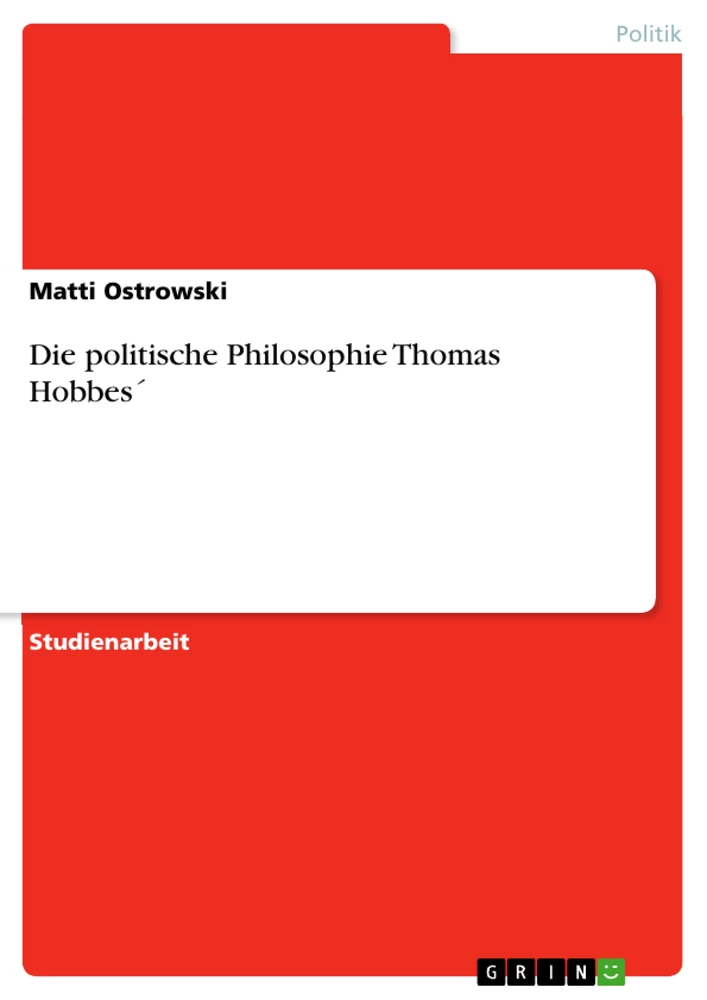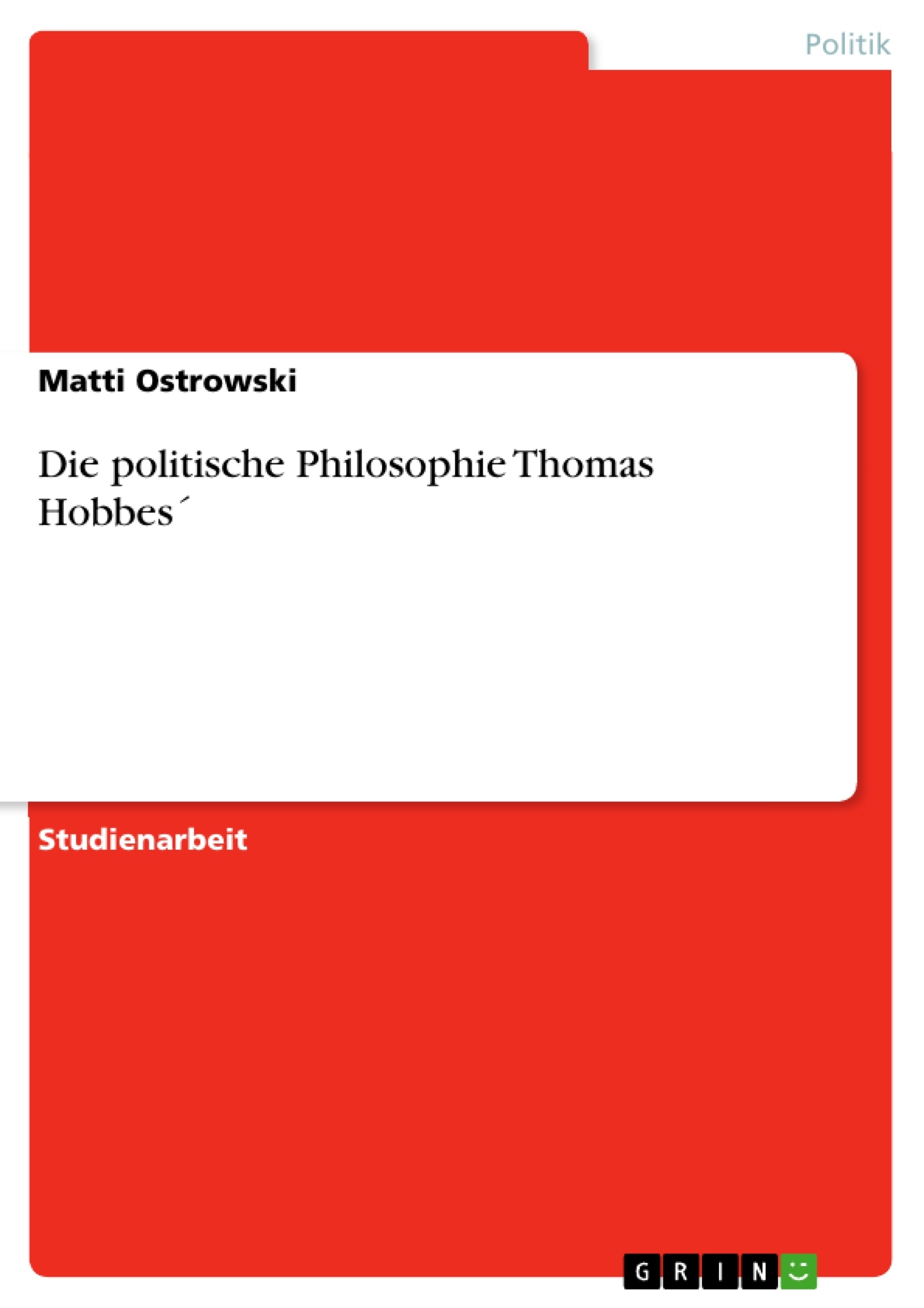„Homo homini lupus“ – Der Mensch ist des Menschen ein Wolf. Mit diesem Zitat reduzierte Thomas Hobbes Mitte des 17. Jahrhunderts den Menschen auf ein Wesen, das sich ohne eingreifende Gewalt (selbst-)zerstörerisch gegenüber seinen Mitmenschen verhält. Er schloss damit an das bereits knapp 100 Jahre vor ihm entwickelte negative Menschenbild Niccolo Macchiavellis an, der diesem von Grund auf misstraute, da dieser selbst gegenüber seinem eigenen Wohltäter undankbar sei. Auf dieser Anthropologie aufbauend entwickelte Thomes Hobbes seinerzeit in seinen politischen Schriften die politisch-philosophische Lehre vom Naturzustand, in dem eben jenes Zitat in vollster Ausprägung zutreffen würde. Dieser Zustand, so Hobbes, könne nur über den rationalistisch begründeten Abschluss eines Gesellschaftsvertrages aller Individuen untereinander und der Übertragung der Macht an eine übergeordnete Instanz – den Staat – überwunden werden.
Doch wie genau sollte ein idealer Staat aufgebaut sein? Hobbes selbst hatte einen vom Gesellschaftsvertrag ausgenommenen absoluten Monarchen vorgeschlagen, was nicht nur die Frage aufkommen ließ, wie dieser sich dann noch legitimieren ließe, sondern auch, warum Thomas Hobbes zu den ersten Aufklärern zählen darf.
Im Zentrum der folgenden Arbeit soll daher im ersten Teil zunächst die politische Theorie Thomas Hobbes´ stehen. Es soll mit Hilfe seiner philosophischen Überzeugungen dargestellt werden, wie der Naturzustand zu verstehen ist und welche praktischen Konsequenzen sich für ihn aus diesem Konstrukt ergeben, beispielsweise die strikte Ablehnung demokratischer Staatsformen und die Einrichtung einer – später „absolutistisch“ genannten – Monarchie. Im zweiten Teil der Arbeit wird dann vor allem die Rezeption und Wirkung Thomas Hobbes besprochen. Dabei soll geklärt werden, ob und inwieweit Hobbes trotz seiner heute anachronistisch wirkenden politischer Überzeugung zu den frühen Aufklärern zählt. Denn während bereits Zeitgenossen aller Couleur seine Lehre größtenteils ablehnten, zeigte sich spätestens im 18. Jahrhundert das zweite Gesicht des Denkers und dessen bleibender Einfluss. Ob gewollt oder ungewollt hat er späteren Philosophen und Staatstheoretikern nämlich Instrumente in die Hand gegeben, mit deren Hilfe die politischen Ideen der Aufklärung legitimiert werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thomas Hobbes
- Kurzbiografie Thomas Hobbes'
- Thomas Hobbes im historischen Kontext
- Hobbes' politische Theorie
- Hobbes „Leviathan“
- Der Naturzustand
- Der Gesellschaftsvertrag und die Skizzierung des idealen Staates
- Vorzüge der Monarchie und Kritik der Demokratie
- Rezeption und Kritik
- Rezeption
- Kritik
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Theorie Thomas Hobbes und seine Positionierung in der frühen Aufklärung. Sie analysiert Hobbes' Konzept des Naturzustands und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Staatsform. Darüber hinaus werden die Rezeption und die Wirkung von Hobbes' Ideen im historischen Kontext beleuchtet.
- Das Menschenbild Thomas Hobbes
- Der Naturzustand und seine Überwindung durch den Gesellschaftsvertrag
- Die Rolle des Staates und die Rechtfertigung der Monarchie
- Die Rezeption von Hobbes' Ideen in der Geschichte
- Die Frage, ob Hobbes trotz seiner monarchistischen Überzeugungen zu den frühen Aufklärern zählt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in das Thema der politischen Theorie Thomas Hobbes ein. Sie erläutert Hobbes' negative Menschenbild und sein Konzept vom Naturzustand, das die Notwendigkeit eines Gesellschaftsvertrags und eines starken Staates unterstreicht.
- Thomas Hobbes: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Biographie von Thomas Hobbes und seinen wichtigsten Einflüssen. Es beleuchtet seine frühen Jahre, seine Studien in Oxford und seine Begegnungen mit bedeutenden Denkern seiner Zeit.
- Hobbes' politische Theorie: Dieses Kapitel widmet sich der politischen Theorie von Hobbes und präsentiert seine wichtigsten Argumente. Es analysiert seine Ausführungen zum Naturzustand, zum Gesellschaftsvertrag und zur Legitimität eines souveränen Staates.
- Rezeption und Kritik: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption und die Kritik an Hobbes' politischer Theorie. Es beleuchtet die Reaktionen seiner Zeitgenossen und die Entwicklung seiner Ideen in späteren philosophischen und politischen Debatten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenbereiche der Arbeit sind: Thomas Hobbes, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Leviathan, Monarchie, Demokratie, Frühe Aufklärung, Rezeption, Kritik. Diese Begriffe prägen die Untersuchung der politischen Theorie von Thomas Hobbes und bieten einen Einblick in seine zentralen Argumente und Überzeugungen.
- Quote paper
- Matti Ostrowski (Author), 2011, Die politische Philosophie Thomas Hobbes´, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173512