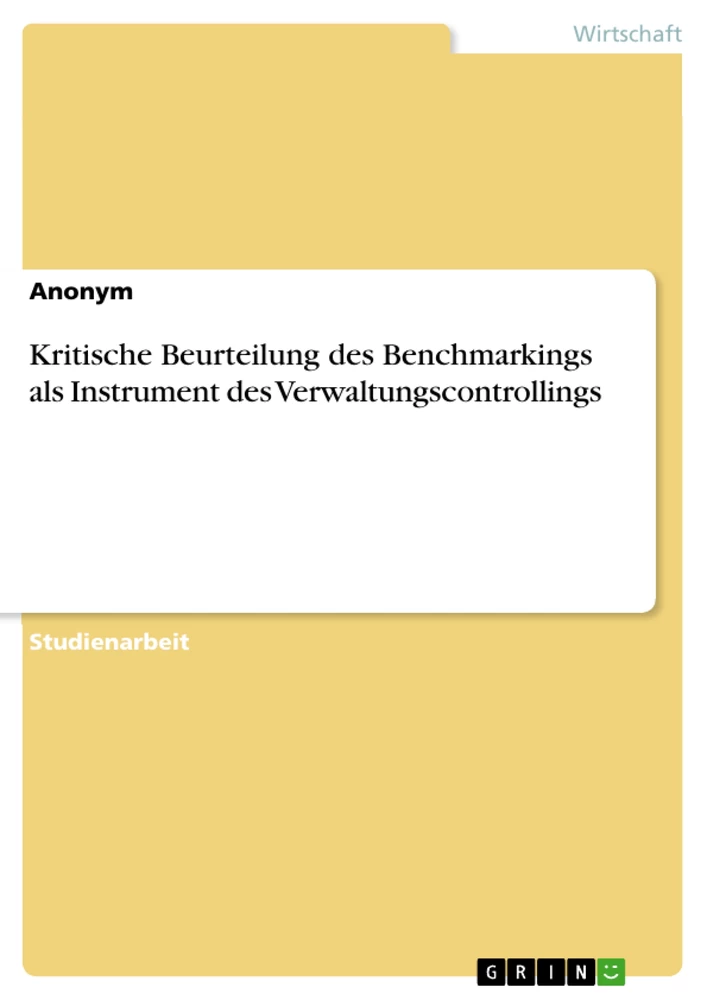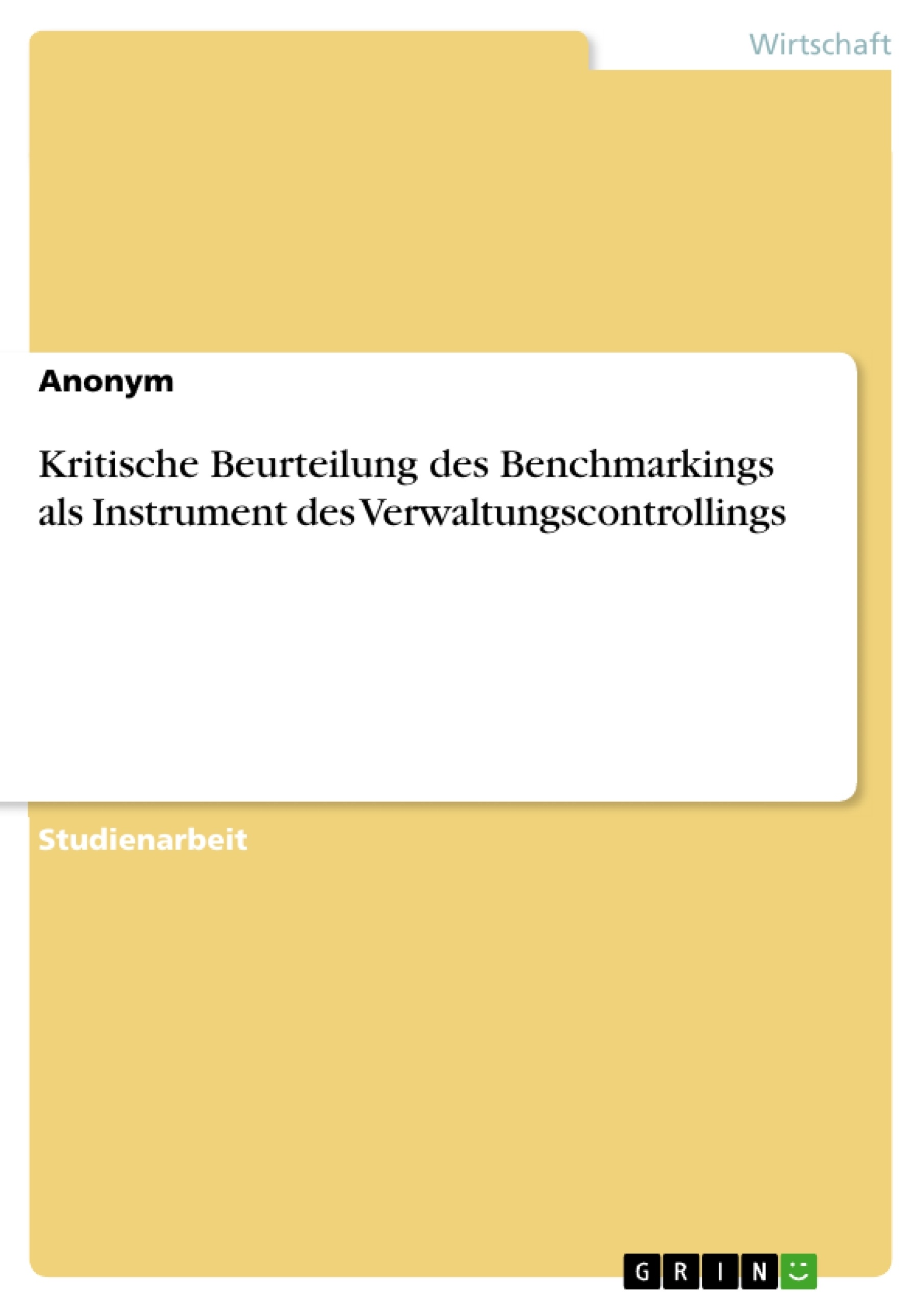Absicht der vorliegenden Studienarbeit ist es die Anwendbarkeit des Instruments Benchmarking im Verwaltungscontrolling sowie seine Möglichkeiten und Grenzen für die öffentliche Verwaltung darzustellen. Die kritische finanzielle Lage, in der sich die Verwaltung schon seit Jahren befindet, macht es zunehmend erforderlich über neue Konzepte der Verwaltungsmodernisierung nachzudenken. Wie aufgezeigt wurde fehlt in der öffentlichen Verwaltung die regulierende Wirkung des freien Marktes, die ein ständiges Streben nach Innovationen und Verbesserungen bewirkt. Durch die Anwendung des Benchmarkings im strategischen Verwaltungscontrolling können die Aspekte des marktlichen Wettbewerbs (wenn auch nur begrenzt) durch einen nicht-marktlichen Wettstreit ersetzt werden. Dabei sind aber vielfältige Faktoren zu beachten, die den Erfolg des Leistungsvergleichs behindern oder verstärken können. In Deutschland wird das Benchmarking leider oftmals schon nach dem Kennzahlenvergleich abgeschlossen. Das eigentliche Verbesserungspotenzial, von anderen vorteilhaftere Praktiken kennen zu lernen, wird daher nicht immer umfassend in der Praxis genutzt. Außerdem wird das Benchmarking bisher hauptsächlich auf der interkommunalen Ebene, unterstützt durch die KGSt, angewendet. Die Mitwirkung an einem Leistungsvergleich ist jedoch noch sehr zurückhaltend, was nicht selten auf den damit verbundenen immensen Aufwand und die hohen Kosten zurückgeführt werden kann.
Abschließend lässt sich festhalten, dass das Benchmarking in der öffentlichen Verwaltung bisher bereits einzelne Erfolge vorweisen kann. Mit einer kontinuierlichen und systematischen Anwendung gerade in Verbindung mit weiteren Bausteinen des NPM, die einerseits eine Empfehlung darauf geben können, wie nach dem Kennzahlenvergleich weiter verfahren werden soll und andererseits von der Wettbewerbsfunktion des Benchmarkings profitieren, kann das Benchmarking durchaus ein nutzbringendes Instrument des Verwaltungscontrollings darstellen, mit dem die Verwaltungsmodernisierung verwirklicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Benchmarkings
- Definition des Terminus Benchmarking
- Umgrenzung des Terminus
- New Public Management und Benchmarking
- Ablauf des Benchmarkings
- Benchmarking als Instrument zur Effektivitäts- und Effizienzintensivierung
- Benchmarking als Wettbewerbsersatz
- Objekte des Benchmarkings
- Arten des Benchmarkings
- Internes Benchmarking
- Externes (horizontales) Benchmarking
- Zielsysteme und Kennzahlen
- Verdienste und Erfolge des Benchmarkings
- Ein Blick ins Ausland
- Entfaltungen in der Bundesrepublik Deutschland
- Erfolgskritische Elemente und allgemeine Schwierigkeiten
- Resümee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch das Benchmarking als Instrument des Verwaltungscontrollings. Ziel ist es, die Grundlagen des Benchmarkings zu erläutern, seine Bedeutung für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu beleuchten und seine Anwendung in der Praxis zu analysieren. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten im Detail betrachtet.
- Grundlagen und Definition des Benchmarkings
- Benchmarking im Kontext des New Public Management (NPM)
- Arten und Anwendung des Benchmarkings in der öffentlichen Verwaltung
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des Benchmarkings
- Der internationale Vergleich von Benchmarking-Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: zunehmende Haushaltsprobleme und der Wunsch nach effizienterer Leistungserstellung in der öffentlichen Verwaltung. Sie führt das New Public Management (NPM) als Hintergrund ein und positioniert Benchmarking als Instrument zur Verbesserung der Effizienz und zur Nachahmung des Wettbewerbs der freien Wirtschaft. Der Fokus liegt auf der öffentlichen, insbesondere der kommunalen Verwaltung, wo die Bemühungen um systematische Leistungsvergleiche am größten sind. Die Arbeit strukturiert den weiteren Verlauf der Analyse.
Grundlagen des Benchmarkings: Dieses Kapitel legt die Definition von Benchmarking dar, wobei der Begriff aus seinen englischen Wortbestandteilen hergeleitet wird. Es betont die Bedeutung von Benchmarking als Referenzpunkt und Orientierungsgröße für die Leistungserstellung. Verschiedene Definitionen aus der Literatur werden vorgestellt, mit besonderem Fokus auf die Definition von Robert C. Camp. Das Kapitel grenzt Benchmarking von einfachen Kennzahlenvergleichen ab und hebt die Notwendigkeit einer systematischen Herangehensweise und der Identifizierung von Best Practices hervor. Der Unterschied zwischen Benchmarking und oberflächlichem Vergleich von Organisationen wird betont.
Benchmarking als Instrument zur Effektivitäts- und Effizienzintensivierung: Dieser Abschnitt behandelt die Rolle des Benchmarkings als Ersatz für den in der öffentlichen Verwaltung fehlenden Wettbewerbsdruck. Es werden verschiedene Arten von Benchmarking (intern und extern) sowie die Auswahl geeigneter Objekte für den Vergleich und die potenziellen Fallstricke bei der Kennzahlenerhebung erläutert. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Benchmarkings als Instrument zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz.
Verdienste und Erfolge des Benchmarkings: Das Kapitel untersucht die Erfolge und den Nutzen von Benchmarking in Deutschland, mit einem Vergleich zu internationalen Beispielen (Schweiz und Großbritannien). Es beleuchtet unterschiedliche Ansätze und deren Integration in die Verwaltungsorganisation. Der Fokus liegt auf der Darstellung der positiven Ergebnisse und deren Vergleichbarkeit.
Entfaltungen in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Anwendung von Benchmarking-Methoden innerhalb der deutschen öffentlichen Verwaltung. Es analysiert den praktischen Einsatz und die erzielten Resultate, eventuell auch Herausforderungen und regionale Unterschiede.
Erfolgskritische Elemente und allgemeine Schwierigkeiten: Dieser Abschnitt analysiert die Faktoren, die den Erfolg von Benchmarking-Initiativen behindern oder verhindern können. Es werden potentielle Schwierigkeiten und Herausforderungen im Detail untersucht und Lösungsansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Benchmarking, Verwaltungscontrolling, New Public Management (NPM), Effizienz, Effektivität, Leistungsvergleich, Best Practices, interne Benchmarking, externe Benchmarking, Kennzahlen, öffentliche Verwaltung, Kommunalverwaltung, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Benchmarking in der öffentlichen Verwaltung
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht zum Thema Benchmarking in der öffentlichen Verwaltung. Es behandelt die Grundlagen, verschiedene Arten und Anwendungen von Benchmarking, seine Erfolge und Herausforderungen sowie internationale Vergleiche.
Was sind die Ziele und Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Dokument untersucht kritisch Benchmarking als Instrument des Verwaltungscontrollings. Es erläutert die Grundlagen, beleuchtet die Bedeutung für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und analysiert die praktische Anwendung. Dabei werden sowohl Vorteile als auch Herausforderungen im Detail betrachtet. Die Schwerpunkte liegen auf den Grundlagen und Definitionen, Benchmarking im Kontext des New Public Management (NPM), den Arten und Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, den Erfolgsfaktoren und Herausforderungen sowie internationalen Vergleichen.
Welche Arten von Benchmarking werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet zwischen internem und externem (horizontalem) Benchmarking und erläutert die Anwendung und Auswahl geeigneter Objekte für den Vergleich.
Welche Rolle spielt das New Public Management (NPM)?
Das Dokument positioniert Benchmarking als Instrument zur Verbesserung der Effizienz und zur Nachahmung des Wettbewerbs der freien Wirtschaft im Kontext des New Public Management (NPM). Der Einfluss des NPM auf die Anwendung von Benchmarking in der öffentlichen Verwaltung wird ausführlich diskutiert.
Welche Erfolgsfaktoren und Herausforderungen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument analysiert sowohl die positiven Ergebnisse und den Nutzen von Benchmarking als auch die Faktoren, die den Erfolg behindern können. Es werden potentielle Schwierigkeiten und Herausforderungen detailliert untersucht, und Lösungsansätze diskutiert.
Wie wird der internationale Vergleich von Benchmarking-Ansätzen behandelt?
Das Dokument enthält einen internationalen Vergleich, der unter anderem Beispiele aus der Schweiz und Großbritannien heranzieht, um verschiedene Ansätze und deren Integration in die Verwaltungsorganisation zu beleuchten und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in diesen?
Das Dokument beinhaltet Kapitel zu Einleitung, Grundlagen des Benchmarkings, Benchmarking als Instrument zur Effektivitäts- und Effizienzintensivierung, Verdienste und Erfolge des Benchmarkings, Entfaltungen in der Bundesrepublik Deutschland, erfolgskritische Elemente und allgemeine Schwierigkeiten sowie ein Resümee und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Benchmarkings, von Definitionen und Grundlagen bis hin zu praktischen Anwendungen, Herausforderungen und internationalen Vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen Benchmarking, Verwaltungscontrolling, New Public Management (NPM), Effizienz, Effektivität, Leistungsvergleich, Best Practices, internes Benchmarking, externes Benchmarking, Kennzahlen, öffentliche Verwaltung, Kommunalverwaltung, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Kritische Beurteilung des Benchmarkings als Instrument des Verwaltungscontrollings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173496