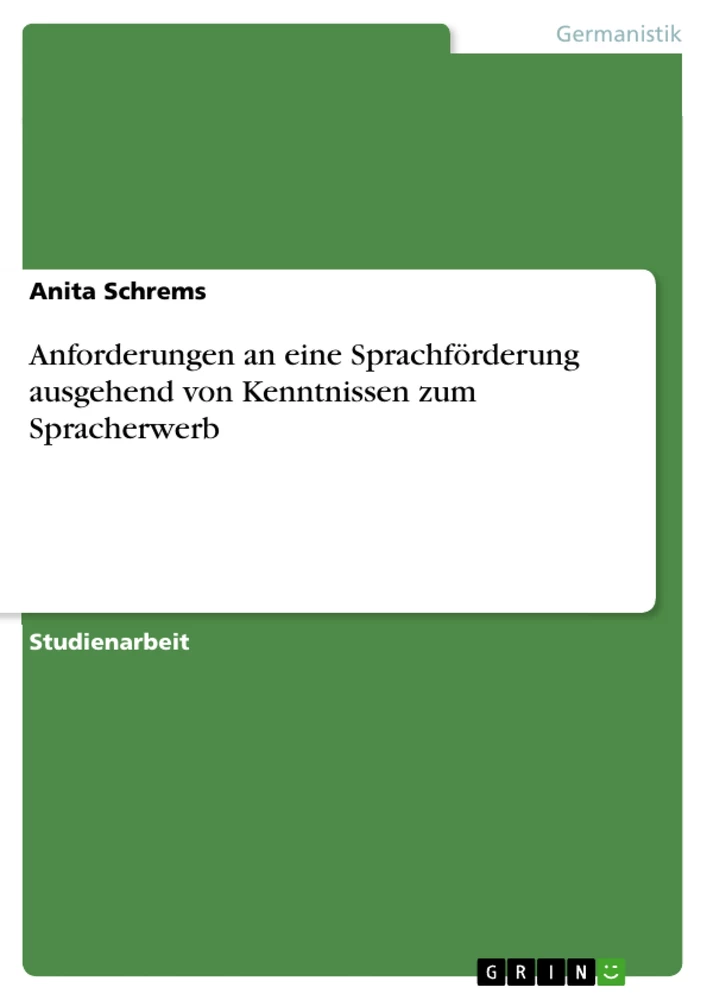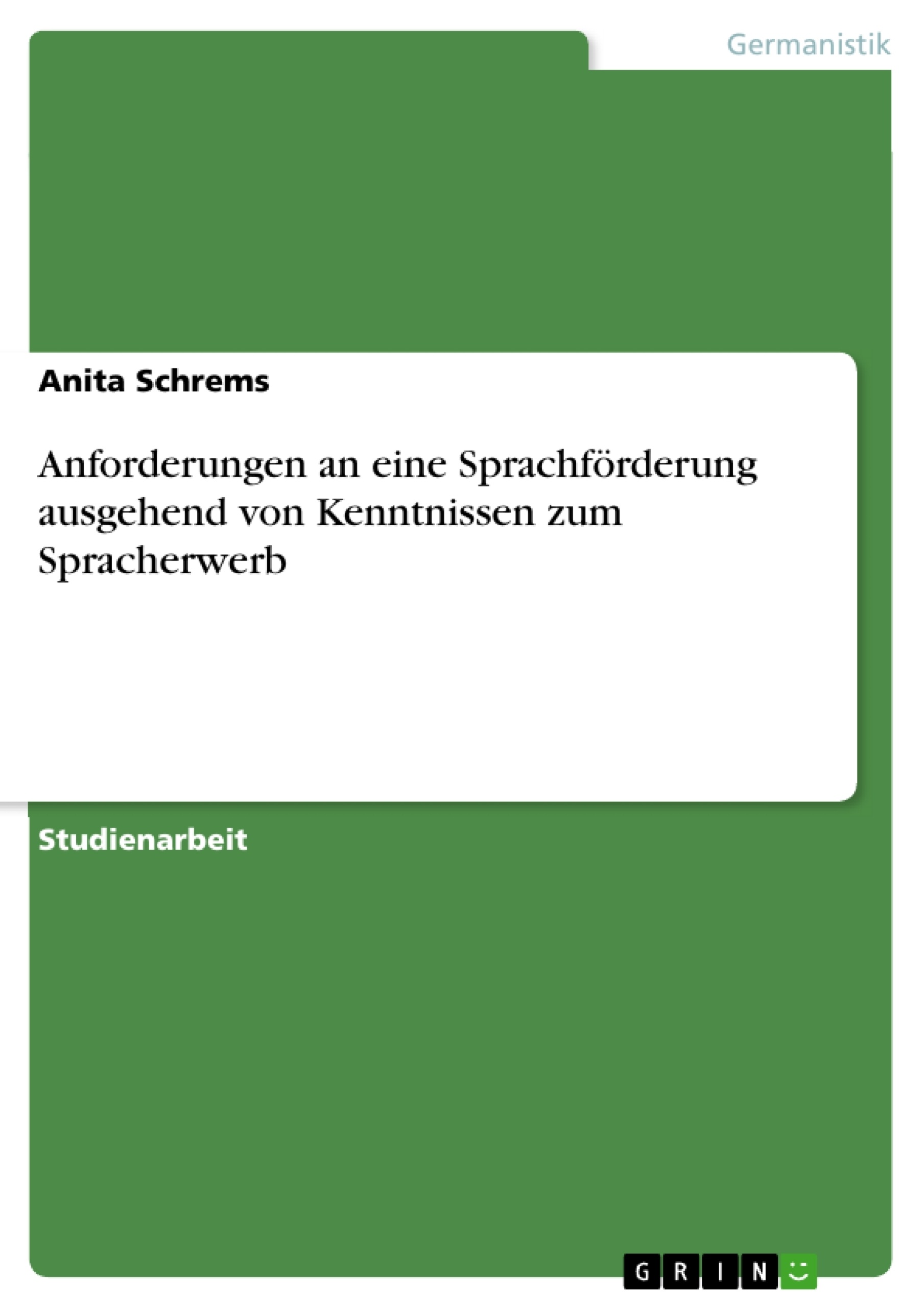In Deutschland leben derzeit etwa „15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund“. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund nehmen in Westdeutschland etwa ein Drittel ein.
Diese jungen Menschen wachsen vorwiegend in Familien auf, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Da die Eltern häufig über defizitäre Deutschsprachkenntnisse verfügen, wird den Kindern zuhause ein suboptimales Sprachangebot (sprachlicher Input) dargeboten. Die Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb sind also erschwert. Nicht überraschend ist sodann, dass die Betroffenen in PISA und IGLU Studien schlechtere Ergebnisse zeigen. Sprachliches Können braucht man nicht nur für das Fach Deutsch, sondern ebenso für alle anderen Schulfächer.
Korrelation von Bildungserfolg und Sprachbeherrschung, erschwerte Bedingungen und Voraussetzungen beim Spracherwerb, keine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft durch zum Beispiel schlechtere Ausbildungschancen begründen somit die Notwendigkeit von Sprachförderung.
2. Hauptteil: Anforderungen an eine Sprachförderung ausgehend von Kenntnissen zum Spracherwerb
Für eine erfolgreiche Sprachförderung der Zweitsprachlernenden ist eine grundlegende Voraussetzung, dass die Förderinnen und Förderer ein umfangreiches Hintergrundwissen über den Spracherwerb in der Erst- und Zweitsprache besitzen. Nach Tracy R. ist es nur möglich den genauen Stand des Kindes zu erfassen, wenn man die Phasen des Spracherwerbs kennt und informiert ist, auf welche „systematische Art und Weise […] sich Kinder Sprache aneignen.“
Im Folgenden geht es darum, wie man das Wissen über den monolingualen, also den einsprachigen Erstspracherwerb nutzen kann, um Anforderungen an eine Sprachförderung aufzustellen und zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Notwendigkeit von Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland
- 2. Hauptteil: Anforderungen an eine Sprachförderung ausgehend von Kenntnissen zum Spracherwerb
- Anforderung aus Sicht des Nativismus
- Nativistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
- Aufbau von Regelwissen als Anforderung
- Anforderung aus Sicht des Kognitivismus
- Kognitivistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
- Frühzeitige und handlungsorientierte Sprachförderung als Anforderung
- Anforderung aus Sicht des Interaktionismus
- Interaktionistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
- Mehrdimensionale Sprachförderung als Anforderung
- Anforderung aus Sicht des Nativismus
- 3. Schlussteil: Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Anforderungen an eine Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland, ausgehend von Erkenntnissen zum Spracherwerb. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen verschiedener Erklärungsmodelle des Erstspracherwerbs (Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus) und leitet daraus konkrete Anforderungen an Sprachfördermaßnahmen ab.
- Nativistische Ansätze und deren Implikationen für den Spracherwerb von Zweitsprachlernenden
- Kognitivistische Perspektiven auf Sprachförderung und deren Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung
- Interaktionistische Theorien und deren Einfluss auf die Gestaltung von mehrdimensionalen Sprachförderprogrammen
- Praxisbezogene Übertragung der theoretischen Erkenntnisse auf bestehende Sprachförderkonzepte
- Die Notwendigkeit einer evidenzbasierten Sprachförderung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Notwendigkeit von Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland
Dieses Kapitel führt in die Problematik der Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland ein und beleuchtet die Notwendigkeit einer gezielten Förderung. Es werden Statistiken zum Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland und die daraus resultierenden Herausforderungen für den Spracherwerb und die Bildung dieser Kinder dargestellt.
2. Hauptteil: Anforderungen an eine Sprachförderung ausgehend von Kenntnissen zum Spracherwerb
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den Anforderungen an eine erfolgreiche Sprachförderung, die aus verschiedenen Erklärungsmodellen des Spracherwerbs abgeleitet werden. Es werden die Ansätze des Nativismus, des Kognitivismus und des Interaktionismus vorgestellt und ihre jeweiligen Implikationen für die Sprachförderung beleuchtet.
2.1 Anforderung aus Sicht des Nativismus
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle von angeborenen Sprachlernmechanismen beim Erstspracherwerb und deren Relevanz für die Förderung von Zweitsprachlernenden. Es wird das Konzept des "Language-Acquisition-Device" (LAD) von Chomsky vorgestellt und dessen Bedeutung für die Entwicklung von grammatischem Regelwissen diskutiert.
2.1.1 Nativistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
Dieses Unterkapitel geht detailliert auf das nativistische Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs ein. Es werden die Kernaussagen des LAD-Modells erläutert, wie z.B. die Rolle von formalen und substantiellen Universalien sowie die Hypothesenbildung und -bewertung im Spracherwerbsprozess.
2.1.2 Aufbau von Regelwissen als Anforderung
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Aufbaus von Regelwissen für den Spracherwerb von Zweitsprachlernenden. Es wird deutlich gemacht, dass eine gezielte Förderung des Regelverständnisses in der Sprachförderung unerlässlich ist, um die grammatische Kompetenz der Kinder zu verbessern.
2.2 Anforderung aus Sicht des Kognitivismus
Dieser Abschnitt analysiert die kognitivistischen Ansätze zum Spracherwerb und deren Relevanz für die Sprachförderung. Es werden die Rolle von kognitiven Prozessen und der Interaktion mit der Umwelt im Spracherwerbsprozess untersucht.
2.2.1 Kognitivistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
Dieses Unterkapitel befasst sich mit dem kognitivistischen Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs. Es werden die Kernaussagen des Kognitivismus und dessen Einfluss auf die Gestaltung von Sprachfördermaßnahmen erläutert.
2.2.2 Frühzeitige und handlungsorientierte Sprachförderung als Anforderung
Dieser Abschnitt betont die Bedeutung von frühzeitiger und handlungsorientierter Sprachförderung, die auf den kognitiven Bedürfnissen der Kinder basiert. Es wird die Relevanz von interaktiven und sinnvollen Lernumgebungen für den Spracherwerb hervorgehoben.
2.3 Anforderung aus Sicht des Interaktionismus
Dieser Abschnitt untersucht die interaktionistischen Ansätze zum Spracherwerb und deren Implikationen für die Gestaltung von Sprachfördermaßnahmen. Es wird die Bedeutung von sozialer Interaktion und dem Input von der Umwelt für den Spracherwerbprozess analysiert.
2.3.1 Interaktionistisches Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs
Dieses Unterkapitel stellt das interaktionistische Erklärungsmodell des Erstspracherwerbs vor. Es werden die Kernaussagen des Interaktionismus und dessen Einfluss auf die Gestaltung von Sprachfördermaßnahmen erläutert.
2.3.2 Mehrdimensionale Sprachförderung als Anforderung
Dieser Abschnitt betont die Bedeutung von mehrdimensionalen Sprachfördermaßnahmen, die alle relevanten Bereiche des Spracherwerbs abdecken. Es wird die Relevanz von sprachlichen, kognitiven und sozialen Aspekten der Sprachförderung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Spracherwerb, Migrationshintergrund, Zweitspracherwerb, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, Sprachentwicklung, Sprachkompetenz, Grammatik, Sprachliche Frühförderung, Mehrsprachige Bildung, Inklusion
- Quote paper
- Anita Schrems (Author), 2008, Anforderungen an eine Sprachförderung ausgehend von Kenntnissen zum Spracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173302