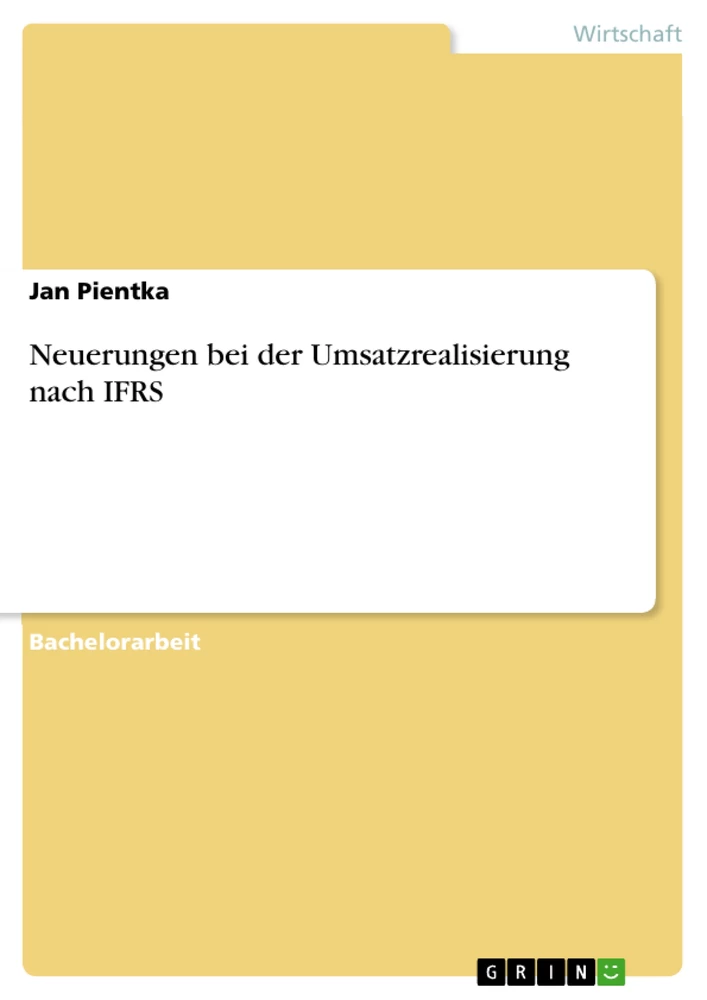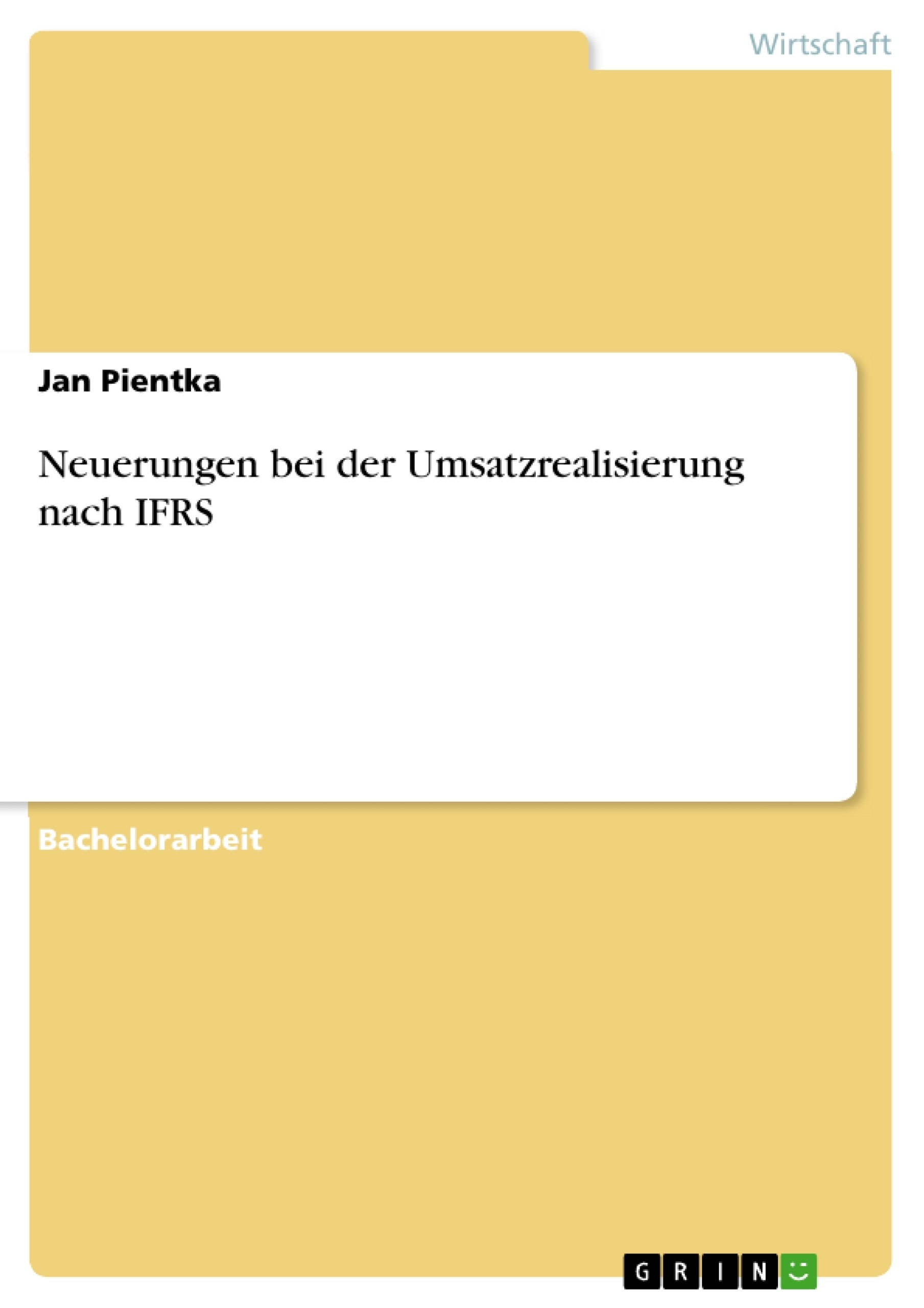“How hard can it be to recognize revenue? Very, and it’s not getting easier.” Die Worte, mit denen Dean Petracca, Global Software Industry Leader bei PricewaterhouseCoopers, die Umsatzrealisierung nach US-GAAP charakterisiert sind klar strukturiert. Ebenso einfach sollte die Erfassung generierter Umsätze im Unternehmen sein, denn die Erbringung einer Leistung in einem bestmmten Zeitraum lässt sich in der Theorie einfach beziffern. Im Zuge der Kapitalmarktausrichtung wurde der Umsatz jedoch zu einem Gradmesser für den Unternehmenserfolg, entweder in Form eines simplen Periodenvergleiches oder verpackt in Rentabilitätskennzahlen. Die Abhängigkeit von Investoren lässt sich bereits in den 80er Jahren nachweisen, als eine Studie des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission zu dem Ergebnis kommt, dass „bei rund der Hälfte der … in den Jahren 1987 bis 1997 aufgedeckten Betrugsdelikte… die Umsatzrealisation dem Grunde oder der Höhe nach manipuliert wurde.“ Auch nach der Wahrnehmung der Problematik durch die Security and Exchange Commission konnten große Unternehmen in Zeiten der New Economy Umsätze steuern und manipulieren. Die Firma Xerox bspw. hat zwischen 1997 und 2001 6,1 Mrd. Euro an unrealisierten Umsätzen ausgewiesen, die zu großen Teilen aus langfristigen Leasingverträgen stammten. Insbesondere diese Vorfakturierung unrealisierter Umsätze kritisierte der Chairman der Security and Exchange Commission, Levitt, in seiner berühmten Rede „The Numbers Game.“ Die etwa 100, aus der Praxis abgeleiteten, amerikanischen Standards bieten heute zwar aufgrund einer „kasuistische[n] Generierung von Normen“ Einzelfallentscheidungen, jedoch verlangen die globalen Kapitalverflechtungen eine einheitliche Sprache, die geschäftliche Transaktionen hinreichend genau beschreibt und andererseits genügend Freiraum für branchen- und länderspezifische Anpassungen besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation
- 2.1. Grundprinzipien deutscher und amerikanischer Rechnungslegung
- 2.2. Erträge und Aufwendungen
- 3. Umsatzrealisation nach IFRS
- 3.1. Standard und Zeitpunkt der Umsatzrealisation
- 3.2. Umsatzrealisation nach IAS 18
- 3.2.1. Umsatzrealisation bei einem Kaufvertrag
- 3.2.2. Sonstige Umsatzrealisation
- 4. Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen
- 4.1. Bilanzierungsansatz der IFRS
- 4.2. Ansätze des EITF 00-21
- 4.3. Umsatzrealisation für Software nach SOP 97-2
- 4.4. Mehrkomponentenverträge nach SOP 97-2
- 5. ED 2010/6
- 5.1. Anwendung und Grundprinzipien des ED
- 5.2. Umsatzrealisation nach den Kernprinzipien
- 5.2.1. Vertragsidentifizierung
- 5.2.2. Identifizierung der Leistungsverpflichtungen
- 5.2.3. Determinierung des Transaktionspreises
- 5.2.4. Verteilung des Transaktionspreises auf Leistungsverpflichtungen
- 5.2.5. Umsatzrealisierung bei Erfüllung der Leistungsverpflichtung
- 5.3. Sonstige Bestimmungen des ED
- 5.4. Mehrkomponentengeschäfte im Beispiel
- 6. Kritische Würdigung ausgewählter Aspekte
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit Neuerungen bei der Umsatzrealisation nach IFRS. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Rechnungslegungsstandards und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Bilanzierung von Unternehmen. Der Fokus liegt insbesondere auf der Anwendung des Exposure Draft (ED) 2010/6 und den Neuerungen, die dieser für die Umsatzrealisation bringt.
- Grundprinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation
- Umsatzrealisation nach IFRS und IAS 18
- Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen
- Anwendung des ED 2010/6
- Kritische Würdigung der Neuerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Umsatzrealisation ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 behandelt die Grundprinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation, wobei die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Rechnungslegung beleuchtet werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Umsatzrealisation nach IFRS, insbesondere mit den Standards und dem Zeitpunkt der Umsatzrealisation. Kapitel 4 widmet sich der Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen und den unterschiedlichen Ansätzen der IFRS, des EITF 00-21 und des SOP 97-2. Kapitel 5 analysiert den ED 2010/6, seine Anwendung und die Kernprinzipien der Umsatzrealisation. Kapitel 6 widmet sich einer kritischen Würdigung ausgewählter Aspekte der Neuerungen. Abschließend enthält Kapitel 7 eine Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen bietet.
Schlüsselwörter
IFRS, Umsatzrealisation, Mehrkomponentenverträge, ED 2010/6, Rechnungslegung, Bilanzierung, IAS 18, EITF 00-21, SOP 97-2
- Quote paper
- Jan Pientka (Author), 2011, Neuerungen bei der Umsatzrealisierung nach IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173284