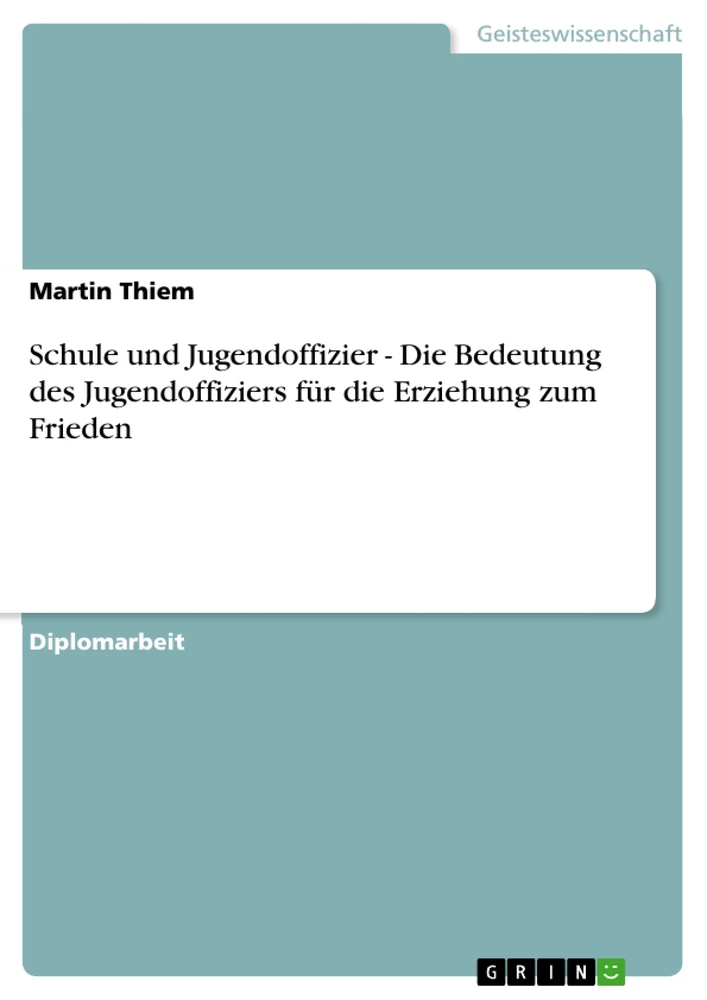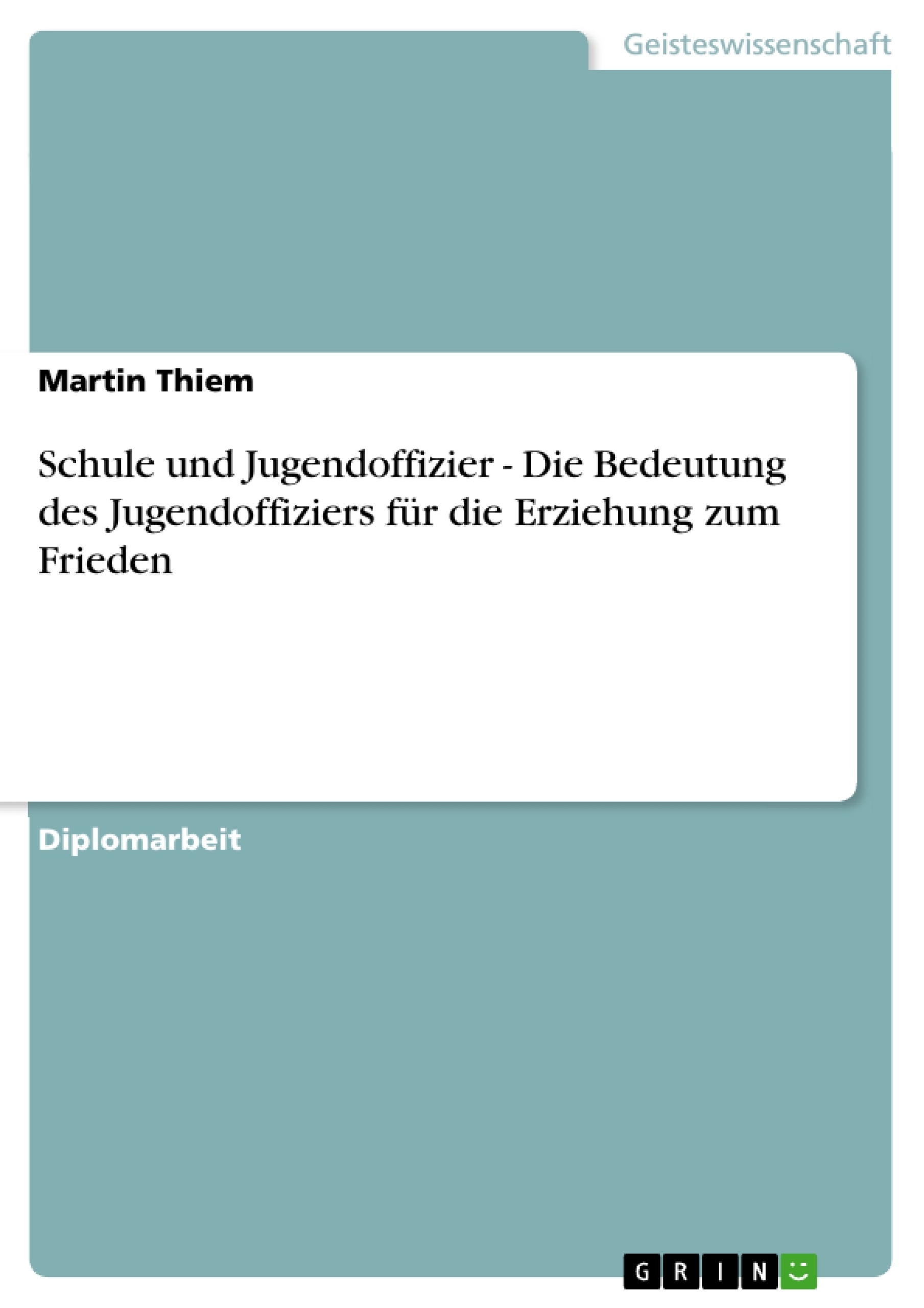Jugendoffiziere sind als Referenten für sicherheitspolitische Fragen ein fester Bestandteil der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Seit fast 50 Jahren stehen Jugendoffiziere im Dialog mit der Öffentlichkeit und erläutern die Grundlinien der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, den erweiterteten Sicherheitsbegriff, Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr, die Einbindung der Bundeswehr innerhalb internationaler Organisationen. Primäre Zielgruppe sind Jugendliche und jugendliche Erwachsene, die ihn vornehmlich in Bildungsinstitutionen antreffen und dort von ihm informiert werden, aber auch Gewerkschaften, Studenten, Referendare etc. wollen als Multiplikatoren gewonnen werden. Für viele junge Menschen ist er aber der erste Kontakt zur Bundeswehr. Im Jahr 2005 waren in Deutschland 94 hauptamtliche sowie ca. 300 nebenamtliche Jugendoffiziere tätig. Laut Jahresbericht waren sie in fast 8.000 Einsätzen unterwegs. Bezogen auf die Zusammenarbeit mit Schulen liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Jugendoffiziers in der Unterstützung des Schulunterrichts im Rahmen des Gemeinschaftskunde-, Politik- oder Sozialkundeunterrichts. In der vorliegenden Diplomarbeit sollen die beiden angesprochenen Institutionen, nämlich Jugendoffizier und Schule, im Hinblick auf die Erziehung zum Frieden vorgestellt werden. Hierbei wird der Einsatz des Jugendoffiziers in der Schule nach seiner ethischen Legitimität untersucht. Es soll geklärt werden, um welche besondere Kommunikationsform es sich bei den Unterrichtsbesuchen handelt. Das Forschungsvorhaben lässt sich mit folgendem Zitat skizzieren: "Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit besteht darin, welche ethische Legitimation die Institutionen 'Schule' und 'Jugendoffier' in der Erziehung zum Frieden haben. Ferner geht es darum, eine Aussage darüber zu treffen, dass die Bundeswehr die Arbeit des Jugendoffiziers dazu nutzt, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Imagepflege zu betreiben."
Während der Recherchephase 2006 nahm der Verfasser am Grundlehrgang für Jugendoffiziere an der Akademie für Kommunikation der Bundeswehr in Strausberg teil.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedenserziehung als Konsequenz der Friedensforschung
- Grundlagen der Friedensforschung
- Erkenntnisse der Friedensforschung im Hinblick auf den Friedensbegriff
- Zugänge zum Kriegsbegriff
- Erziehung zum Frieden
- Die Institutionen Schule und Jugendoffizier in der Erziehung zum Frieden: Vorstellung der beiden Institutionen
- Der Institutionenbegriff
- Schule als Institution
- Politikunterricht in der Schule
- Vorgaben der Kultusministerien der Bundesländer im Politikunterricht
- Niedersächsische Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach Gemeinschaftskunde in der gymnasialen Oberstufe
- Der Jugendoffizier als Institution
- Jugendoffiziere in der Anfangsphase der Bundeswehr
- Jugendoffiziere in den 1960er- bis 1970er-Jahren
- Jugendoffiziere in den 1980er- und 1990er-Jahren
- Institutionelle Ausbildung zum Jugendoffizier in der Gegenwart
- Das Zusammenwirken von Schule und Jugendoffizier
- Beispiel 1: Der Besuch eines Jugendoffiziers in einem Politikkurs einer ausgewählten gymnasialen Oberstufe
- Bewertung aus der Sicht des Jugendoffiziers
- Bewertung aus der Sicht des Kursleiters
- Bewertung aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler
- Beispiel 2: Die Simulation POL&IS
- Funktionsweise der Simulation
- Erfahrungen zur Anwendung der Simulation POL&IS
- Der Jugendoffizier: Politische Bildung als effiziente Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Jugendoffiziers für die Erziehung zum Frieden. Sie analysiert die Rolle des Jugendoffiziers in der politischen Bildung und betrachtet den Einfluss der Institution auf die pädagogischen Prozesse an Schulen. Die Arbeit untersucht das Zusammenspiel von Schule und Jugendoffizier und beleuchtet die Möglichkeiten und Herausforderungen der Zusammenarbeit im Bereich der Friedenserziehung.
- Der Friedensbegriff und seine Relevanz im Kontext der Friedensforschung
- Die Rolle des Jugendoffiziers in der politischen Bildung
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendoffizier in der Friedenserziehung
- Die Bedeutung von Institutionellen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Implementierung von Friedenserziehung
- Die Evaluation von Praxisbeispielen für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendoffizier
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Friedenserziehung ein und stellt die Relevanz des Jugendoffiziers in diesem Kontext heraus. Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Friedensforschung, definiert den Friedensbegriff und betrachtet die historischen Entwicklungen des Konflikts.
Kapitel drei analysiert die Institutionen Schule und Jugendoffizier in der Friedenserziehung. Es befasst sich mit der Funktionsweise von Institutionen, der Rolle der Schule in der politischen Bildung und der historischen Entwicklung des Jugendoffiziers in der Bundeswehr.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Zusammenwirken von Schule und Jugendoffizier. Es präsentiert zwei Praxisbeispiele: den Besuch eines Jugendoffiziers in einem Politikkurs einer gymnasialen Oberstufe und die Simulation POL&IS. Die Kapitel beleuchten die Bewertung der Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven.
Kapitel fünf untersucht den Jugendoffizier als Instrument der politischen Bildung und betrachtet dessen Bedeutung für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr.
Schlüsselwörter
Friedenserziehung, Jugendoffizier, Schule, politische Bildung, Institution, Friedensforschung, Kriegsbegriff, Bundeswehr, Simulation, POL&IS, Öffentlichkeitsarbeit
- Quote paper
- Dipl.-Staatswiss. (Univ.) Martin Thiem (Author), 2006, Schule und Jugendoffizier - Die Bedeutung des Jugendoffiziers für die Erziehung zum Frieden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173150