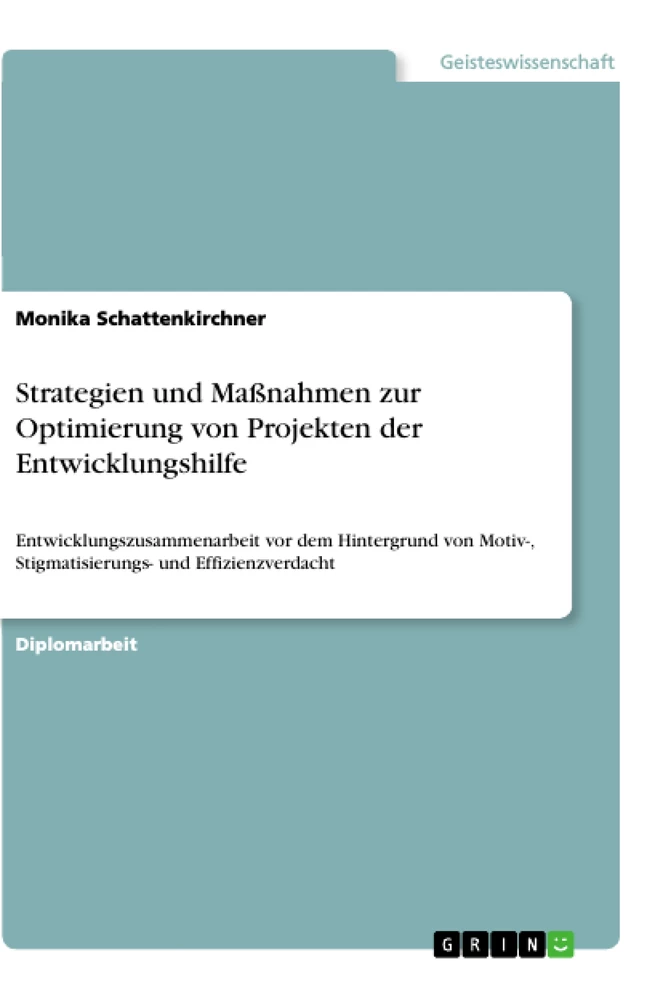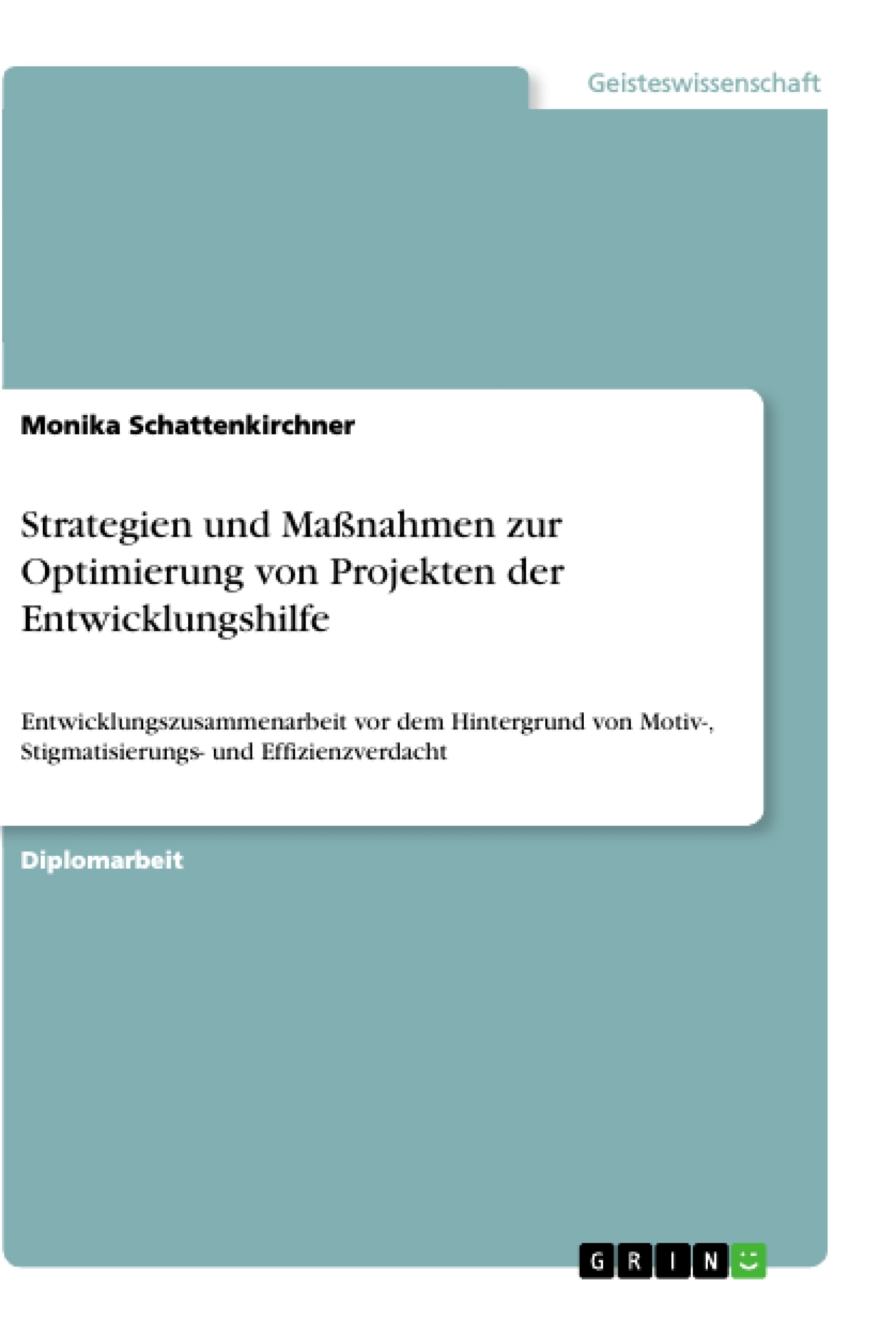[...] Dann und wann klingen Stimmen über „misslungene“ Entwicklungsprojekte zu
uns durch, sogar vom „Vergeblichkeitssyndrom“ (Sangmeister 2009, S.164) der
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ist die Rede.
Wie in sozialen Angelegenheiten üblich, ist das Resultat vorab schwer
abzuschätzen. Doch wann spricht man von einem negativen Ergebnis in der
Entwicklungshilfe? Und wann ist Entwicklungshilfe gelungen? Ist es überhaupt
sinnvoll zu helfen und wie würde man dann Nicht-Hilfe rechtfertigen? Wem
hilft die Entwicklungshilfe eigentlich? Dient die Hilfe letzten Endes nur als Daseinsberechtigung für die Helfenden und verstellt gar das Selbsthilfepotential
derer, denen geholfen wird, indem ihnen geholfen wird?
Diesen Fragen wollen wir im ersten Teil der vorliegenden mit Hilfe der 3
Verdachtsmomente (Motiv-, Stigmatisierungs- und Effizienzverdacht) von Dirk
Baecker nachgehen.
Welchen Orientierungsrahmen setzt die Regierung, um Entwicklungshilfe
erfolgreich nennen zu können? Welche Strategien gibt, es den
Verdachtsmomenten Baeckers zu entgehen? Gibt es Richtlinien für
Entwicklungszusammenarbeit bzw. -hilfe? Für wen sind diese verbindlich? Und
wer kontrolliert deren Einhaltung?
Auf die Existenz und Verbindlichkeit von Richtlinien und Strategien der
Entwicklungspolitik, also staatlicher Rahmenbedingungen, wird im zweiten
Teil der Arbeit näher eingegangen. Hierbei bilden die Ergebnisse aus UNKonferenzen,
die Millenniumsentwicklungsziele und die Pariser Erklärung den
Hauptbezugspunkt.
Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen der Maßnahmen, die
im Prozess von Bedeutung sind. Maßnahmen und Vorgaben bei der
Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten stehen in diesem Abschnitt im
Vordergrund. Dabei werden einschlägige Begriffe, die der Entwicklungshilfe
als Orientierung dienen, näher erklärt. [...] Des Weiteren wird in Kapitel 3 auf die Erfolgs- und Wirkungsmessung von
Entwicklungshilfe-Projekten eingegangen. Hierbei beschäftigen uns die Fragen, wann ein Entwicklungshilfe-Projekt als hilf- und erfolgreich gilt. Und ob die
genannten politischen Richtlinien und Maßnahmen zur Umsetzung von
Projekten den Helfern dabei helfen, erfolgreich zu unterstützen. Auch wer das
Ergebnis der Hilfe bewertet und welches Ergebnis erstrebenswert ist, wird in
diesem Teil angesprochen.
Entscheidet der jeweilige Entwicklungshelfer darüber, was den zu Helfenden
hilft und wann ihnen geholfen ist? Und endet im Idealfall nach Abschluss von
Projekten der Hilfebedarf?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Verdachtsmomente
- 1.1 Motivverdacht
- 1.2 Stigmatisierungsverdacht
- 1.3 Effizienzverdacht
- 1.4 System der sozialen Hilfe
- 2. Strategien und Struktur der Entwicklungszusammenarbeit (entwicklungspolitische Rahmenbedingungen)
- 2.1 Strategien und Prinzipien der Entwicklungszusammenarbeit
- 2.1.1 Modernisierungs- und Industrialisierungsstrategien
- 2.1.2 Dependenztheorien und "Neokolonialismus"
- 2.1.3 Grundbedürfnisstrategie
- 2.1.4 Strategie der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung
- 2.1.4.1 Verteilungsgerechtigkeit
- 2.1.4.2 Chancengerechtigkeit
- 2.2 Entwicklungspolitische Ziele und Richtlinien
- 2.2.1 UN-Konferenzen
- 2.2.1.1 UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992
- 2.2.1.2 Weltgipfel für soziale Entwicklung in Kopenhagen 1995
- 2.2.1.3 Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSSD) in Johannesburg 2002
- 2.2.2 Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)
- 2.2.3 Aktuelle Ergebnisse: Paris-Deklaration von 2005 und Aktionsplan von Accra 2008
- 3. Maßnahmen und Vorgaben bei der Durchführung von Entwicklungsprojekten
- 3.1 Maßnahmen und Orientierungswerte von Entwicklungshilfeprojekten
- 3.1.1 Kohärenz, Koordination und Komplementarität
- 3.1.2 Gleichberechtigung und Gerechtigkeit
- 3.1.3 Verantwortung und Eigenverantwortung
- 3.1.4 Relevanz
- 3.1.5 Wirkung und Wirksamkeit (impact)
- 3.1.6 Effektivität und Effizienz
- 3.2 Wirkungs- und Nachhaltigkeitsmessung
- 3.2.1 Ziel und Zweck der Erfolgskontrolle bzw. Evaluation
- 3.2.2 Grundlagen der Wirkungs- und Nachhaltigkeitsmessung
- 3.2.3 Durchführung und Form der Evaluation
- 3.2.4 Kurzdarstellung von Projektevaluationen
- Fazit
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Optimierung von Entwicklungshilfeprojekten. Sie analysiert kritisch die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext der Theorie von Dirk Baecker und untersucht, inwieweit aktuelle Strategien, Ziele und Maßnahmen dazu beitragen, die Verdachtsmomente des Motiv-, Stigmatisierungs- und Effizienzverdachts zu entkräften. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und Potenziale der Entwicklungshilfe zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für eine effektivere und nachhaltigere Unterstützung der Entwicklungsländer abzuleiten.
- Die Verdachtsmomente von Dirk Baecker im Kontext der Entwicklungshilfe
- Entwicklungspolitische Strategien und Prinzipien, von der Modernisierungstheorie bis zur Strategie der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung
- Internationale Rahmenbedingungen und Ziele der Entwicklungszusammenarbeit, wie UN-Konferenzen, die Millenniums-Entwicklungsziele und die Pariser Erklärung
- Maßnahmen und Orientierungskriterien für die Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten
- Wirkungs- und Nachhaltigkeitsmessung von Entwicklungshilfeprojekten, inklusive Evaluationsprinzipien und -methoden
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit untersucht die Verdachtsmomente von Dirk Baecker (Motiv-, Stigmatisierungs- und Effizienzverdacht), die die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe in Frage stellen.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklung entwicklungspolitischer Strategien und Prinzipien, von der Modernisierungstheorie bis zur Strategie der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung. Die Arbeit beleuchtet wichtige internationale Rahmenbedingungen und Ziele der Entwicklungszusammenarbeit, wie UN-Konferenzen, die Millenniums-Entwicklungsziele und die Pariser Erklärung.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die konkreten Maßnahmen und Orientierungskriterien für die Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten. Dazu gehören Aspekte wie Kohärenz, Koordination, Komplementarität, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Eigenverantwortung, Relevanz, Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz.
Schließlich beschäftigt sich Kapitel 3.2 mit der Wirkungs- und Nachhaltigkeitsmessung von Entwicklungshilfeprojekten. Die Arbeit erläutert die Bedeutung von Evaluation, verschiedene Evaluationsprinzipien und -methoden und zeigt anhand von Beispielen die praktische Umsetzung der Theorie in der Praxis auf.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Verdachtsmomente, Dirk Baecker, Nachhaltigkeit, Zukunftssicherung, Good Governance, Millenniums-Entwicklungsziele, Pariser Erklärung, Evaluation, Impact Evaluation, Wirkungs- und Nachhaltigkeitsmessung, Effizienz, Relevanz, Eigenverantwortung, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit.
- Quote paper
- Monika Schattenkirchner (Author), 2010, Strategien und Maßnahmen zur Optimierung von Projekten der Entwicklungshilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172988