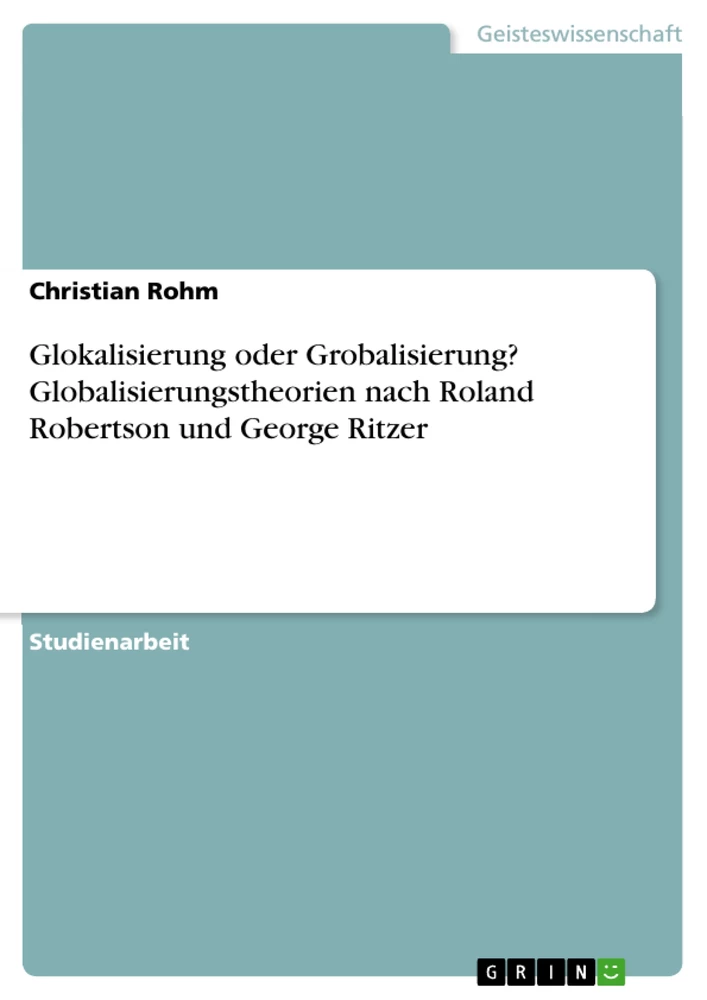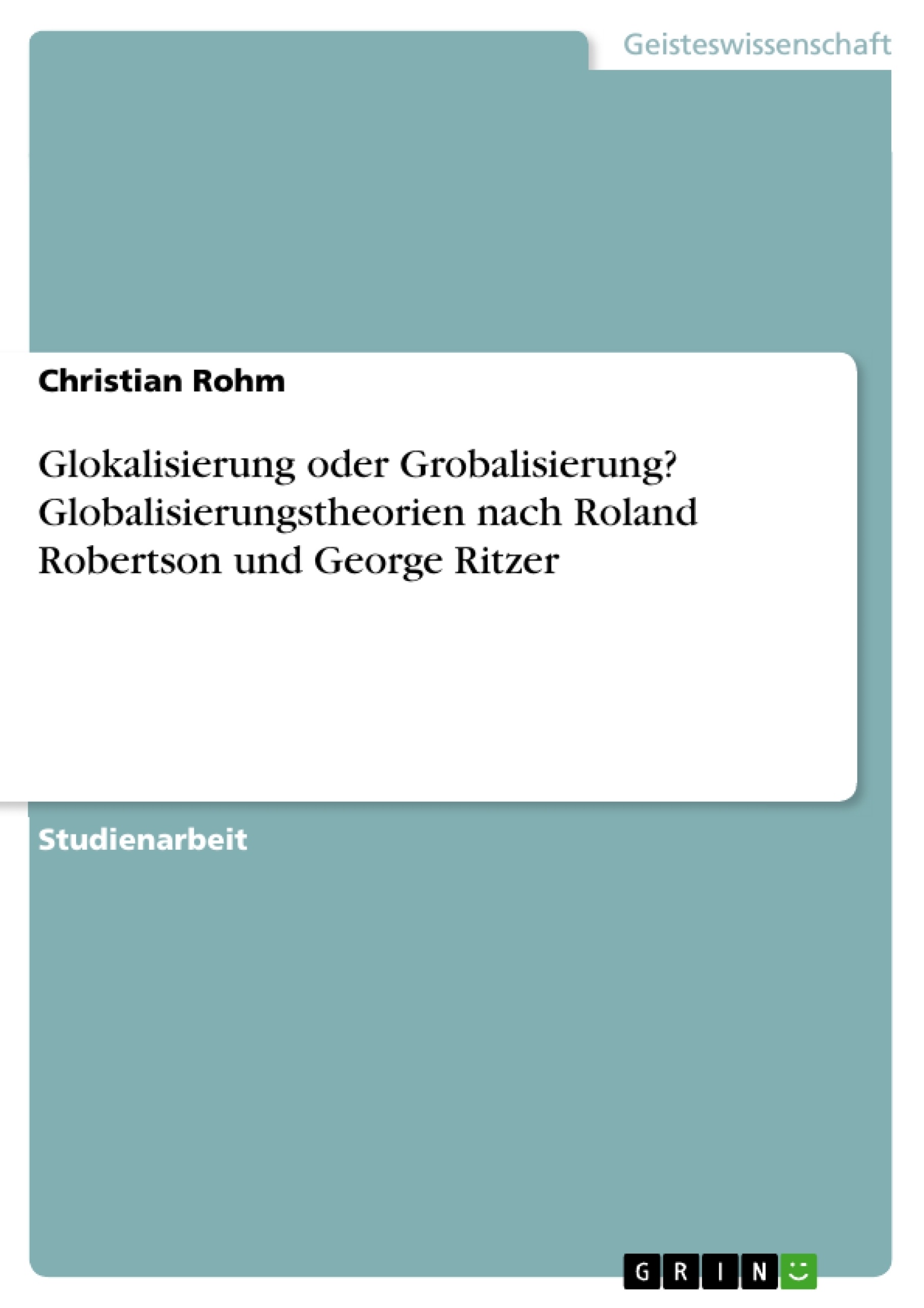Was ist Globalisierung? Wenngleich der Begriff in den öffentlichen Debatten um Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft mittlerweile zu einem der bedeutendsten Schlagworte geworden ist, bleibt er in seiner genaueren Bedeutung eher diffus. Eine eindeutige Definition fällt insbesondere schwer, weil der Begriff häufig für unterschiedliche Bedeutungsgehalte herangezogen wird und es bisher nicht gelungen ist, einen Konsens über seine Bedeutung zu erzielen. So verweist beispielsweise auch der Münchner Soziologe Ulrich Beck auf die Unschärfe des Globalisierungsbegriffs, der die öffentliche und fachliche Diskussion beherrscht. Unumstritten ist lediglich die sehr allgemeine Definition, dass das Wesen der Globalisierung die Überwindung der nationalen und kontinentalen Grenzen bildet und die Tatsache, dass der Globalisierungsbegriff insbesondere fünf Dimensionen umfasst: eine ökonomische, eine politische, eine wissenschaftlich-technische, eine ökologische und eine kulturelle.
Ihren Anfang nahm die wissenschaftliche Globalisierungsdebatte im Wesentlichen zu Beginn der 1990er-Jahre, wenngleich einzelne Vorreiter den Begriff schon zuvor verwendeten – damals jedoch noch häufig bezogen auf einzelne eng umrissene Bereiche und nicht auf ein umfassendes, makrosoziologisches Phänomen. Mittlerweile existieren so viele verschiedene Globalisierungsdefinitionen und -theorien, sodass der Stand der Forschung nur noch schwer zu überblicken ist.
Aufgrund der Bandbreite der Thematik erscheint es daher zweckmäßig, sich auf einen bestimmten Aspekt des Themas zu beschränken. Konkret möchte diese Arbeit mit den Theorieansätzen der Soziologen Roland Robertson und George Ritzer zwei prominente – und sich zum Teil erheblich widersprechende – Theorien der kulturellen Globalisierung aus der Vielstimmigkeit des sozialwissenschaftlichen Diskurses herausgreifen und gegenüberstellen. Zunächst werden die beiden Theorieansätze in ihren groben Grundzügen skizziert (Kapitel 2 und 3), bevor sie miteinander verglichen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Globale Lokalisierung und lokale Globalisierung: Globalisierungsverständnis nach Roland Robertson
- 3. McDonaldisierung der Gesellschaft: Globalisierungsverständnis nach George Ritzer
- 4. Vergleich, Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Globalisierungstheorien von Roland Robertson und George Ritzer. Ziel ist es, zwei prominente und teilweise gegensätzliche Ansätze zur kulturellen Globalisierung gegenüberzustellen und zu diskutieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die mikrosoziologische Perspektive und die Interaktion zwischen globalen und lokalen Prozessen.
- Globalisierung als makrosoziologisches und mikrosoziologisches Phänomen
- Der Begriff der Glokalisierung nach Robertson
- Die McDonaldisierung der Gesellschaft nach Ritzer
- Vergleichende Analyse der beiden Theorien
- Die Rolle des Lokalen in globalen Prozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung diskutiert die Unschärfe des Begriffs "Globalisierung" und seine vielschichtigen Bedeutungen in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte. Sie hebt die fünf zentralen Dimensionen der Globalisierung (ökonomisch, politisch, wissenschaftlich-technisch, ökologisch und kulturell) hervor und begründet die Fokussierung der Arbeit auf die kulturelle Globalisierung durch die Gegenüberstellung der Theorien von Robertson und Ritzer. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und erklärt die Auswahl der beiden theoretischen Ansätze.
2. Globale Lokalisierung und lokale Globalisierung: Globalisierungsverständnis nach Roland Robertson: Dieses Kapitel stellt das Globalisierungsverständnis von Roland Robertson vor, das im Gegensatz zu vielen makrosoziologischen Ansätzen eine mikrosoziologische Perspektive einnimmt. Robertson betont die Interdependenz zwischen Globalem und Lokalem und führt den Begriff der "Glokalisierung" ein, der die wechselseitige Beeinflussung und Vermischung globaler und lokaler Prozesse beschreibt. Die Prozesse der "globalen Lokalisierung" (globale Anwendung lokaler Elemente) und der "lokalen Globalisierung" (lokale Adaption globaler Einflüsse) werden erläutert, wobei die Entstehung einer pluralistischen und hybriden Weltkultur im Mittelpunkt steht. Robertson widerlegt die Vorstellung einer universellen Weltkultur und betont die selektive Einbeziehung des Globalen ins Lokale.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Glokalisierung, Lokalisierung, Roland Robertson, George Ritzer, McDonaldisierung, kulturelle Globalisierung, mikrosoziologische Perspektive, globale Lokalisierung, lokale Globalisierung, Hybridisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Globalisierungsansätze nach Robertson und Ritzer
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text vergleicht und analysiert die Globalisierungstheorien von Roland Robertson und George Ritzer. Der Fokus liegt auf der kulturellen Globalisierung und der Interaktion zwischen globalen und lokalen Prozessen aus einer mikrosoziologischen Perspektive.
Welche Globalisierungstheorien werden verglichen?
Der Text vergleicht die Theorien von Roland Robertson (mit seinem Konzept der Glokalisierung) und George Ritzer (mit seiner Theorie der McDonaldisierung). Beide bieten gegensätzliche, aber einflussreiche Perspektiven auf die kulturelle Globalisierung.
Was ist das Hauptziel des Textes?
Das Hauptziel ist es, die beiden prominenten und teilweise gegensätzlichen Ansätze zur kulturellen Globalisierung gegenüberzustellen und zu diskutieren. Es geht um den Vergleich ihrer Perspektiven und die Analyse der Rolle des Lokalen in globalen Prozessen.
Was versteht Robertson unter Glokalisierung?
Robertson betont die Interdependenz von Globalem und Lokalem. „Glokalisierung“ beschreibt für ihn die wechselseitige Beeinflussung und Vermischung globaler und lokaler Prozesse. Er unterscheidet dabei zwischen „globaler Lokalisierung“ (globale Anwendung lokaler Elemente) und „lokaler Globalisierung“ (lokale Adaption globaler Einflüsse).
Was ist die McDonaldisierung der Gesellschaft nach Ritzer?
Die McDonaldisierung beschreibt nach Ritzer die Ausbreitung von Prinzipien der Fast-Food-Industrie (Effizienz, Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit, Kontrolle) auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft. Dies wird als ein Aspekt der kulturellen Globalisierung verstanden.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Robertsons Globalisierungsverständnis, ein Kapitel zur McDonaldisierung nach Ritzer und ein abschließendes Kapitel mit Vergleich, Diskussion und Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Globalisierung, Glokalisierung, Lokalisierung, Roland Robertson, George Ritzer, McDonaldisierung, kulturelle Globalisierung, mikrosoziologische Perspektive, globale Lokalisierung, lokale Globalisierung und Hybridisierung.
Welche Perspektive nimmt der Text ein?
Der Text nimmt primär eine mikrosoziologische Perspektive ein, indem er die Interaktion zwischen globalen und lokalen Prozessen im Vordergrund betrachtet und die Auswirkungen globaler Trends auf lokale Kulturen analysiert.
Was ist das Fazit des Textes (in Kürze)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse des Vergleichs der Theorien von Robertson und Ritzer zusammen und diskutiert die Stärken und Schwächen beider Ansätze im Hinblick auf das Verständnis der kulturellen Globalisierung. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert dargestellt.)
- Quote paper
- Christian Rohm (Author), 2010, Glokalisierung oder Grobalisierung? Globalisierungstheorien nach Roland Robertson und George Ritzer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172853