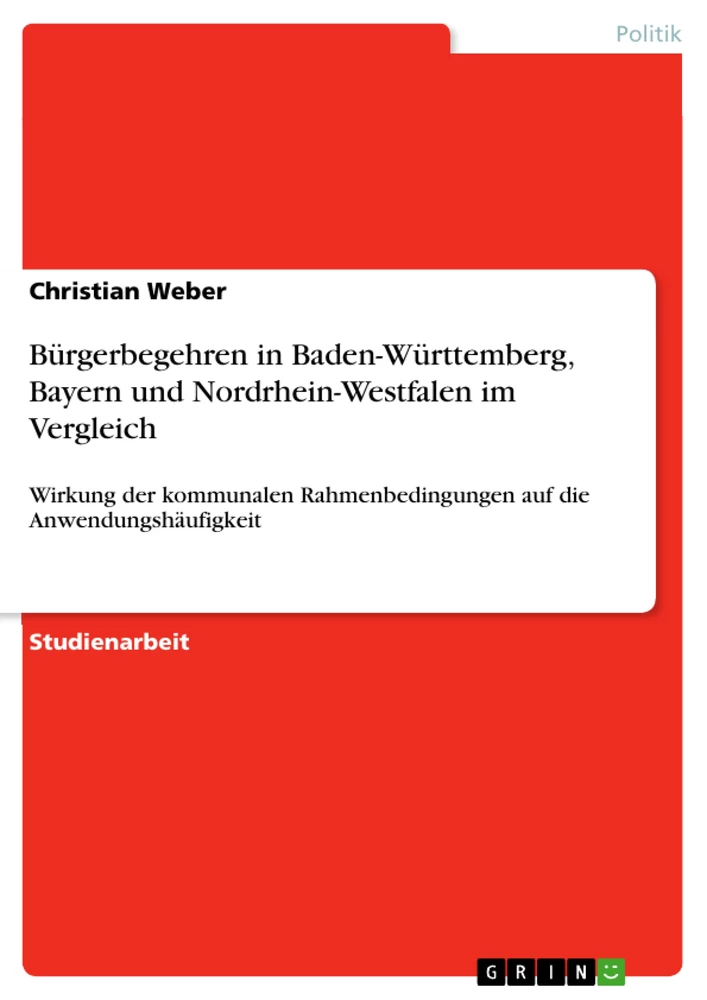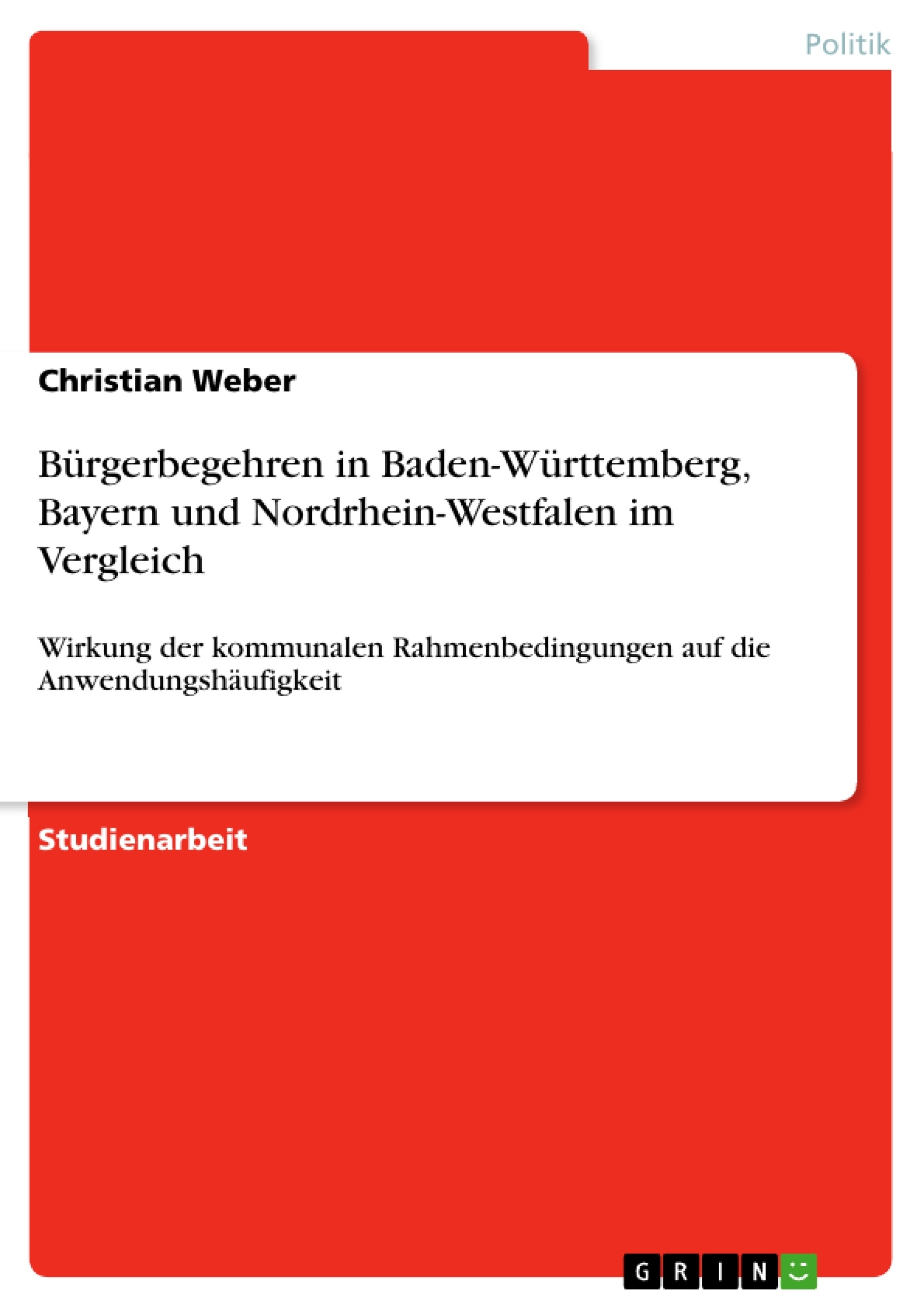Ausgangspunkt für die Fragestellung dieser politikwissenschaftlichen Arbeit ist die in den Medien häufig zitierte Politik- und Parteienverdrossenheit der Bürger. Die Ausweitung von direktdemokratischen Mitwirkungs- und Entscheidungsrechten, gerade auf kommunaler Ebene, wird hierbei in der politikwissenschaftlichen Forschung als probates Mittel gesehen, um die Partizipation der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess auszuweiten. Während in den ersten Jahrzehnten im repräsentativen System der Bundesrepublik direktdemokratische Elemente fast keine Rolle spielten, änderte sich dies im Verlauf der 90er Jahre schlagartig. Ausgehend von Ostdeutschland wurden die Kommunalverfas-sungen durch die flächendeckende Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheide und der Direktwahl des Bürgermeisters dahingehend reformiert. Diese Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf Rechte des Souveräns im Hinblick auf Sachentscheidungen und blendet die Personalentscheidungen in Form der Direktwahl des Bürgermeisters aus. Beim Vergleich der Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren in den einzelnen Bundesländern wird ein markantes Gefälle deutlich. Dieses führt schließlich zur Kernfrage dieser Arbeit: Wie wirken sich die unterschiedlichen institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen der einzelnen Bundesländer auf die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren aus? Ein Vergleich der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen soll dieser Frage nachgehen. Für die Eingrenzung auf diese drei Bundesländer gibt es zwei Gründe. Zum einen haben diese Länder die größten Erfahrungen beim Umgang mit diesem Instrument, zum anderen ist sowohl die Datenlage als auch die Forschungsliteratur für diese am ergiebigsten.
Die Analyse stützt sich zum einen auf die Auswertung der zu diesem Forschungsbereich erschienenen Fachliteratur und zum anderen auf die Datensammlung der „Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie“ an der Universität Marburg. Da es keine offiziellen Statistiken für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gibt(in Baden-Württemberg führt das Innenministerium eine interne Statistik), stellt diese Datenbank die umfangreichste aber leider nicht vollständige Datensammlung dar. Zunächst werden die Genese und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen vorstellt, und die wesentlichen Unterschiede herausgearbeitet. Danach findet ein Vergleich der relevanten Variablen und ihre Auswirkungen auf die Anwendungshäufigkeit statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Regelungen im Überblick
- 2.1 Baden-Württemberg
- 2.2 Bayern
- 2.3 Nordrhein-Westfalen
- 3 Auswirkungen der institutionell-strukturellen Faktoren auf die Anwendungshäufigkeit
- 3.1 Gemeindestruktur
- 3.2 Zulässigkeit
- 3.2.1 Themen
- 3.2.2 Kostendeckung
- 3.2.3 Fristen
- 3.3 Quoren
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese politikwissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss institutioneller und struktureller Rahmenbedingungen auf die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren in deutschen Bundesländern. Sie konzentriert sich auf einen Vergleich zwischen Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, um die Unterschiede in der Nutzung dieses Instruments der direkten Demokratie aufzuzeigen.
- Einfluss institutioneller Faktoren auf die Nutzung von Bürgerbegehren
- Vergleich der Regelungen zu Bürgerbegehren in verschiedenen Bundesländern
- Auswirkungen unterschiedlicher Gemeindestrukturen auf die Anwendungshäufigkeit
- Analyse der Zulässigkeitskriterien für Bürgerbegehren
- Untersuchung der Quoren für die Einleitung und den Erfolg von Bürgerbegehren
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie in Deutschland ein. Sie benennt die zunehmende Politikverdrossenheit als Ausgangspunkt und beschreibt die Rolle von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden als Mittel zur Stärkung der Bürgerpartizipation. Der Fokus liegt auf Sachentscheidungen, während Personalentscheidungen (Direktwahl des Bürgermeisters) ausgeklammert werden. Die Arbeit vergleicht die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen aufgrund der umfangreichen Erfahrungen und Datenlage dieser Bundesländer.
2 Regelungen im Überblick: Dieses Kapitel beschreibt das allgemeine Verfahren eines Bürgerbegehrens und des darauf folgenden Bürgerentscheids, unterteilt in verschiedene Phasen: Initiierung, Qualifizierung, parlamentarische Interaktion und Nachphase. Es werden die Unterschiede zwischen Korrekturbegehren (gegen Ratsbeschlüsse) und Initiativbegehren (neue Themen) erläutert. Die Bedeutung des Unterschriftenquorums und die Rolle des Gemeinderats bei der Zulassung und Entscheidung über das Begehren werden hervorgehoben. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf direktdemokratische Verfahren und schließt Ratsbegehren aus.
2.1 Baden-Württemberg: Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das Bürgerbegehren und Bürgerentscheide bereits in seiner Gründungsverfassung verankerte. Das Kapitel analysiert die Regelungen der baden-württembergischen Gemeindeordnung (Art. 21), einschließlich des Negativkatalogs, der bestimmte Themen vom Bürgerentscheid ausschließt (z.B. Haushaltsfragen, Bauleitplanung). Es werden die Unterschriftenquoren, die Fristen für Korrekturbegehren und das Quorum für den Erfolg eines Bürgerentscheids detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf den Änderungen des Rechts durch Reformen, insbesondere der Reform von 2005, die den Negativkatalog erweiterte und das Zustimmungsquorum senkte.
2.2 Bayern: Im Gegensatz zu Baden-Württemberg war der Weg zur Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Bayern langwierig und von mehreren gescheiterten Versuchen geprägt. Dieses Kapitel beschreibt diesen Prozess und skizziert die Herausforderungen bei der Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung. Der Textfragment endet an dieser Stelle, bevor die bayerischen Regelungen detailliert beschrieben werden.
Schlüsselwörter
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Direkte Demokratie, Kommunalpolitik, Partizipation, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Rahmenbedingungen, Strukturelle Faktoren, Anwendungshäufigkeit, Vergleichende Analyse, Gemeindestruktur, Zulässigkeit, Quoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss institutioneller und struktureller Rahmenbedingungen auf die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren
Was ist der Gegenstand dieser politikwissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss institutioneller und struktureller Rahmenbedingungen auf die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Regelungen und deren Auswirkungen auf die Nutzung dieses Instruments der direkten Demokratie.
Welche Bundesländer werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Auswahl dieser Bundesländer basiert auf der umfangreichen Datenlage und Erfahrung mit Bürgerbegehren in diesen Regionen.
Welche institutionellen und strukturellen Faktoren werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Einfluss verschiedener Faktoren, darunter die Gemeindestruktur, die Zulässigkeitskriterien (einschließlich Themen, Kostendeckung und Fristen), und die Quoren für die Einleitung und den Erfolg von Bürgerbegehren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel mit einem Überblick über die Regelungen in den drei Bundesländern, ein Kapitel zu den Auswirkungen der institutionell-strukturellen Faktoren auf die Anwendungshäufigkeit, und ein Fazit. Zusätzlich werden die Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Themen werden im Kapitel „Regelungen im Überblick“ behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das allgemeine Verfahren eines Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids, einschließlich der Phasen Initiierung, Qualifizierung, parlamentarische Interaktion und Nachphase. Es erläutert Unterschiede zwischen Korrektur- und Initiativbegehren und hebt die Bedeutung des Unterschriftenquorums und die Rolle des Gemeinderats hervor. Ratsbegehren werden ausgeschlossen.
Was sind die Besonderheiten der Regelungen in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg verankerte Bürgerbegehren und -entscheide bereits in seiner Gründungsverfassung. Die Arbeit analysiert die Regelungen der Gemeindeordnung (Art. 21), den Negativkatalog, Unterschriftenquoren, Fristen und das Zustimmungsquorum. Besonderes Augenmerk liegt auf Reformen, insbesondere der von 2005.
Was ist über die bayerischen Regelungen bekannt?
Der Textfragment endet, bevor die bayerischen Regelungen detailliert beschrieben werden. Es wird jedoch erwähnt, dass der Weg zur Einführung von Bürgerbegehren und -entscheiden in Bayern langwierig und von mehreren gescheiterten Versuchen geprägt war.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Direkte Demokratie, Kommunalpolitik, Partizipation, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Rahmenbedingungen, Strukturelle Faktoren, Anwendungshäufigkeit, Vergleichende Analyse, Gemeindestruktur, Zulässigkeit, Quoren.
Welche Art von Entscheidungen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Sachentscheidungen. Personalentscheidungen (z.B. Direktwahl des Bürgermeisters) werden explizit ausgeschlossen.
- Quote paper
- Christian Weber (Author), 2010, Bürgerbegehren in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172836