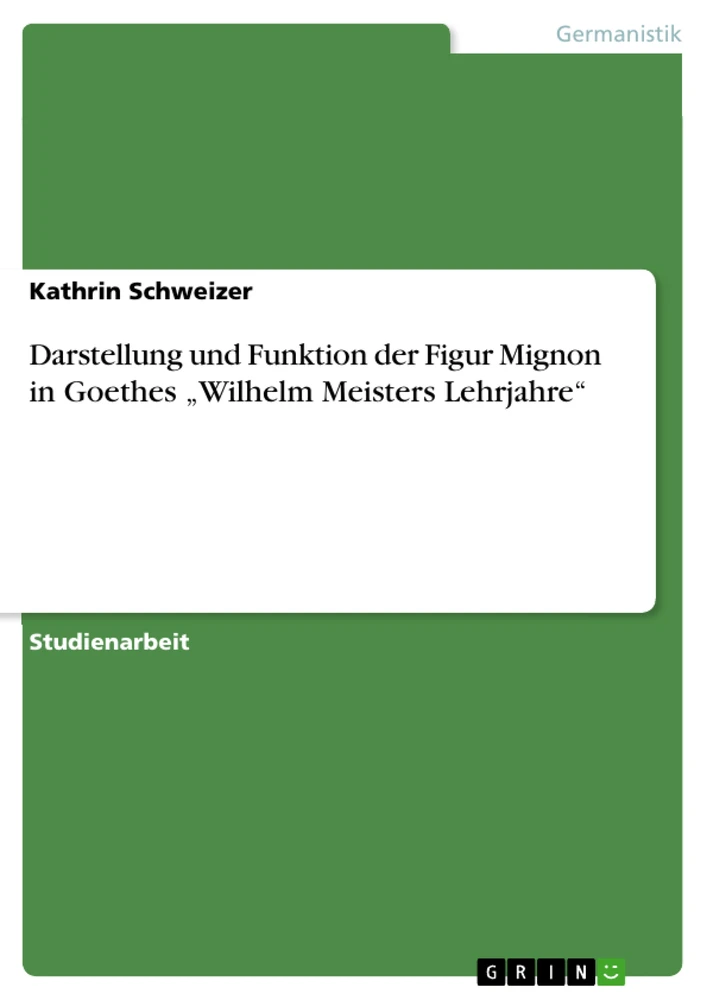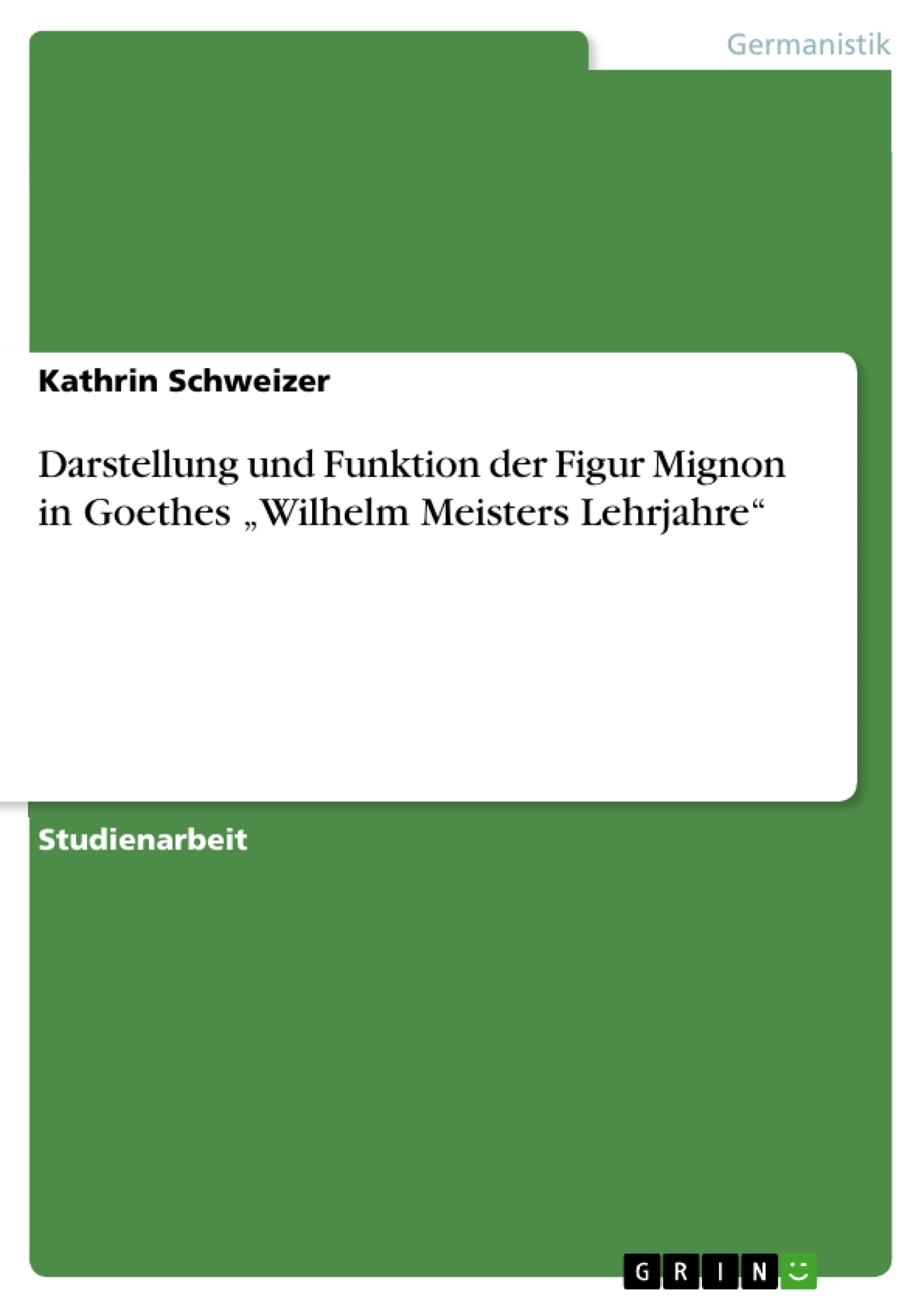Der Bildungsroman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ von Johann Wolfgang Goethe ist ein um 1795/96 entstandenes umfangreiches Werk, das auf dem zuvor verfassten Fragment „Wilhelm Meisters theatralische Sendung“ aufbaut und mit dem Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ 1821/29 fortgesetzt wird.
Der Protagonist Wilhelm Meister ist Kaufmannssohn und soll den Erwartungen seines Vaters entsprechend ebenso als Kaufmann tätig werden. Wilhelm jedoch fühlt sich zur Kunst berufen, nicht zuletzt durch die Liebe zur Schauspielerin Mariane. Als er herausfindet, dass sie untreu zu sein scheint, widmet er sich zunächst dem Kaufmannsberuf. Als er aus geschäftlichen Gründen eine Reise unternimmt, trifft er auf eine Schauspieltruppe, die ihn weiter dazu anregt sich der Kunst, dem Theater zu widmen. Hier lernt er Mignon kennen, ein geheimnisvolles, rätselhaftes Mädchen, die im Laufe des Romans eine wichtige Funktion im Hinblick auf Wilhelms Entwicklung hat und Thema meiner Untersuchung ist.
Die Forschung in Bezug auf den Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ ist relativ umfangreich. Allerdings beschäftigt sich die Forschung größtenteils mit bestimmten zentralen Einzelaspekten des Romans wie der Turmgesellschaft, dem Kunstbegriff, der Figur Wilhelms. Nahezu alle Untersuchungen gehen auch auf autobiografische Elemente und die Einbettung in die Epoche ein.
Die Figur Mignon wird meist in Zusammenhang mit dem Harfner und in Bezug auf Wilhelm untersucht. Wie im Folgenden beschrieben, kommt dieser Figur eine tragende Rolle im Gesamtkonzept des Romans zu. Meiner Arbeit liegen einige allgemeinere Beiträge und detailliertere Untersuchungen über spezielle Textstellen zur Figur Mignon zugrunde.
Ausgehend vom Thema „Mignon als Inbegriff der Genieästhetik“ gehe ich zunächst auf die Kunstfigur ein. Hier beschäftige ich mich mit dem Italienlied, dem wohl zentralsten von insgesamt vier Liedern Mignons. Anschließend gehe ich auf den Eiertanz ein, den sie nur Wilhelm vorführt. Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit der besonderen Beziehung zwischen ihr und dem Protagonisten anhand des Motivs der Spiegelung, der Abkehr vom Theater sowie der Bedeutung von Mignons Tod. Abschließend werde ich resümierende Schlüsse ziehen und einen Ausblick auf mögliche weitere interessante Themengebiete und Teilaspekte in Bezug auf die Figur Mignons geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mignon als Inbegriff der Genie-Ästhetik
- Das Italienlied
- Der Eiertanz
- Mignon und Wilhelm
- Das Motiv der Spiegelung
- Abkehr vom Theater
- Krankheit und Tod
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Funktion der Figur Mignon in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Ziel ist es, Mignons Bedeutung für Wilhelms Entwicklung und die Gesamtkomposition des Romans zu erhellen. Dabei wird insbesondere ihre Rolle als Inbegriff der Genie-Ästhetik beleuchtet.
- Mignons künstlerisches Wirken und ihre Inspiration für Wilhelm
- Die besondere Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm
- Mignons Italienlied als Schlüssel zur Charakterisierung
- Der symbolische Wert von Mignons Tod
- Mignon als Repräsentation autonomer Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext des Romans „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ von Goethe. Sie erläutert die Relevanz der Figur Mignon innerhalb des Gesamtwerkes und skizziert den Forschungsstand. Der Fokus liegt auf der bisherigen Forschungslücke bezüglich einer umfassenden Analyse von Mignons Rolle als künstlerische Figur und ihrer Bedeutung für Wilhelms Entwicklung. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, die sich auf die Analyse des Italienlieds, des Eiertanzes und der Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm konzentriert, um Mignons Funktion innerhalb des Romans zu beleuchten.
Mignon als Inbegriff der Genie-Ästhetik: Dieses Kapitel analysiert Mignon als künstlerische Figur, die durch ihr außergewöhnliches Talent andere, insbesondere Wilhelm, inspiriert. Ihr künstlerisches Können manifestiert sich im Italienlied und dem Eiertanz. Es wird die These vertreten, dass Mignon die „abgespaltene Bestimmung zur Kunst“ Wilhelms verkörpert, und ihre Kunst als Ausdruck einer autonomen schöpferischen Individualität gedeutet. Die Kapitel unterstreichen Mignons einzigartige künstlerische Persönlichkeit und deren Einfluss auf den Roman.
Mignon und Wilhelm: Dieser Abschnitt erörtert die komplexe Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm. Das Motiv der Spiegelung wird analysiert, um die gegenseitige Beeinflussung der beiden Figuren aufzuzeigen. Die Abkehr Wilhelms vom Theater im Zusammenhang mit Mignons Tod wird untersucht, um die Bedeutung dieser Ereignisse für Wilhelms Entwicklung zu verstehen. Die Analyse dieser Beziehung verdeutlicht die tiefgreifende Wirkung, die Mignon auf Wilhelms Lebensweg ausübt und wie Mignons Schicksal Wilhelms Entwicklung beeinflusst.
Schlüsselwörter
Wilhelm Meisters Lehrjahre, Mignon, Genie-Ästhetik, Italienlied, Eiertanz, Wilhelm Meister, Kunst, Theater, Spiegelung, Tod, Autonomie, Schöpfung, Individualität.
Häufig gestellte Fragen zu "Mignon in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur Mignon in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Der Fokus liegt auf Mignons Bedeutung für Wilhelms Entwicklung und die Gesamtkomposition des Romans, insbesondere ihrer Rolle als Inbegriff der Genie-Ästhetik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Mignons künstlerisches Wirken (Italienlied, Eiertanz), ihre besondere Beziehung zu Wilhelm, den symbolischen Wert ihres Todes, und ihre Repräsentation autonomer Kunst. Es wird die These vertreten, dass Mignon die „abgespaltene Bestimmung zur Kunst“ Wilhelms verkörpert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Mignon als Inbegriff der Genie-Ästhetik, ein Kapitel über die Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Die Einleitung beschreibt den Kontext, den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel über Mignon analysiert ihr künstlerisches Wirken. Das Kapitel über Mignon und Wilhelm untersucht ihre komplexe Beziehung und die Bedeutung von Spiegelung und Wilhelms Abkehr vom Theater im Zusammenhang mit Mignons Tod.
Wie wird die Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm analysiert?
Die Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm wird als komplex und vielschichtig dargestellt. Das Motiv der Spiegelung wird herangezogen, um die gegenseitige Beeinflussung aufzuzeigen. Wilhelms Abkehr vom Theater im Kontext von Mignons Tod wird als ein wichtiger Aspekt für Wilhelms Entwicklung analysiert, der die tiefgreifende Wirkung Mignons auf Wilhelms Leben verdeutlicht.
Welche Rolle spielt das Italienlied und der Eiertanz?
Das Italienlied und der Eiertanz werden als Manifestationen von Mignons außergewöhnlichem künstlerischem Talent interpretiert und als Schlüssel zur Charakterisierung Mignons und zum Verständnis ihrer Bedeutung für Wilhelm verwendet. Sie werden als Ausdruck einer autonomen schöpferischen Individualität gedeutet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm Meisters Lehrjahre, Mignon, Genie-Ästhetik, Italienlied, Eiertanz, Wilhelm Meister, Kunst, Theater, Spiegelung, Tod, Autonomie, Schöpfung, Individualität.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt eine Forschungslücke bezüglich einer umfassenden Analyse von Mignons Rolle als künstlerische Figur und ihrer Bedeutung für Wilhelms Entwicklung.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Mignon die „abgespaltene Bestimmung zur Kunst“ Wilhelms verkörpert und ihre Kunst als Ausdruck einer autonomen schöpferischen Individualität zu verstehen ist.
- Quote paper
- Kathrin Schweizer (Author), 2006, Darstellung und Funktion der Figur Mignon in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172177