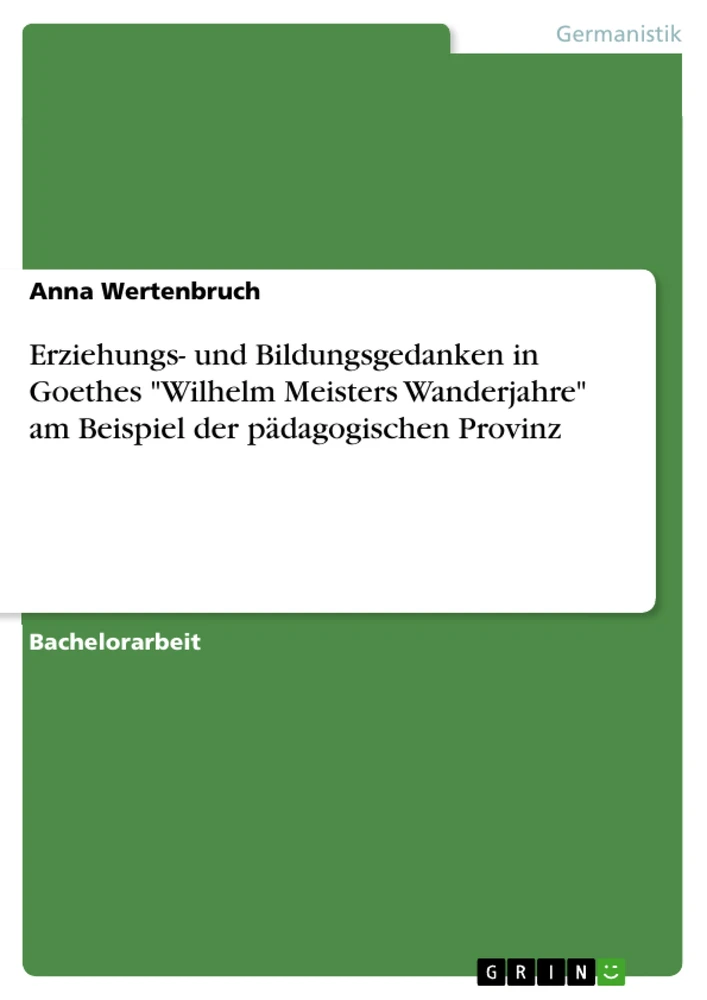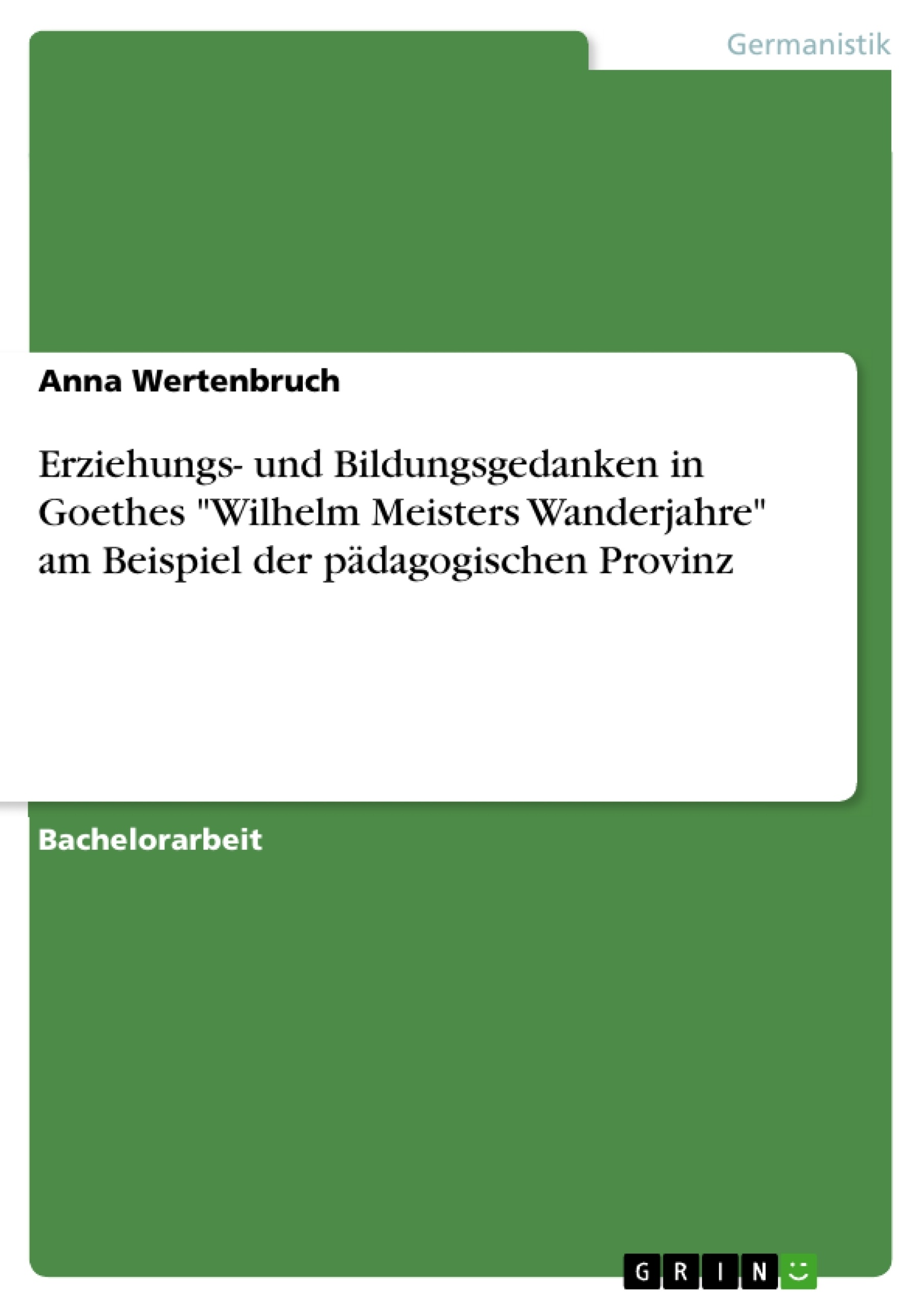„Ich kann mich rühmen, dass keine Zeile drinnen steht, die nicht gefühlt oder gedacht wäre. Der echte Leser wird das alles schon wieder heraus fühlen und denken.“
Mit diesem Zitat kommentiert Goethe seinen Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre rückblickend und weist darauf hin, dass die Wanderjahre einer genauen und detaillier-ten Analyse bedürfen. Durch den gemeinsamen Titelhelden ist das Werk mit seinem Vorgänger, den Lehrjahren, verbunden. Jedoch ist Wilhelm Meister in den
Wanderjahren nicht mehr der Mittelpunkt der Handlung und macht sich – nachdem er in den Lehrjahren Vater geworden ist – über die Bildung seines Sohnes Felix Gedan-ken. Schon zu Ende der Lehrjahre hatte die klassische Idee der universellen Ausbildung des begabten Individuums durch Jarno, dem späteren Montan, einem neuen Ideal, das der Gesellschaft dient, Platz gemacht. Die individuelle Bildung sollte nur noch als Vor-stufe gelten, bevor sich der Einzelne spezialisiert. Wie diese Beschränkung genau statt-finden sollte, erklärt Jarno jedoch in den Lehrjahren nicht. Die Wanderjahre knüpfen an das Geschehen der Lehrjahre an und konkretisieren die bereits vorgezeichnete Entwick-lung Wilhelms. Um die Ausgangsbasis der pädagogischen Diskussion zu verdeutlichen, beginnt der Roman mit der Kritik des früheren universellen Bildungsmodells. Bereits zu Beginn werden durch das Frage-Antwort-Spiel von Felix und Wilhelm die Grenzen der Universalbildung thematisiert und Montan spricht sich für die Spezialisierung aus.
Wilhelm wird im Verlauf der Handlung zu einem Erziehungsinstitut, der pädagogischen Provinz, geführt, in der er schließlich seinen Sohn erziehen lässt.
Wie sich herausstellen wird, diskutiert der Roman die Rolle und Aufgabe von Erziehung bzw. Bildung im Prozess einer gesellschaftlichen Modernisierung. Daher ist es für das Verständnis des Werkes wichtig, die Entstehungsgeschichte aus historischer Perspektive zu betrachten. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf mögliche pädagogische Anregungen und Quellen Goethes, bevor die Darstellung und das Erziehungskonzept der pädagogischen Provinz analysiert werden. Abschließend wird die Ernsthaftigkeit der Erziehungsstätte geprüft, indem die Ironisierung und der utopische Gehalt der Romananstalt untersucht werden, so dass im Folgenden die in der pädagogischen Provinz enthaltenen Erziehungs- und Bildungsgedanken herausgestellt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Pädagogik im Epochenumbruch 18./19. Jahrhundert
- Die pädagogische Provinz in Wilhelm Meisters Wanderjahre
- Entstehungsgeschichte
- Das äußere Bild
- Das Erziehungskonzept
- Das erzieherische Verständnis
- Ehrfurcht und Religion als zu vermittelnde Motive
- Die Ironisierung des Erziehungskonzepts
- Die pädagogische Provinz als eine „Art von Utopien“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ im Hinblick auf die darin präsentierten Erziehungs- und Bildungsgedanken. Der Fokus liegt dabei auf der sogenannten „pädagogischen Provinz“, einem fiktiven Erziehungsinstitut, das im Roman eine zentrale Rolle spielt.
- Die pädagogische Provinz als Spiegelbild des Epochenumbruchs 18./19. Jahrhundert
- Das Erziehungskonzept der pädagogischen Provinz: Ideale und Kritik
- Die Rolle von Ehrfurcht und Religion in der Erziehung
- Die Ironisierung des Erziehungskonzepts in Goethes Werk
- Die pädagogische Provinz als Utopie: Ideale und Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet den Zusammenhang zwischen „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Wilhelm Meisters Wanderjahre“. Das erste Kapitel beleuchtet die pädagogischen Debatten des 18./19. Jahrhunderts und die sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Debatten prägten.
Im zweiten Kapitel wird die „pädagogische Provinz“ in Wilhelm Meisters Wanderjahre vorgestellt. Die Entstehung und das äußere Erscheinungsbild dieser fiktiven Erziehungsstätte werden analysiert.
Im dritten Kapitel wird das Erziehungskonzept der „pädagogischen Provinz“ genauer betrachtet, wobei insbesondere das erzieherische Verständnis, die Rolle von Ehrfurcht und Religion sowie die Ironisierung des Konzepts im Fokus stehen.
Das vierte Kapitel untersucht die „pädagogische Provinz“ als „Art von Utopie“ und hinterfragt die Ernsthaftigkeit der Erziehungsstätte in Hinblick auf ihre utopischen Elemente.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie die pädagogische Provinz, Erziehungs- und Bildungsgedanken, Epochenumbruch 18./19. Jahrhundert, Gesellschaftliche Modernisierung, Ehrfurcht und Religion, Ironisierung, Utopie und „Wilhelm Meisters Wanderjahre“.
- Quote paper
- Anna Wertenbruch (Author), 2011, Erziehungs- und Bildungsgedanken in Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre" am Beispiel der pädagogischen Provinz , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172135