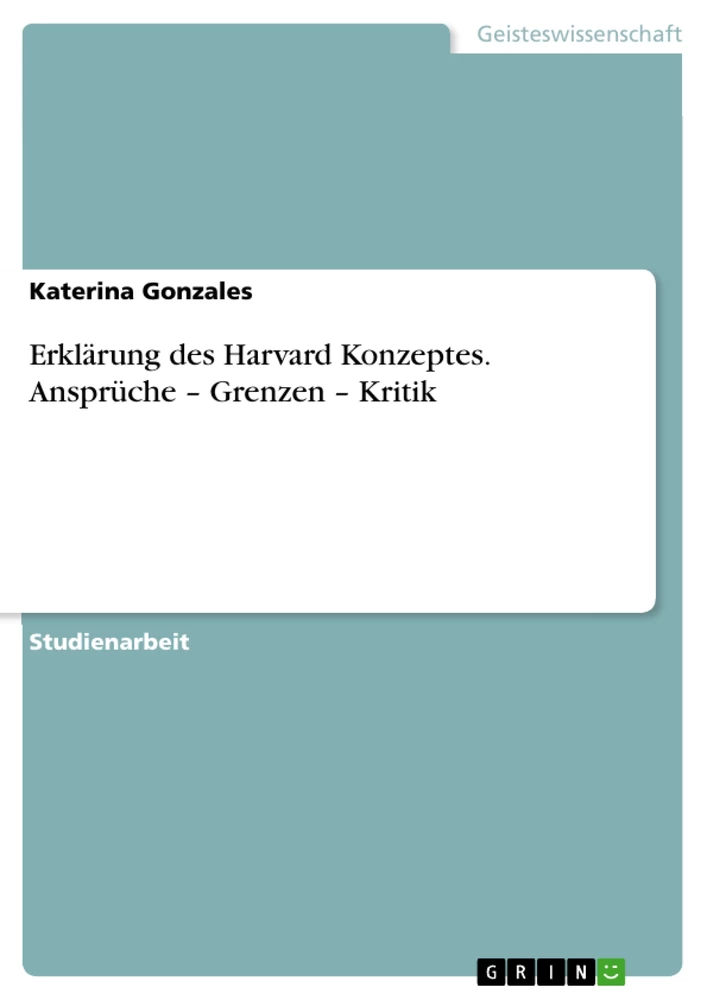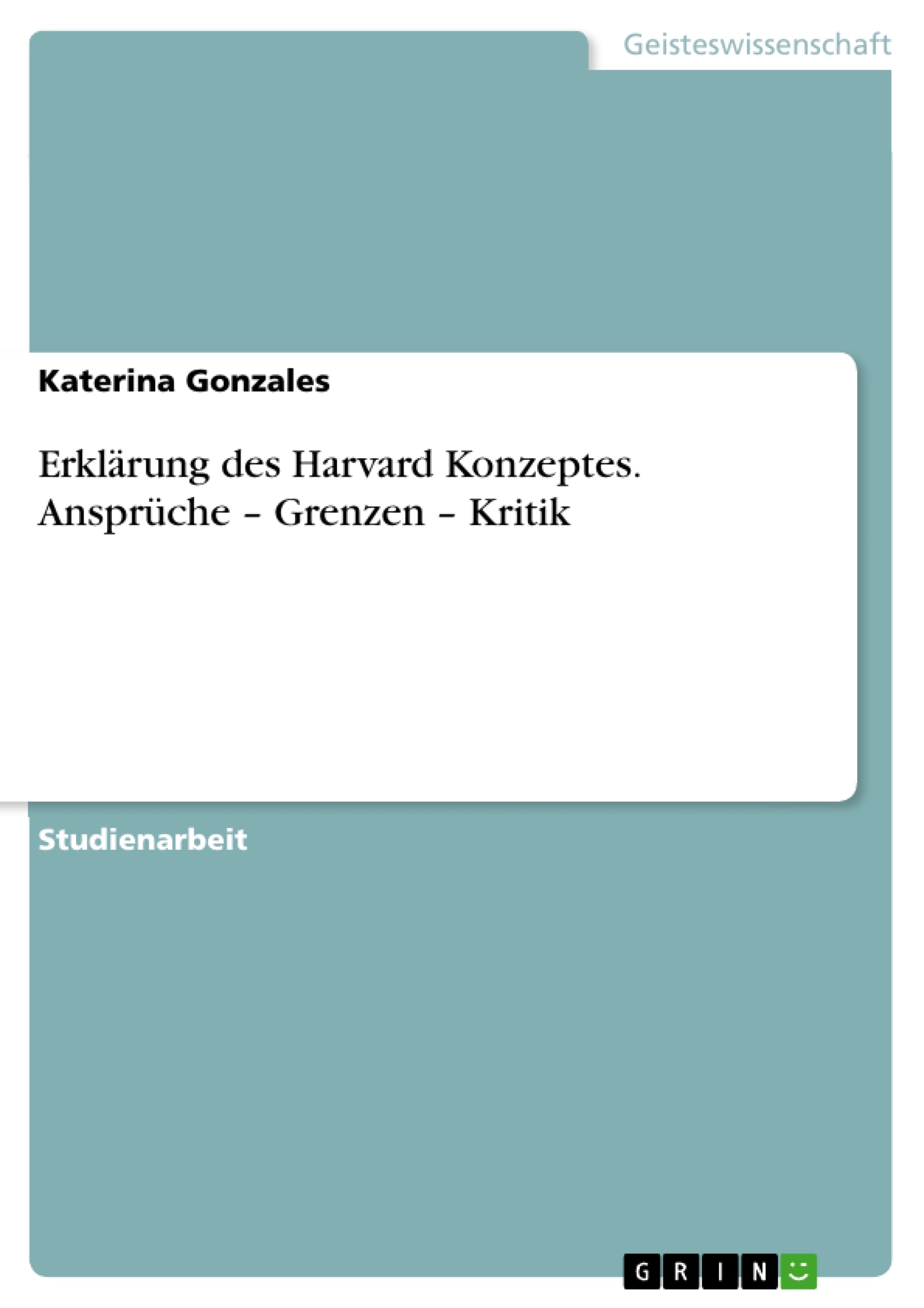Verhandeln gehört zu den wohl grundlegendsten und wichtigsten Formen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Im Grunde kann jede Transaktion, bei der ein Verhandlungspartner etwas von dem Anderen möchte, als Verhandlung bezeichnen. Bereits im Kindesalter wird beispielsweise um Spielzeug verhandelt. Neben den vielen Verhandlungen, die im Privatleben geführt werden, ist auch unser Berufsleben von Verhandlungen geprägt.
Kommt es in der Verhandlung zu keiner Einigung, verlieren beide. Der zu verhandelnde Wert bleibt auf dem Tisch liegen. Führt die Verhandlung zum Erfolg, und sind die Parteien mit der Einigung zufrieden, war sie erfolgreich.
Das Harvard - Konzept ist ein praxisorientierter Leitfaden. der eine Strategie intelligenten Verhandelns beschreibt. Dieses intelligente Verhandeln soll dazu führen, dass in Verhandlungen möglichst gute Ergebnisse erzielt und die Interessen aller beteiligten Verhandlungsparteien gewürdigt werden.
Diese Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel das Harvard - Konzept und seine Ansprüche vorgestellt. Dabei werden die Methoden des harten und des weichen Verhandelns und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Als dritte Strategie wird das intelligente Verhandeln gemäß dem Harvard - Konzept und die Voraussetzungen, die dafür geschaffen werden müssen, beschrieben. Dabei werden die Ansprüche, die das Harvard - Konzept an sich selbst stellt, vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden die Kritik und die Grenzen des Harvard - Konzept dargestellt. Zum Einen wird die Konzentration auf die integrative bzw. weiche Strategie kritisch gewürdigt und die Nachteile, die daraus in Verhandlungen entstehen können, beschrieben. Zum Anderen wird diskutiert, ob es überhaupt möglich ist, den Erfolg von Verhandlungsstrategien nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu messen und zu bewerten. Das Kapitel endet mit einer eigenen Einschätzung, welche Aspekte des Harvard – Konzeptes in Europa kritisch gesehen werden könnten
Im dritten Kapitel wird nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ein Fazit gezogen, in dem die Hauptfragestellung, bezogen auf die Ansprüche, die Grenzen und die Kritik am Harvard Konzept, noch einmal aufgegriffen und gewürdigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Harvard-Konzept und seine Ansprüche
- Das harte Verhandeln
- Das weiche Verhandeln
- Das intelligente Verhandeln
- Grenzen und Kritik
- Kritik an der integrativen Strategie
- Messen und Bewerten von Verhandlungsstrategien
- Kritik am Harvard-Konzept in Europa
- Schluß/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Harvard-Konzept, einem Leitfaden für intelligentes Verhandeln. Die Arbeit untersucht die Ansprüche des Konzepts, seine Grenzen und Kritikpunkte, die es aufwirft.
- Die Methoden des harten und weichen Verhandelns
- Das Prinzip des intelligenten Verhandelns nach dem Harvard-Konzept
- Kritik an der Konzentration auf die integrative Strategie
- Die Schwierigkeit, den Erfolg von Verhandlungsstrategien wissenschaftlich zu bewerten
- Spezifische Herausforderungen des Harvard-Konzepts in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext von Verhandlungen als grundlegende Form der Kommunikation dar und führt in die Thematik des Harvard-Konzepts ein. Das zweite Kapitel präsentiert das Harvard-Konzept und seine Ansprüche, analysiert die Methoden des harten und weichen Verhandelns und beschreibt die Voraussetzungen für intelligentes Verhandeln. Im dritten Kapitel werden Kritikpunkte und Grenzen des Konzepts diskutiert, darunter die Nachteile der integrativen Strategie und die Herausforderungen bei der wissenschaftlichen Bewertung von Verhandlungsstrategien. Außerdem wird beleuchtet, welche Aspekte des Harvard-Konzepts in Europa besonders kritisch gesehen werden.
Schlüsselwörter
Harvard-Konzept, Verhandeln, Verhandlungen, harte Strategie, weiche Strategie, intelligentes Verhandeln, Integrative Strategie, Kritik, Grenzen, Europa, wissenschaftliche Bewertung.
- Quote paper
- Katerina Gonzales (Author), 2010, Erklärung des Harvard Konzeptes. Ansprüche – Grenzen – Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172000