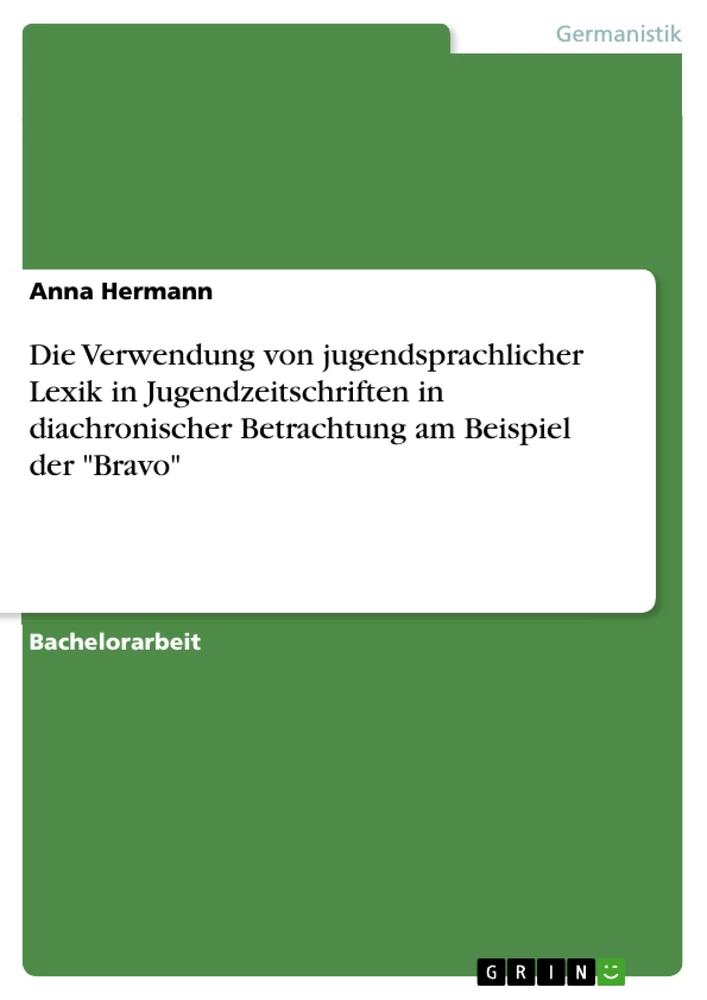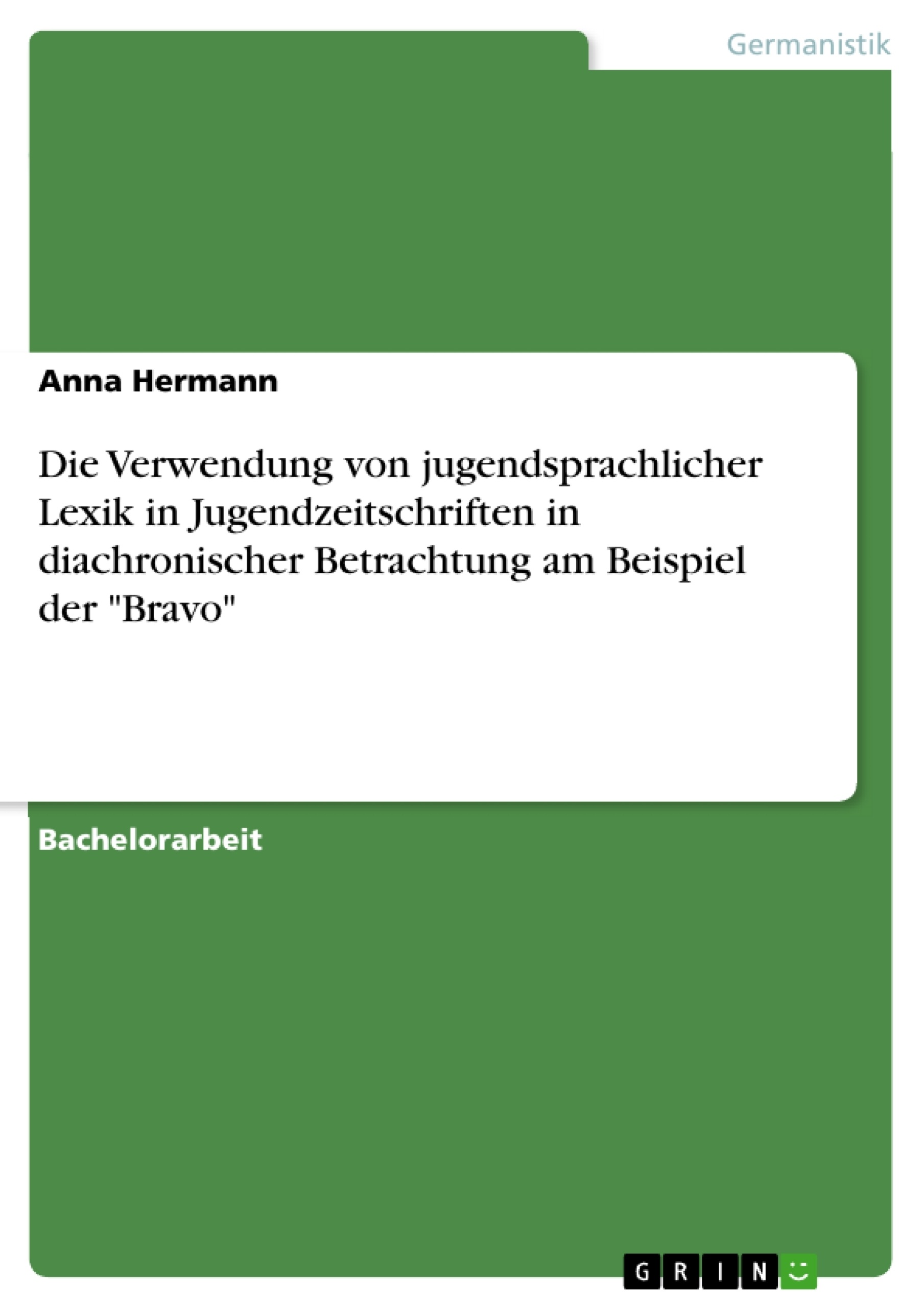Jugendzeitschriften erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Heranwachsenden. Sie lesen diese Zeitschriften, um genauere Einblicke in den Freizeitbereich zu erhalten, der für sie von Interesse ist, und sich mit Freunden darüber austauschen zu können.
Doch wie schaffen es die Herausgeber der Jugendzeitschriften, über einen längeren Zeitraum hinweg die unterschiedlichsten Jugendlichen anzusprechen? Und welche Rolle spielt dabei die sprachliche Gestaltung? Diese Bachelor-Arbeit soll klären, auf welche Weise die sogenannte Jugendsprache in der bekanntesten und auflagenstärksten deutschen Jugendzeitschrift, der Bravo, verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die sprachliche Gestaltung der Jugendzeitschriften einen erheblichen Anteil an einer guten Zielgruppenorientierung besitzt. Daher erfolgt zunächst eine Klärung der Begriffe Jugendsprache und Jugendzeitschrift, um dann eine stichprobenartige Analyse von Artikeln aus verschiedenen Bravo-Ausgaben durchzuführen. Dabei soll der Fokus nicht nur auf der derzeitigen quantitativen und qualitativen Verwendung von Jugendsprache in der Bravo liegen – d.h. wie viel Jugendsprache im Vergleich zur Nicht-Jugendsprache verwendet wird und welche jugendsprachlichen Phänomene genau verarbeitet werden –, sondern die Analyse erfährt eine Erweiterung, indem auch die Veränderung dieser Verwendung berücksichtigt wird. Dabei ist zum einen von Interesse, auf welche Weise sich die in Jugendzeitschriften aufgenommene Jugendsprache entwickelt hat, zum anderen soll aber auch geklärt werden, ob sich im Laufe der Zeit der Gebrauch von Jugendsprache in Jugendzeitschriften verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Jugendsprache
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.1 Jugend
- 2.1.2 Sprache und Standardsprache
- 2.1.3 Jugendsprache
- 2.2 Funktionen
- 2.3 Sprachliche Besonderheiten
- 2.4 Die historische Entwicklung der jugendsprachlichen Lexik
- 2.4.1 60er Jahre
- 2.4.2 80er Jahre
- 2.4.3 Aktuelle Entwicklungen
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 3. Jugendzeitschriften
- 3.1 Zielgruppe
- 3.2 Merkmale von Jugendzeitschriften
- 3.3 Die Jugendzeitschrift „Bravo“
- 3.3.1 Entwicklung
- 3.3.2 Thematische Schwerpunkte
- 3.3.3 Journalistische Umsetzung
- 4. Empirische Untersuchung der lexikalischen Veränderungen der Jugendsprache
- 4.1 Auswahl und Begründung der Untersuchungsgegenstände
- 4.2 Leitfragen und methodisches Vorgehen
- 4.3 Ergebnisse der Untersuchung
- 4.3.1 Textkorpus 1960
- 4.3.2 Textkorpus 1985
- 4.3.3 Textkorpus 2010
- 4.4 Vergleich und Erläuterung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bakkalaureusarbeit untersucht die Verwendung jugendsprachlicher Lexik in der Zeitschrift Bravo in diachronischer Perspektive. Ziel ist es, die Entwicklung des Sprachgebrauchs in der Bravo über die Zeit zu analysieren und die Rolle der Jugendsprache für die Zielgruppenansprache zu beleuchten.
- Entwicklung der Jugendsprache im Laufe der Zeit
- Verwendung von Jugendsprache in Jugendzeitschriften
- Quantitative und qualitative Analyse jugendsprachlicher Elemente in der Bravo
- Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und Zielgruppenorientierung
- Der Einfluss der Bravo auf den Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Motivation der Arbeit. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Verwendung von Jugendsprache in der Bravo und deren diachronischer Entwicklung. Die Arbeit nimmt an, dass die sprachliche Gestaltung der Zeitschrift einen bedeutenden Einfluss auf die Zielgruppenorientierung hat. Es werden die Begriffe Jugendsprache und Jugendzeitschrift geklärt und das methodische Vorgehen – die stichprobenartige Analyse von Bravo-Artikeln aus verschiedenen Jahrgängen – skizziert. Der Fokus liegt auf der quantitativen und qualitativen Verwendung von Jugendsprache, sowie deren Veränderung im Laufe der Zeit.
2. Die Jugendsprache: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Konzept der Jugendsprache. Es beginnt mit einer Begriffsbestimmung von Jugend, Sprache und Standardsprache, bevor der zentrale Begriff der Jugendsprache umfassend erläutert wird. Die verschiedenen Funktionen der Jugendsprache (Zugehörigkeit, Abgrenzung, Identitätsfindung) werden detailliert diskutiert, ebenso die sprachlichen Besonderheiten auf morphologischer, lexikalischer, phonetischer, graphischer, syntaktischer, pragmatischer und stilistischer Ebene. Der Fokus liegt auf der Heterogenität der Jugendsprache und deren ständigem Wandel. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der lexikalischen Ebene, und der historische Entwicklung der Jugendsprache im 20. Jahrhundert (60er, 80er Jahre und Gegenwart) wird analysiert und in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet.
3. Jugendzeitschriften: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen Jugendzeitschriften. Es werden der Begriff "Zeitschrift" definiert und die Zielgruppe der Jugendzeitschriften, sowie deren Charakteristika (Sprache, Layout, Themenauswahl) beschrieben. Es wird zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Jugendzeitschriften unterschieden, mit einem Fokus auf kommerzielle Zeitschriften. Das Kapitel beleuchtet den Einfluss der Medien auf die Jugendlichen und die wechselseitige Beziehung zwischen Jugend und Medien. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Jugendzeitschriften im Prozess der Identitätsbildung bei Jugendlichen.
3.3 Die Jugendzeitschrift „Bravo“: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Bravo als wichtigste deutsche Jugendzeitschrift. Die Entwicklung der Bravo seit ihrer Gründung 1956 wird nachgezeichnet, ihre thematischen Schwerpunkte (Prominente, Beratung, vor allem in Bezug auf Sexualität) werden analysiert und die journalistische Umsetzung dieser Themen (Sprache, Layout, Bilder) kritisch beleuchtet. Der Erfolg der Bravo wird im Zusammenhang mit ihrem Image als „guter Freund“ der Jugendlichen und ihrer Fähigkeit, eine eigene Bravo-Welt zu schaffen, erklärt.
4. Empirische Untersuchung der lexikalischen Veränderungen der Jugendsprache: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Arbeit. Es werden die Auswahl und Begründung der Untersuchungsgegenstände (drei Bravo-Ausgaben aus den Jahren 1960, 1985 und 2010) erläutert, sowie die Leitfragen und das methodische Vorgehen der Analyse. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse der verwendeten jugendsprachlichen Lexik werden präsentiert und diskutiert. Die Einordnung der gefundenen jugendsprachlichen Lexeme in die Kategorien Neubildung, Neubedeutung und Entlehnung wird vorgenommen. Die Methode der Analyse, die auf Jugendsprachewörterbüchern basiert, wird kritisch reflektiert.
Häufig gestellte Fragen zur Bakkalaureusarbeit: Entwicklung der Jugendsprache in der Bravo
Was ist das Thema der Bakkalaureusarbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung jugendsprachlicher Lexik in der Zeitschrift Bravo in diachronischer Perspektive. Das Hauptziel ist die Analyse der Entwicklung des Sprachgebrauchs in der Bravo im Laufe der Zeit und die Rolle der Jugendsprache für die Zielgruppenansprache.
Welche Aspekte der Jugendsprache werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung von Jugendsprache, ihre Funktionen (Zugehörigkeit, Abgrenzung etc.), sprachliche Besonderheiten (morphologisch, lexikalisch, phonetisch etc.) und die historische Entwicklung im 20. Jahrhundert (60er, 80er Jahre und Gegenwart). Besonderer Fokus liegt auf der lexikalischen Ebene und dem Wandel der Jugendsprache.
Welche Rolle spielen Jugendzeitschriften in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet das Phänomen Jugendzeitschriften, ihre Zielgruppen, Merkmale (Sprache, Layout, Themen) und den Einfluss auf Jugendliche. Es wird zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Zeitschriften unterschieden, mit einem Schwerpunkt auf kommerziellen Zeitschriften und deren Rolle in der Identitätsbildung.
Welche Bedeutung hat die Zeitschrift „Bravo“ in der Arbeit?
Die „Bravo“ steht im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Zeitschrift seit ihrer Gründung, ihre thematischen Schwerpunkte (Prominente, Beratung, Sexualität), die journalistische Umsetzung (Sprache, Layout, Bilder) und ihren Erfolg im Kontext ihrer Beziehung zu den Jugendlichen.
Wie sieht die empirische Untersuchung aus?
Die empirische Untersuchung analysiert drei Bravo-Ausgaben aus den Jahren 1960, 1985 und 2010. Es werden quantitative und qualitative Methoden angewendet, um die verwendete jugendsprachliche Lexik zu analysieren. Die Ergebnisse werden in Bezug auf Neubildungen, Neubedeutungen und Entlehnungen eingeordnet und diskutiert. Die Methode der Analyse wird kritisch reflektiert.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Jugendsprache im Laufe der Zeit, die Verwendung von Jugendsprache in Jugendzeitschriften, den Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und Zielgruppenorientierung, und den Einfluss der Bravo auf den Sprachwandel. Die zentrale Forschungsfrage ist, wie sich die Verwendung von Jugendsprache in der Bravo über die Zeit verändert hat und welche Rolle dies für die Zielgruppenansprache spielt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Jugendsprache, 3. Jugendzeitschriften (inkl. Unterkapitel 3.3: Die Jugendzeitschrift „Bravo“), und 4. Empirische Untersuchung der lexikalischen Veränderungen der Jugendsprache.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert qualitative und quantitative Methoden. Die qualitative Analyse beinhaltet die Beschreibung und Interpretation der jugendsprachlichen Elemente in den Bravo-Ausgaben. Die quantitative Analyse umfasst die Zählung und Kategorisierung dieser Elemente. Die Analyse basiert auf Jugendsprachewörterbüchern, deren Methode kritisch reflektiert wird.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Entwicklung der Jugendsprache in der Bravo und deren Einfluss auf die Zielgruppenansprache. Die Ergebnisse zeigen Veränderungen im Sprachgebrauch im Laufe der Zeit auf und beleuchten den Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und der Strategie der Zeitschrift, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Die konkreten Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Analyse der drei Bravo-Ausgaben.
- Quote paper
- Anna Hermann (Author), 2010, Die Verwendung von jugendsprachlicher Lexik in Jugendzeitschriften in diachronischer Betrachtung am Beispiel der "Bravo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171792