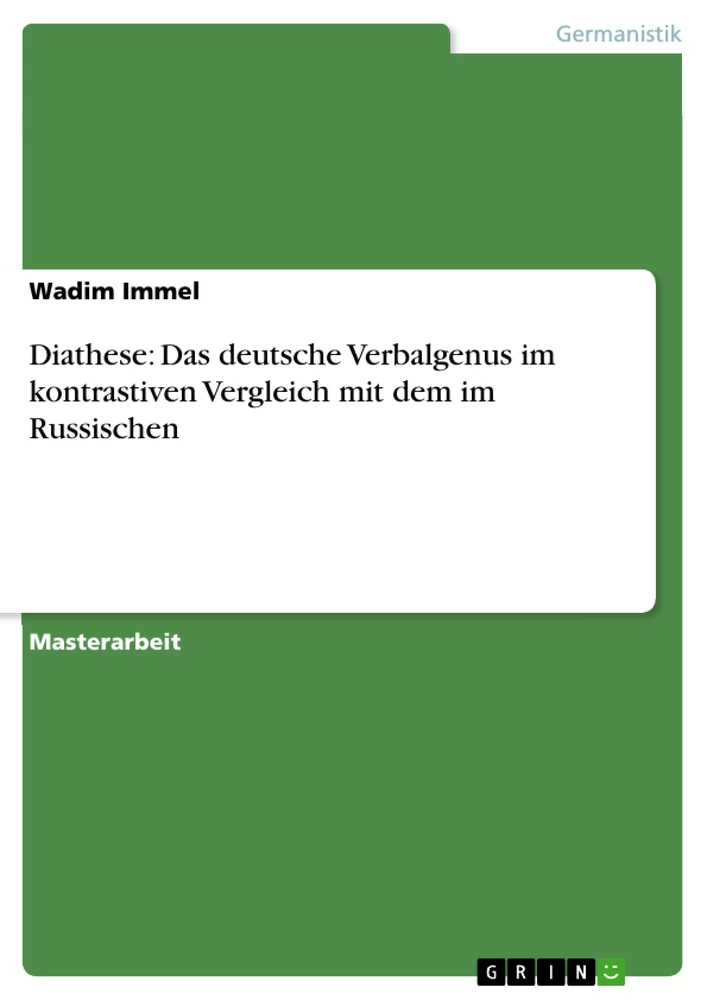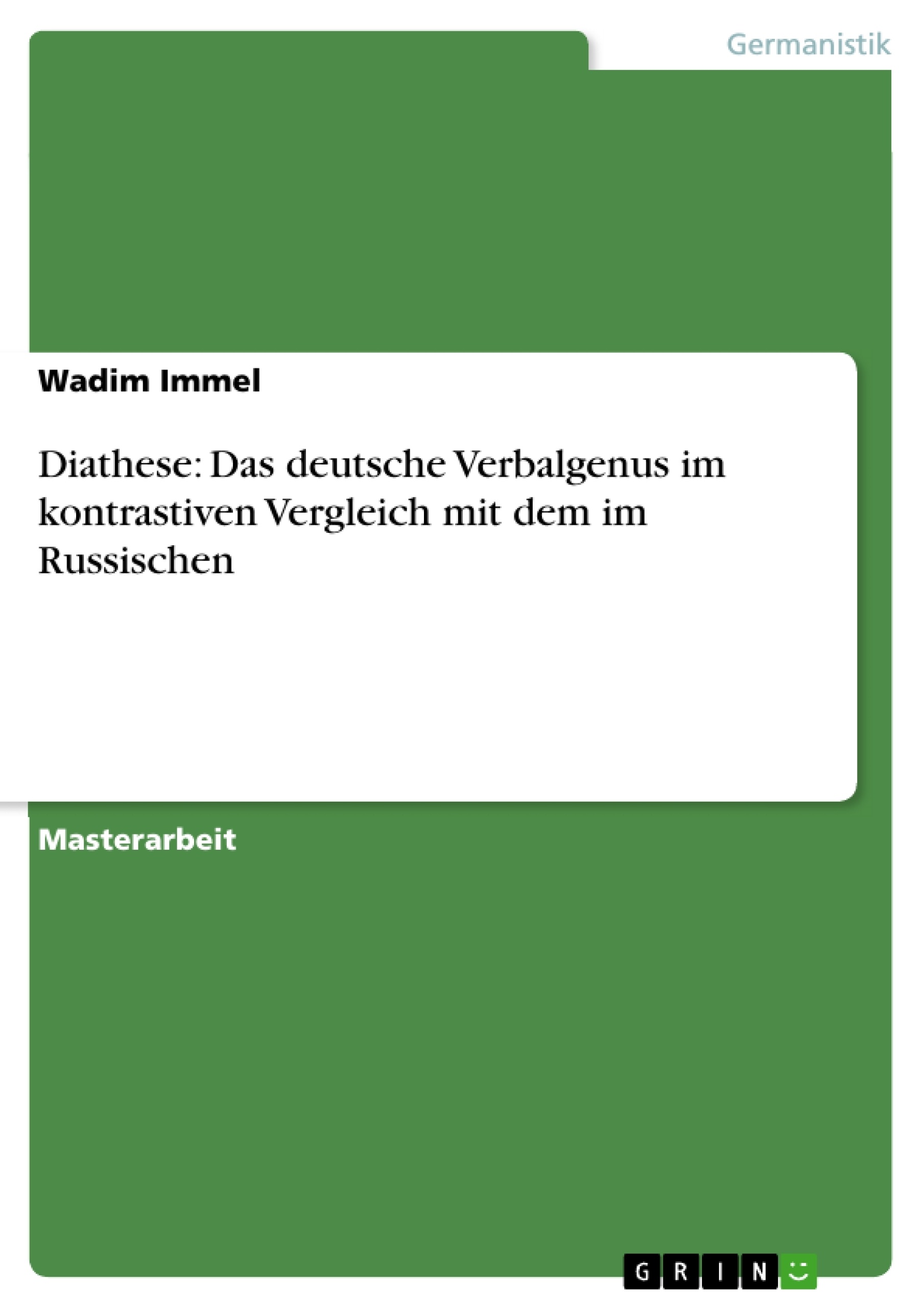Die vorliegende Arbeit behandelt das Problem der realen und potentiellen Umsetzungen der Diathesenmöglichkeiten in deutscher und russischer Sprachen. Die Arbeit ist praxisorientiert, die Forschungsgrundlage bildet die kontrastive Analyse zweier modernen Texte (eines deutschen und eines russichen mit den jeweiligen Übersetzungen). Verglichen werden die Originaltexte mit ihren Übersetzungen sowie die Ergebnisse dieser Analyse.
Der theoretische Teil dieser Arbeit sowie die Analyseergebnisse enthalten viele Daten, die bei der Auseinandersetzung mit diesem oder änlichen Themen nützlich sein können.
Beide Gutachter haben die Arbeit mit 1,0 bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das deutsche Passiv
- Der aktuelle Stand der Passivforschung
- Die Qual der Wahl: Definition(en) des Passivs und Kriterien für die Auswahl der brauchbaren Passivtheorien
- Das Verbalgenus im Deutschen
- Definition
- Funktionen des Passivs
- Typen von Passiv nach Ágel (1996a)
- Die methodologische Grundlage für die Typologie
- Die Passivtypen
- Zusätzliche Passivtypen
- Die Einzelbetrachtung der Passivtypen und das Problem der Passivierbarkeit
- Passivbildung und Passivierbarkeit
- Unpersönliches (subjektloses) Passiv
- Reflexivpassiv
- Das persönliche (subjekthaltige) Passiv
- Das Akkusativpassiv
- Bildungsmuster und Einschränkungen
- Die Agensphrase
- Die passiv-alternativen Konstruktionen (Passiv-Paraphrasen)
- Zustandspassiv (sein-Passiv)
- Restriktionen
- Die Abgrenzung von formal gleichen Konstruktionen
- Rezipientenpassiv (Dativpassiv)
- Das vorgangsbezogene bekommen-Passiv (b-Passiv)
- Das zustandsbezogene haben-Passiv
- Das Akkusativpassiv
- Verbalgenera im Russischen
- Reflexive Verben
- Das russische Passiv: Die Formenbildung
- Die Passivierung: Voraussetzungen und Restriktionen
- Das synthetische Passiv mit reflexiven Verben
- Das analytische Passiv aus быть und passivischen Partizipien
- Der Vergleich und die Verwendung von deutschen und russischen Passiva
- Die Textanalyse
- Kriterien für die Auswahl der Texte
- Deutsch-Russisch
- Russisch-Deutsch
- Die Frage der Vergleichbarkeit beider Texte
- Die Vorgehensweise
- Methodologische Einschränkungen
- Die Auswertung von Analyseergebnissen
- Agentivität und Transitivität
- Menschliches vs. nicht menschliches Agens im unpersönlichen Passiv
- Der Kontext
- Der ,passiv-fördernde' Kontext: Theorie
- Der restriktive Kontext: Was kann die Passivierung verhindern?
- Ereignisperspektivierung: Die Perspektive als Restriktion
- Deutscher Text
- Das ,reale' Passiv im deutschen Original
- Das ,potentielle Passiv' im Roman Das Parfüm
- Passivfähig im deutschen Originaltext
- Passivfähig in der russischen Übersetzung
- Passivunfähig im deutschen Originaltext
- Passivunfähig in der russischen Übersetzung
- Der russische Text
- Das ,reale' Passiv im Eisbrecher
- Passivfähig im russischen Originaltext
- Passivfähig in der deutschen Übersetzung
- Passivunfähig im russischen Originaltext (Ледокол)
- Passivunfähig in der deutschen Übersetzung von Dem Eisbrecher
- Die Gesamtauswertung der Analyseergebnisse
- Die Übersetzung des ,realen Passivs' im Originaltext in die jeweils andere Sprache
- Das ,potentielle' Passiv im Deutschen und im Russischen
- Die passivfähigen Aktivsätze
- Die passivunfähigen Aktivsätze
- Fazit
- Kriterien für die Auswahl der Texte
- Zusammenfassung
- Resümee I (zum Anliegen der Arbeit)
- Resümee II: Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das deutsche und russische Passiv im kontrastiven Vergleich. Ziel ist es, die Unterschiede in der Häufigkeit und Verwendung des Passivs in beiden Sprachen zu analysieren und die Hypothese zu überprüfen, dass das deutsche Passiv aufgrund seiner größeren Variabilität häufiger verwendet wird als das russische Passiv. Die Analyse basiert auf einer vergleichenden Untersuchung von deutsch-russischen und russisch-deutschen Übersetzungen.
- Kontrastive Analyse des deutschen und russischen Passivs
- Vergleich der Häufigkeit und Verwendung des Passivs in beiden Sprachen
- Untersuchung der Faktoren, die die Passivierung beeinflussen (z.B. Agentivität, Transitivität, Kontext)
- Analyse der Übersetzung des Passivs zwischen Deutsch und Russisch
- Bewertung der Variabilität des Verbalgenus in beiden Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der kontrastiven Analyse des deutschen und russischen Passivs ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der unterschiedlichen Häufigkeit und Verwendung des Passivs in beiden Sprachen und formuliert die zentrale Hypothese der Arbeit. Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprache für kognitive Prozesse und Kommunikation und führt die Annahme ein, dass die unterschiedliche Verwendung des Passivs auf die Variabilität des Verbalgenus zurückzuführen ist.
Das deutsche Passiv: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Passiv. Es behandelt verschiedene Definitionen und Theorien zum Passiv, klassifiziert Passivtypen nach Ágel (1996a), und analysiert detailliert verschiedene Arten des deutschen Passivs (z.B. Akkusativpassiv, Zustandspassiv, Rezipientenpassiv), einschließlich ihrer Bildung, Restriktionen und Verwendung. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Passivbildung und den damit verbundenen grammatischen Regeln und Einschränkungen.
Verbalgenera im Russischen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Verbalgenera im Russischen, insbesondere dem russischen Passiv. Es beschreibt die Formenbildung des russischen Passivs (synthetisches und analytisches Passiv) und analysiert die Voraussetzungen und Restriktionen für die Passivierung im Russischen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der russischen und deutschen Passivkonstruktionen und ihrer jeweiligen Verwendung in unterschiedlichen Kontexten.
Die Textanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Textanalyse. Es erläutert die Kriterien für die Textauswahl (deutschsprachige Texte und ihre russischen Übersetzungen, und umgekehrt), die Vorgehensweise bei der Analyse und die methodologischen Einschränkungen. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Beschreibung der Auswertungsmethode, die die Analyse von Agentivität, Transitivität und Kontext beinhaltet. Das Kapitel bereitet den Leser auf die Ergebnisse der Analyse vor und erklärt die unterschiedliche Behandlung von „realem“ und „potentiellem“ Passiv.
Schlüsselwörter
Deutsches Passiv, Russisches Passiv, Kontrastive Linguistik, Verbalgenus, Diathese, Passivbildung, Passivierbarkeit, Agentivität, Transitivität, Kontext, Textanalyse, Übersetzung, Aktiv-Passiv-Alternation, Variabilität des Verbalgenus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kontrastive Analyse des deutschen und russischen Passivs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das deutsche und russische Passiv im kontrastiven Vergleich. Das Hauptziel ist die Analyse der Unterschiede in Häufigkeit und Verwendung des Passivs in beiden Sprachen und die Überprüfung der Hypothese, dass das deutsche Passiv aufgrund größerer Variabilität häufiger vorkommt als das russische.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse basiert auf einem Vergleich deutsch-russischer und russisch-deutscher Übersetzungen. Es werden Kriterien zur Textauswahl, die Vorgehensweise der Analyse und die methodischen Grenzen detailliert beschrieben. Die Auswertung umfasst die Analyse von Agentivität, Transitivität und Kontext, wobei zwischen „realem“ und „potentiellem“ Passiv unterschieden wird.
Welche Aspekte des deutschen Passivs werden behandelt?
Das Kapitel zum deutschen Passiv bietet einen umfassenden Überblick, inklusive verschiedener Definitionen und Theorien, Klassifizierung der Passivtypen nach Ágel (1996a) und detaillierter Analysen verschiedener Passivarten (Akkusativpassiv, Zustandspassiv, Rezipientenpassiv). Bildung, Restriktionen und Verwendung dieser Passivtypen werden eingehend beleuchtet.
Welche Aspekte des russischen Passivs werden behandelt?
Das Kapitel zum russischen Passiv behandelt die Formenbildung (synthetisches und analytisches Passiv), Voraussetzungen und Restriktionen der Passivierung. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich mit deutschen Passivkonstruktionen und deren Verwendung in unterschiedlichen Kontexten. Reflexive Verben werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie werden die Texte ausgewählt und analysiert?
Die Textauswahl basiert auf deutschsprachigen Texten und ihren russischen Übersetzungen, sowie umgekehrt. Die Analyse untersucht die Agentivität und Transitivität, den Kontext (passiv-fördernd vs. restriktiv) und die Ereignisperspektivierung. Die Auswertung der Ergebnisse umfasst die Übersetzung des „realen“ und „potentiellen“ Passivs zwischen beiden Sprachen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsches Passiv, Russisches Passiv, Kontrastive Linguistik, Verbalgenus, Diathese, Passivbildung, Passivierbarkeit, Agentivität, Transitivität, Kontext, Textanalyse, Übersetzung, Aktiv-Passiv-Alternation, Variabilität des Verbalgenus.
Welche Hypothese wird geprüft?
Die zentrale Hypothese ist, dass das deutsche Passiv aufgrund seiner größeren Variabilität häufiger verwendet wird als das russische Passiv.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, dem deutschen Passiv, den Verbalgenera im Russischen, der Textanalyse und einer Zusammenfassung mit Resümees. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Passivverwendung in Deutsch und Russisch und deren kontrastiven Vergleich.
Welche konkreten Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert „Das Parfüm“ (als Beispiel für potentielles Passiv im Deutschen) und den „Eisbrecher“ (als Beispiel für reales Passiv im Russischen) sowie deren Übersetzungen.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Methodik?
Die Arbeit benennt methodologische Einschränkungen im Kapitel zur Textanalyse. Diese beziehen sich wahrscheinlich auf die Auswahl der Texte, die Komplexität der grammatischen Phänomene und die Interpretation der Ergebnisse.
- Quote paper
- Wadim Immel (Author), 2010, Diathese: Das deutsche Verbalgenus im kontrastiven Vergleich mit dem im Russischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171695