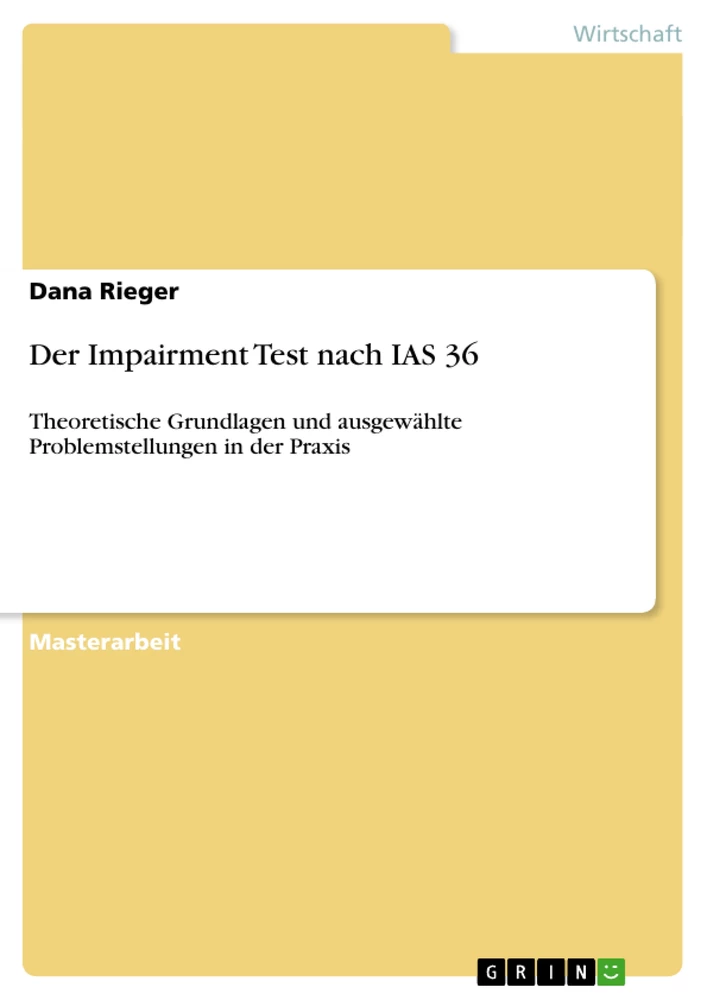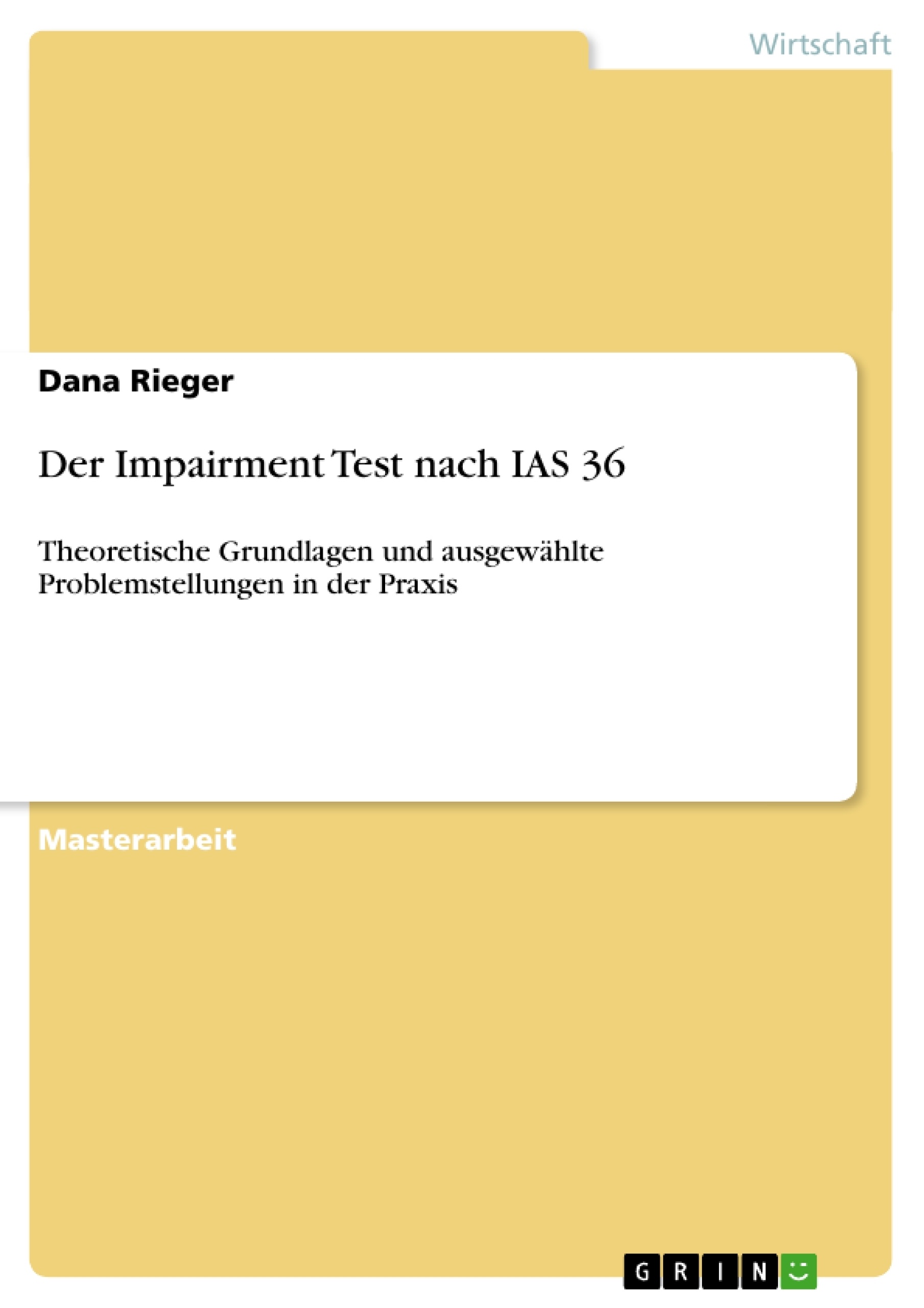Dr. Mayer-Wegelin misst dem Impairment Test in iAS 36 in Krisenzeiten eine größere Bedeutung zu als in Zeiten des Aufschwungs. Er wirft die Frage auf, „ob die Vermögenswerte, die in vergangenen Jahren z.B. im Rahmen von Unternehmenskäufen erworben wurden, noch werthaltig sind.“ Außerdem behauptet er, dass Unternehmen nicht nur unter dem Rückgang ihrer Umsätze zu leiden haben; als Folge dessen können auch außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte entstehen, sodass Rezessionen zu einer Kumulation negativer Effekte führen. Auch Freiberg und Lüdenbach betonen den Einfluss der Wachstumserwartungen auf das Ergebnis des Impairment Test. Sie könnten als geplante CFs in einen Impairment Test einfließen und fielen in Krisenzeiten niedriger aus, während Risikoprämien langfristig steigen und als Teil des Abzinsungssates das Ergebnis des Impairment Tests schmälerten. Dem entgegen stehen Ermessensspielräume seitens der in IAS 36 verankerten Vorschriften, die erhebliches bilanzpolitisches Potenzial bergen, um eine Wertminderung bzw. Wertaufholung gezielt herbeizuführen oder sie bewusst zu umgehen. Erschwerend kommt hinzu, dass Planungen grundsätzlich ungewiss sind. Insbesondere die Einbeziehung investitionstheoretischer Ansätze in die Barwertermittlung zieht subjektive Entscheidungen nach sich. Aus den dargestellten Sachverhalten ergibt sich nicht nur für den Rechnungslegenden und den Wirtschaftsprüfer die Erschwernis, sich auf dem schmalen Grat zwischen zulässiger individueller Auslegung und verbotener Blendung zu bewegen. Auch der Adressat ist betroffen, der den Informationen vertrauen können will. Er hätte große Probleme, wenn identisch aussehenden Jahresabschlüssen elementar andere Gegebenheiten zugrunde liegen würden.
Ziel der Arbeit ist, dem Leser unter Einbeziehung von Fachliteratur ein Bild über die Vorschriften des IAS 36 zu vermitteln und die Schwierigkeiten in deren praktischer Umsetzung aufzuzeigen. Eine empirische Vollerhebung auf Basis der Konzernabschlüsse der 30 DAX-Unternehmen für 2009 soll Aufschluss darüber geben, inwieweit in der Literatur diskutierte kritische Aspekte des IAS 36 Anwendung finden und welche Auswirkungen der durch IAS 36 gegebene Ermessenspielraum auf die „Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bilds“ der VFE-Lage hat. Abschließend soll geklärt werden, ob die Finanzkrise die vermuteten Auswirkungen auf den Impairment Test und damit einhergehende außerplanmäßige Abschreibungen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau
- 2 Grundlagen und Systematik
- 2.1 Grundlagen
- 2.1.1 Aufbau
- 2.1.2 Anwendungsbereich
- 2.2 Systematik des Impairment Tests
- 2.1 Grundlagen
- 3 Ermittlung des erzielbaren Betrags
- 3.1 Bewertungsobjekte
- 3.2 Bewertungsmethoden
- 3.3 Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch das marktpreisorientierte Verfahren
- 3.4 Ermittlung des Nutzwerts durch das kapitalwertorientierte Verfahren
- 3.4.1 Planungszeitraum
- 3.4.2 Behandlung von Synergieeffekten, Restrukturierungen und Investitionen
- 3.4.3 Behandlung von Finanzierungseffekten, Ertragssteuern und Cashflows in Fremdwährung
- 3.4.4 Methoden zur Cashflow-Ermittlung
- 3.4.5 Bestimmung des Diskontierungssatzes
- 3.4.5.1 Berücksichtigung des Risikos
- 3.4.5.2 Risikoloser Zinssatz
- 3.4.5.3 Risikoangepasster Zinssatz
- 3.4.5.3.1 Grundlagen der durchschnittlich gewichteten Kapitalkosten
- 3.4.5.3.2 Ermittlung der EK-Kosten mit dem Capital Asset Pricing Model
- 3.4.5.3.3 Ermittlung der FK-Kosten
- 3.4.5.3.4 Kritische Würdigung der Vor-Steuer-Betrachtung
- 3.5 Unterschiede im kapitalwertorientierten Verfahren bei Anwendung auf BZW und Nutzwert
- 4 Die zahlungsmittelgenerierende Einheit
- 4.1 Bildung einer ZGE
- 4.2 Unabhängigkeit der Mittelzuflüsse
- 4.3 Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden
- 4.4 Berücksichtigung des Goodwills
- 4.4.1 Verteilung des Goodwills
- 4.4.2 Vergleich von Full-Goodwill- und Neubewertungsmethode
- 4.5 Buchwert einer ZGE
- 5 Verarbeitung des Impairment Tests im Abschluss
- 5.1 Verbuchung einer Wertminderung
- 5.1.1 Bei einem einzelnen Vermögenswert
- 5.1.2 Bei einer ZGE ohne Goodwill
- 5.1.3 Bei einer ZGE mit Goodwill
- 5.2 Verbuchung einer Wertaufholung
- 5.2.1 Bei einem einzelnen Vermögenswert
- 5.2.2 Bei einer ZGE
- 5.2.3 Beim Goodwill
- 5.3 Entkonsolidierung
- 5.4 Anhangangaben
- 5.5 Plausibilisierung und Dokumentation
- 5.1 Verbuchung einer Wertminderung
- 6 Quantitative Auswertung der erhobenen Daten
- 6.1 Ausmaß der von IAS 36 betroffenen Vermögenswerte
- 6.2 Allgemeine Angaben zur Durchführung des Impairment Tests
- 6.2.1 Angaben zur Ermittlung des erzielbaren Betrags
- 6.2.2 Angaben zur Detailplanungsphase und Wachstumsrate
- 6.2.3 Angaben zum Diskontierungssatz
- 6.2.4 Angaben zu Wertminderungen
- 6.2.5 Angaben zu Wertaufholungen
- 7 Qualitative Auswertung ausgewählter Anhangangaben
- 7.1 Gründe für Wertberichtigungen
- 7.2 Beschreibung der ZGEs
- 7.3 Ermittlung des erzielbaren Betrags
- 7.4 Parameter im kapitalwertorientierten Verfahren
- 7.5 Wesentliche Annahmen und Sensitivitätsanalysen
- 7.6 Missverständliche und widersprüchliche Angaben
- 7.7 Musterbeispiel Deutsche Bank
- 8 Ergebnis
- Glossar
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Impairment Test nach IAS 36, beleuchtet dessen theoretische Grundlagen und analysiert ausgewählte Problemstellungen aus der Praxis. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Tests zu vermitteln und praxisrelevante Herausforderungen aufzuzeigen.
- Theoretische Grundlagen des Impairment Tests nach IAS 36
- Ermittlung des erzielbaren Betrags (nutzungswert- und marktwertorientierte Verfahren)
- Die zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE) und ihre Bedeutung im Impairment Test
- Verarbeitung des Impairment Tests im Jahresabschluss
- Ausgewählte praktische Problemstellungen und deren Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Impairment Tests nach IAS 36 ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit sowie den Aufbau der einzelnen Kapitel.
2 Grundlagen und Systematik: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien und den systematischen Ablauf des Impairment Tests gemäß IAS 36. Es wird der Anwendungsbereich definiert und der Aufbau des Tests detailliert beschrieben. Die Systematik wird Schritt für Schritt erklärt, um ein klares Verständnis für den Prozess zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung von theoretischen Grundlagen und praktischer Anwendung.
3 Ermittlung des erzielbaren Betrags: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Ermittlung des erzielbaren Betrags, dem Kern des Impairment Tests. Es werden verschiedene Bewertungsobjekte und -methoden diskutiert, darunter die marktpreisorientierte und die kapitalwertorientierte Methode. Die Kapitel beschreiben detailliert, wie der beizulegende Zeitwert und der Nutzwert ermittelt werden, inklusive der Berücksichtigung von Faktoren wie Planungszeitraum, Synergieeffekten, Restrukturierungen, Finanzierungseffekten und Steuern. Die unterschiedlichen Ansätze zur Cashflow-Ermittlung und die Bestimmung des Diskontierungssatzes, inklusive der Risikobewertung, werden umfassend erläutert. Besonderes Augenmerk liegt auf den Unterschieden im kapitalwertorientierten Verfahren bei der Anwendung auf den beizulegenden Zeitwert und den Nutzwert.
4 Die zahlungsmittelgenerierende Einheit: Dieses Kapitel definiert und erklärt die Konzepte der zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE) im Kontext des Impairment Tests. Es beleuchtet die Bildung einer ZGE, die Unabhängigkeit der Mittelzuflüsse, die Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden, und die Behandlung von Goodwill, inklusive der Verteilung des Goodwills und dem Vergleich der Full-Goodwill- und Neubewertungsmethode. Das Verständnis der ZGE ist essentiell für die korrekte Anwendung des Impairment Tests auf komplexe Unternehmenssituationen.
5 Verarbeitung des Impairment Tests im Abschluss: Dieses Kapitel beschreibt die korrekte Verbuchung von Wertminderungen und Wertaufholungen im Jahresabschluss, sowohl für einzelne Vermögenswerte als auch für ZGEs mit und ohne Goodwill. Es erklärt den Prozess der Entkonsolidierung und die notwendigen Anhangangaben. Die Kapitel betont die Bedeutung einer sorgfältigen Plausibilisierung und Dokumentation der durchgeführten Impairment Tests.
6 Quantitative Auswertung der erhobenen Daten: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer quantitativen Analyse der erhobenen Daten bezüglich der Anwendung des Impairment Tests in der Praxis. Es untersucht das Ausmaß der von IAS 36 betroffenen Vermögenswerte und liefert detaillierte Einblicke in die Durchführung des Tests, einschließlich der verwendeten Methoden zur Ermittlung des erzielbaren Betrags, der Detailplanung, des Diskontierungssatzes, sowie der Behandlung von Wertminderungen und Wertaufholungen. Diese Daten bieten einen empirischen Einblick in die Anwendung des Standards in Unternehmen.
7 Qualitative Auswertung ausgewählter Anhangangaben: Dieses Kapitel bietet eine qualitative Analyse ausgewählter Anhangangaben aus der Praxis, die im Zusammenhang mit dem Impairment Test stehen. Es untersucht die Gründe für Wertberichtigungen, beschreibt die verwendeten ZGEs und analysiert die Parameter des kapitalwertorientierten Verfahrens. Zusätzlich werden wesentliche Annahmen, Sensitivitätsanalysen, missverständliche und widersprüchliche Angaben untersucht. Ein Musterbeispiel der Deutschen Bank illustriert die Anwendung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Impairment Test, IAS 36, erzielbarer Betrag, Nutzwert, beizulegender Zeitwert, zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE), Goodwill, Wertminderung, Wertaufholung, Jahresabschluss, Bewertung, Kapitalwertmethode, Marktpreisverfahren, Risiko, Diskontierungssatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Impairment Test nach IAS 36
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit befasst sich umfassend mit dem Impairment Test nach IAS 36. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen, analysiert praxisrelevante Herausforderungen und vermittelt ein umfassendes Verständnis des Tests.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen des Impairment Tests nach IAS 36, die Ermittlung des erzielbaren Betrags (mit nutzungswert- und marktwertorientierten Verfahren), die Bedeutung der zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE), die korrekte Verarbeitung des Tests im Jahresabschluss und ausgewählte praktische Problemstellungen mit Lösungsansätzen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Systematik des Impairment Tests, Ermittlung des erzielbaren Betrags (inkl. detaillierter Erläuterung der Kapitalwertmethode und der Bestimmung des Diskontierungssatzes), die zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE), Verarbeitung des Impairment Tests im Abschluss, quantitative und qualitative Auswertung der Daten (inkl. Musterbeispiel Deutsche Bank), und abschließendes Ergebnis. Zusätzlich enthält sie ein Glossar, Literatur- und Quellenverzeichnis sowie ein Rechtsquellenverzeichnis.
Wie wird der erzielbare Betrag ermittelt?
Die Ermittlung des erzielbaren Betrags ist ein Kernstück der Arbeit. Es werden sowohl marktpreisorientierte als auch kapitalwertorientierte Verfahren detailliert beschrieben. Die Kapitel erläutert die Berücksichtigung von Faktoren wie Planungszeitraum, Synergieeffekten, Restrukturierungen, Finanzierungseffekten und Steuern. Die verschiedenen Methoden zur Cashflow-Ermittlung und die Bestimmung des Diskontierungssatzes (inkl. Risikobewertung) werden umfassend behandelt. Die Unterschiede im kapitalwertorientierten Verfahren bei der Anwendung auf den beizulegenden Zeitwert und den Nutzwert werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt die zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE)?
Die Arbeit erklärt das Konzept der ZGE im Kontext des Impairment Tests. Es werden die Bildung einer ZGE, die Unabhängigkeit der Mittelzuflüsse, die Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden und die Behandlung von Goodwill (inkl. Vergleich von Full-Goodwill- und Neubewertungsmethode) detailliert erläutert. Das Verständnis der ZGE ist für die korrekte Anwendung des Impairment Tests essentiell.
Wie wird der Impairment Test im Jahresabschluss verbucht?
Die Arbeit beschreibt die korrekte Verbuchung von Wertminderungen und Wertaufholungen im Jahresabschluss für einzelne Vermögenswerte und ZGEs (mit und ohne Goodwill). Sie erläutert die Entkonsolidierung und die notwendigen Anhangangaben sowie die Bedeutung der Plausibilisierung und Dokumentation.
Welche Ergebnisse liefert die quantitative und qualitative Datenanalyse?
Die quantitative Analyse untersucht das Ausmaß der von IAS 36 betroffenen Vermögenswerte und liefert detaillierte Einblicke in die praktische Anwendung des Impairment Tests. Die qualitative Analyse untersucht ausgewählte Anhangangaben aus der Praxis, analysiert die Gründe für Wertberichtigungen, beschreibt die verwendeten ZGEs und analysiert die Parameter des kapitalwertorientierten Verfahrens, wesentliche Annahmen, Sensitivitätsanalysen, missverständliche und widersprüchliche Angaben. Ein Musterbeispiel der Deutschen Bank veranschaulicht die praktische Anwendung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Impairment Test, IAS 36, erzielbarer Betrag, Nutzwert, beizulegender Zeitwert, zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE), Goodwill, Wertminderung, Wertaufholung, Jahresabschluss, Bewertung, Kapitalwertmethode, Marktpreisverfahren, Risiko, Diskontierungssatz.
- Quote paper
- Dana Rieger (Author), 2011, Der Impairment Test nach IAS 36, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171426