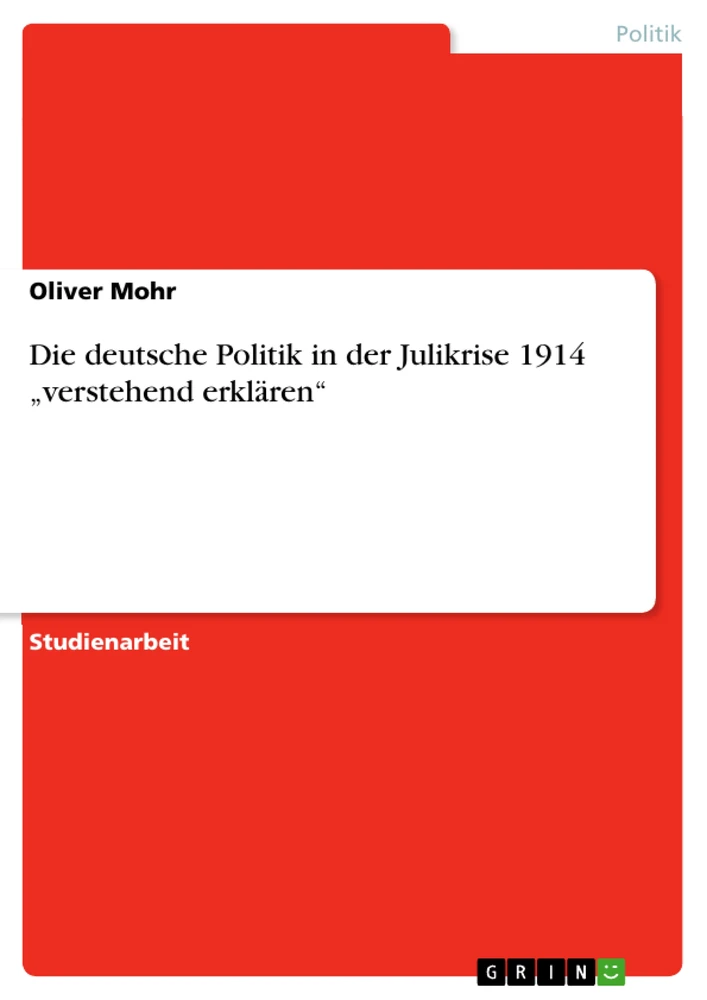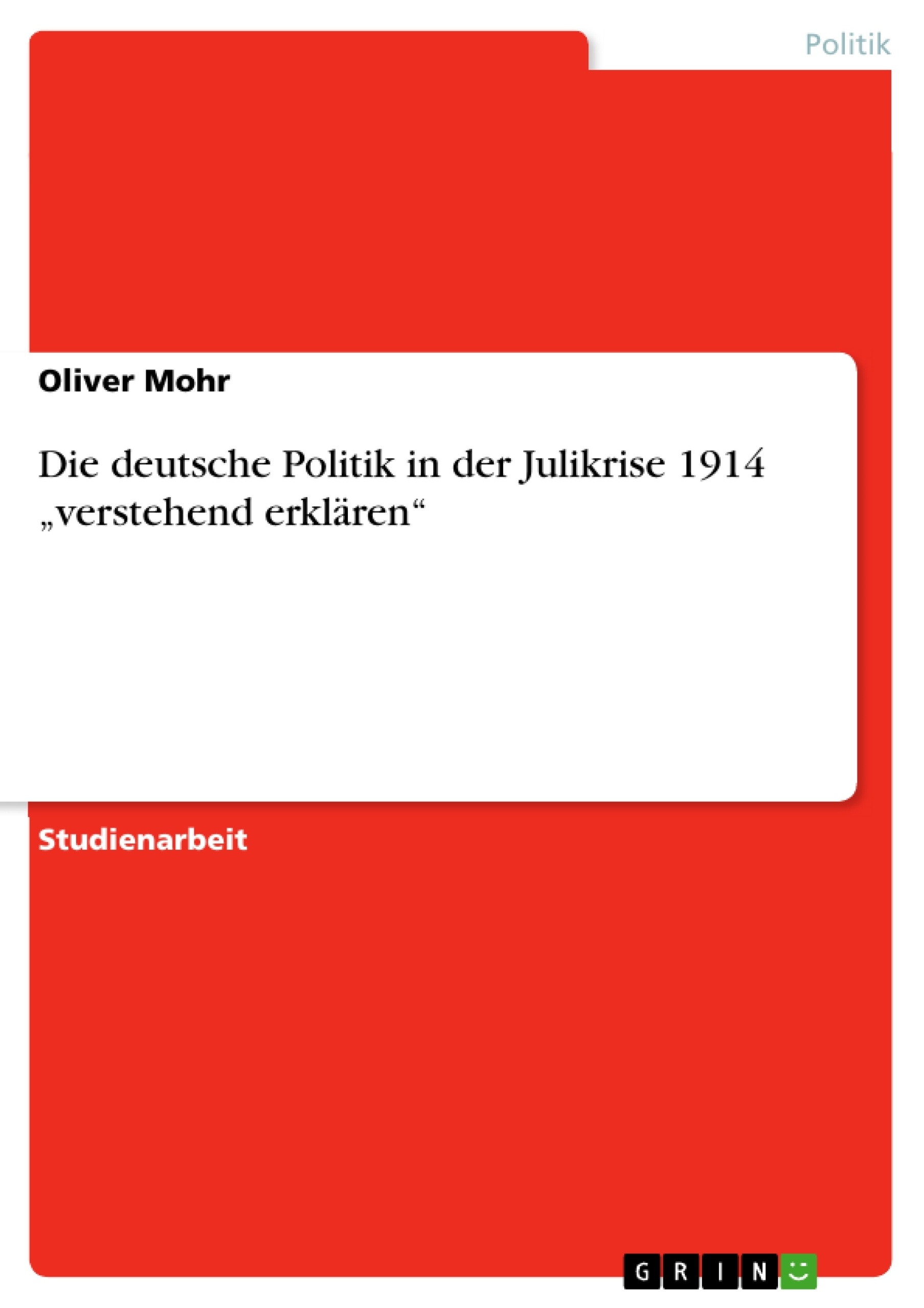Abschliessend möchte ich einen Erklärungsansatz vorschlagen, der die subjektive Dimension der Geschichte der Julikrise mit allgemeinen Handlungsmustern verbindet. In Anlehnung an Gregory Bateson fasse ich Konflikte als Lernprozesse auf.1 Unter Lernen kann ein adaptiver Prozess verstanden werden, in dem ein System sich durch „Rückkoppelungsschleifen“ seiner Umwelt nach den Prinzipien Versuch und Irrtum anpasst. Lernen bedeutet eine Problemlösungskompetenz, die Gewohnheiten entwickelt, nicht nur einzelne Probleme, sondern ganze „Klassen“ von Problemen zu lösen. Diese Fähigkeit bezeichnet Bateson als „lernen, zu lernen“ oder „deutero-lernen“. Genau an dieser Aufgabe scheiterte die deutsche Politik in der Julikrise. Die Logik des Schlieffenplans, die Haltung des „Jetzt oder nie“ oder die Einstellung „Not kennt kein Gebot“ waren starre Handlungsmuster, die eine erfolgreiche Anpassung der Politik an ihre internationalen Kontexte verhinderte. Die deutsche Politik war im internationalen Konflikt des Julis 1914 nicht mehr in der Lage, durch Lernprozesse diese Muster aufzubrechen. Sie war zwar fähig, taktische Einzelentscheidungen zu treffen, vermochte aber nicht mehr, Erfahrungen mit ihren Gewohnheiten zurückzukoppeln, hatte also die Fähigkeit des Deutero-Lernens verloren. Im Gegenteil, subjektiv gesehen schienen sich die starren Muster immer mehr zu bestätigen und bestärkten dadurch die Überzeugung der Reichsleitung, dass ein Waffengang unvermeidlich war, um dem Dilemma der eigenen Politik zu entkommen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Einführung: Die Julikrise 1914 – der äussere Geschehensablauf
- III. „Dieses in allen Fugen krachende Staatengebilde“: Das 'Freundbild' Österreich-Ungarn
- IV. Die Gefahr des „Slawentaumels“: Das Feindbild Russland
- V. In den Fallstricken der eigenen Strategie: Der Schlieffenplan
- VI. „Das Netz ist uns plötzlich über dem Kopf zugezogen“: Der Weg in den Weltkrieg
- VII. Schlussbetrachtung: Verstehen und Erklären der deutschen Politik in der Julikrise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der deutschen Politik im Juli 1914 und analysiert, wie die deutschen Entscheidungsträger zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs beitrugen. Dabei fokussiert sie auf den subjektiven Wahrnehmungshorizont der deutschen Reichsleitung und greift den Ansatz Michael Salewskis auf, der betont, dass rational nicht erklärbare Motive wie Prestigedenken und Status- und Gesichtswahrung den Ablauf der Julikrise beeinflussten. Die Arbeit rekonstruiert das normative Koordinatensystem der deutschen Akteure und beleuchtet, welche Handlungsoptionen sie für sich wahrnahmen und welche Grenzen ihre subjektiv wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten hatten.
- Die subjektive Wahrnehmung der deutschen Akteure in der Julikrise
- Das 'Freundbild' Österreich-Ungarns und seine Einfluss auf den Wahrnehmungshorizont
- Das Feindbild Russland und die Bedrohung durch den „Slawentaumel“
- Die Rolle des Schlieffenplans in der deutschen Strategie
- Das Problem der Einkreisung und die deutsche Selbstwahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Sie erläutert die Unterscheidung zwischen „Verstehen“ und „Erklären“ sozialer Phänomene und betont die Bedeutung der „verstehenden Soziologie“ nach Max Weber. Darüber hinaus führt sie den Ansatz „Entfernung und Einsicht“ von Jürgen Kocka ein, der die aktuelle Weltkriegsforschung charakterisiert.
- II. Zur Einführung: Die Julikrise 1914 – der äussere Geschehensablauf: Dieses Kapitel skizziert den äußeren Ablauf der Julikrise 1914, beginnend mit der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand bis hin zur Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.
- III. „Dieses in allen Fugen krachende Staatengebilde“: Das 'Freundbild' Österreich-Ungarn: Dieses Kapitel beleuchtet das 'Freundbild' Österreich-Ungarns aus der Sicht der deutschen Akteure und wie es ihren Wahrnehmungshorizont beeinflusste.
- IV. Die Gefahr des „Slawentaumels“: Das Feindbild Russland: Dieses Kapitel widmet sich dem Feindbild Russland und zeigt, wie die deutsche Reichsleitung die Bedrohung durch Russland wahrnahm.
- V. In den Fallstricken der eigenen Strategie: Der Schlieffenplan: Dieses Kapitel analysiert den Schlieffenplan als Beispiel für die deutsche Strategie und deren Wahrnehmung der eigenen Optionen in der Julikrise.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Julikrise 1914, deutsche Politik, subjektive Wahrnehmung, 'Freundbild', Österreich-Ungarn, Feindbild, Russland, Schlieffenplan, Einkreisung, Weltmacht, Untergang, Verstehen, Erklären, Max Weber, Jürgen Kocka, Michael Salewski. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Interpretation der deutschen Politik im Kontext der Julikrise 1914, wobei der Fokus auf der subjektiven Wahrnehmung der deutschen Entscheidungsträger liegt.
- Arbeit zitieren
- Oliver Mohr (Autor:in), 2010, Die deutsche Politik in der Julikrise 1914 „verstehend erklären“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171399